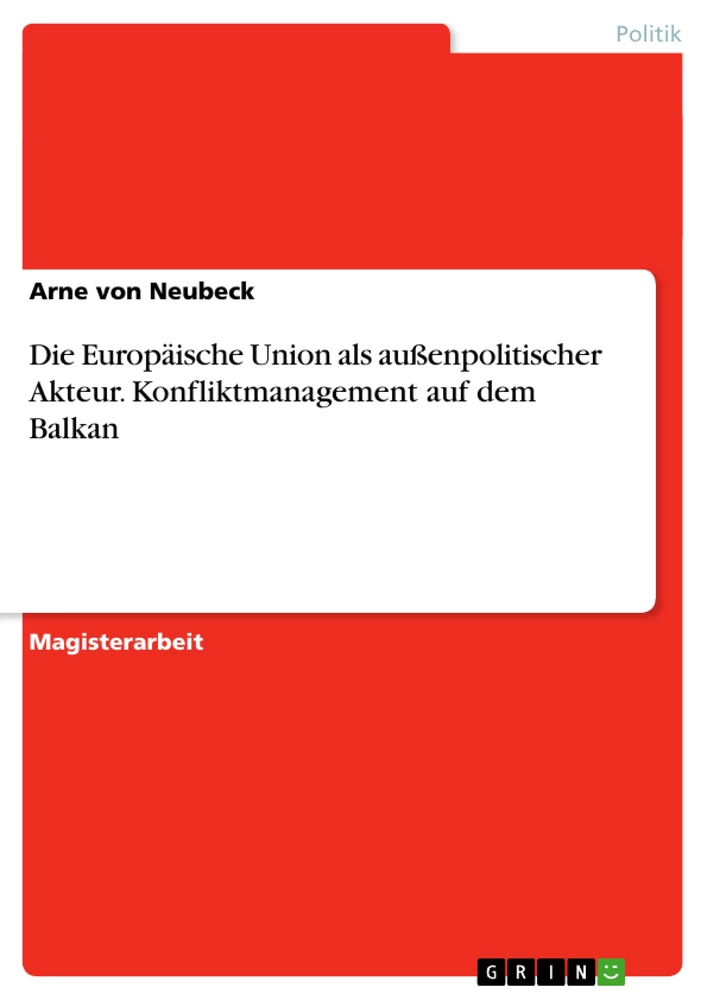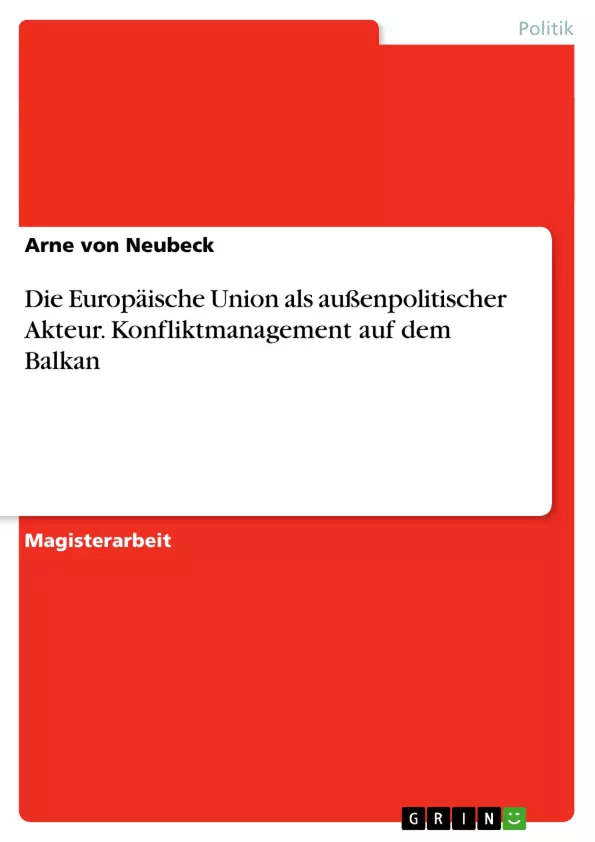Der Zerfall Jugoslawiens zu Beginn der 90er führte der Welt vor Augen, wie schwierig der sicherheitspolitische Paradigmenwechsel zu vollziehen war. Man war nicht mehr mit der Notwendigkeit konfrontiert, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, sondern mit der Aufgabe, regionale Konflikte und Bürgerkriege einzudämmen; nicht mehr über das Instrument der Abschreckung war Frieden zu gewährleisten, sondern durch präventive Diplomatie. Diesen Wandel nach Ende des Kalten Krieges verdeutlicht die Carnegie Commission in ihrer Studie zur Konfliktprävention: „From Cold War to Deadly Peace“ heißt es da zur Illustration der neuen Problemlage. Auf diesen „Tödlichen Frieden“ war die Welt kaum vorbereitet. Weder die internationalen Organisationen noch die Nationalstaaten verfügten über die geeigneten Konzepte, Strategien und Instrumente, um angemessen auf diese neue Qualität von Krisen reagieren zu können.
Aufgrund ihrer geografischen Nähe, ihrer Größe und ihrer Bedeutung als Wertegemeinschaft kam der EG besondere Verantwortung gegenüber den Ereignissen in Osteuropa im Allgemeinen und auf dem Balkan im Besonderen zu. Ziel dieser Arbeit ist es zum einen, die Einflüsse, Verhaltens- und Vorgehensweise von EG bzw. EU im Rahmen von EPZ bzw. GASP auf die Konfliktverläufe auf dem Balkan im Vorfeld der sich entwickelnden Kriege darzustellen und zu analysieren. War die EPZ Anfang der 90er überhaupt in der Lage einen Konflikt zu regulieren, den der letzte US-Botschafter in Jugoslawien, Zimmermann, als un-lösbar bezeichnet hatte? Wie verhielt sich die EG hier und wie die EU später in den Konflikten um das Kosovo und Mazedonien? Gegenstand der Untersuchung ist dabei das Konfliktmanagement im Vorfeld der spezifischen Krisen bzw. während des weiteren Verlaufs. Nur am Rande behandelt werden kann der allgemeine europäische Beitrag zur Konflikttransformation. Zum anderen ist der Frage nachzugehen, ob die Union aus den negativen wie positiven Erfahrungen ihres Konfliktmanagements Lehren für die GASP zog und ob sie in der Konsequenz entsprechende Neuerungen entwickelte, um aktiv auf Situationen zu reagieren, wie sie sich zunächst mit dem Kosovo-Konflikt und später mit der Mazedonien-Krise ergaben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Balkan als Prüfstein für Europa
- Herangehensweise und Aufbau
- Forschungsstand und Quellenlage
- Ansätze und Strategien zum Konfliktmanagement in ethno-politischen Konflikten
- Grundlegendes zur Konfliktforschung
- Zum Wesen des ethno-politischen Bürgerkrieges
- Präventive Diplomatie in ethno-politischen Konflikten
- Schwierigkeiten und Erfolgsbedingungen präventiver Diplomatie
- Regulierungsmöglichkeiten bei ethno-politischen Konflikten
- Instrumente zur Einflussnahme auf Konflikte
- Mediation
- Zum Wesen der Mediation
- Verschiedene Mediationsstrategien
- Sanktionen
- Monitoring
- Militärische Intervention
- Die Verantwortung der EG im Jugoslawien-Konflikt
- Fallstudie 1 - die EPZ und der Zerfall Jugoslawiens
- Grundlagen der EPZ
- Entwicklung eines Systems europäischer Außenpolitikkoordinierung
- Die Ausgestaltung der EPZ nach der Einheitlichen Europäischen Akte
- Die Genese des Jugoslawien-Konflikts bis 1990
- Die EG als Konfliktmanager im Jugoslawien-Konflikt
- Die Bedeutung Jugoslawiens für die EG-Politik von 1990-1991
- Die EG-Troika-Missionen
- Die ersten Erfolge der EG-Verhandlungen
- Das Scheitern der Vereinbarungen von Brioni
- Das Scheitern der Troika-Missionen
- Die EG-Friedenskonferenz und der Carrington-Friedensplan
- Der schwierige Beginn der Verhandlungen im September
- Die Ausarbeitung von Friedensplänen im Oktober
- Die EG-Anerkennungspolitik im Falle Kroatiens und Sloweniens
- Die Entwicklungen bis zur Anerkennung
- Der Streit um den Zeitpunkt der Anerkennung
- Der Einfluss der Badinter-Kommission auf die Politik der Zwölf
- Die Anerkennungspolitik und ihre Folgen für die EG
- Die EPZ im Jugoslawien-Konflikt – eine Evaluierung
- Die besonderen Maßnahmen der EPZ
- Die EG-Sanktionspolitik
- Die EG-Beobachtermission
- Die Friedenskonferenz und der Sonderbeauftragte
- Die Diskussion um eine militärische Intervention
- Grundprobleme der EPZ
- Nationale Interessen und Entscheidungsfindung
- Institutionelle Mängel
- Fehlende Druckmittel
- Bewertung
- Die Entwicklung der Europäischen Union als außenpolitischer Akteur
- Die Herausforderungen des Konfliktmanagements auf dem Balkan
- Die Rolle von Präventiver Diplomatie, Mediation und Sanktionen
- Die Auswirkungen von nationalen Interessen und institutionellen Mängeln auf die EU-Politik
- Die Evaluierung der Wirksamkeit der EU-Interventionen in den verschiedenen Konflikten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Rolle der Europäischen Union als außenpolitischer Akteur im Konfliktmanagement auf dem Balkan. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Strategien und Instrumente, die die EU in den Konflikten in Jugoslawien, Kosovo und Mazedonien eingesetzt hat. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Probleme, mit denen die EU im Umgang mit diesen Konflikten konfrontiert war, und analysiert die Erfolgsfaktoren und Misserfolge der EU-Politik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den Balkan als Prüfstein für Europa und legt die Herangehensweise und den Aufbau der Arbeit dar. Anschließend werden der Forschungsstand und die Quellenlage beleuchtet. Das zweite Kapitel behandelt die Ansätze und Strategien zum Konfliktmanagement in ethno-politischen Konflikten. Es werden die Grundlagen der Konfliktforschung, das Wesen des ethno-politischen Bürgerkrieges sowie präventive Diplomatie und verschiedene Instrumente zur Einflussnahme auf Konflikte analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verantwortung der EG im Jugoslawien-Konflikt.
Die folgenden Kapitel widmen sich Fallstudien, die den Einsatz der EPZ und GASP in den Konflikten in Jugoslawien, Kosovo und Mazedonien beleuchten. Diese Fallstudien analysieren die besonderen Maßnahmen, die die EU in den jeweiligen Konflikten ergriffen hat, sowie die zugrundeliegenden Probleme und Herausforderungen. Sie evaluieren zudem die Wirksamkeit der jeweiligen Interventionsstrategien.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Europäische Union, Konfliktmanagement, Balkan, ethno-politische Konflikte, präventive Diplomatie, Mediation, Sanktionen, EPZ, GASP, Jugoslawien, Kosovo, Mazedonien, Interventionsstrategie, Erfolgsfaktoren, Misserfolge.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die EU beim Zerfall Jugoslawiens?
Die EU (bzw. EG) versuchte durch präventive Diplomatie, Sanktionen und Monitoring den Konflikt einzudämmen, stieß dabei jedoch auf erhebliche institutionelle Grenzen.
Was versteht man unter präventiver Diplomatie in ethno-politischen Konflikten?
Präventive Diplomatie umfasst Maßnahmen zur Verhinderung des Ausbruchs, der Eskalation oder der Ausbreitung von Konflikten durch Verhandlungen und Mediation.
Warum war das Konfliktmanagement auf dem Balkan für Europa so schwierig?
Nationale Interessen der Mitgliedstaaten, fehlende militärische Druckmittel und das Fehlen geeigneter Konzepte für regionale Bürgerkriege nach dem Kalten Krieg erschwerten das Handeln.
Was war die EPZ und welche Bedeutung hatte sie?
Die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) war das System zur Koordinierung der Außenpolitik vor der Einführung der GASP und wurde im Jugoslawien-Konflikt auf die Probe gestellt.
Welche Instrumente nutzt die EU zur Einflussnahme auf Konflikte?
Zu den Instrumenten gehören Mediation, wirtschaftliche Sanktionen, Monitoring-Missionen und in letzter Konsequenz militärische Interventionen.
Hat die EU aus den Krisen auf dem Balkan gelernt?
Ja, die Arbeit untersucht, ob die Union aus negativen Erfahrungen Lehren für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zog, um auf Krisen wie im Kosovo besser reagieren zu können.
- Citation du texte
- Arne von Neubeck (Auteur), 2002, Die Europäische Union als außenpolitischer Akteur. Konfliktmanagement auf dem Balkan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27071