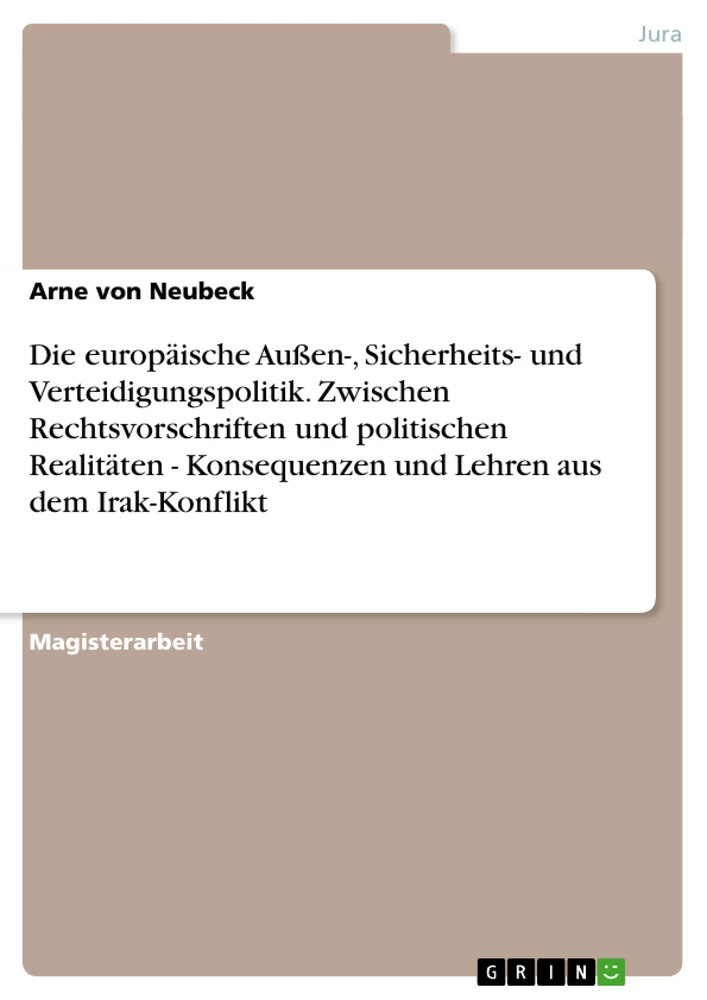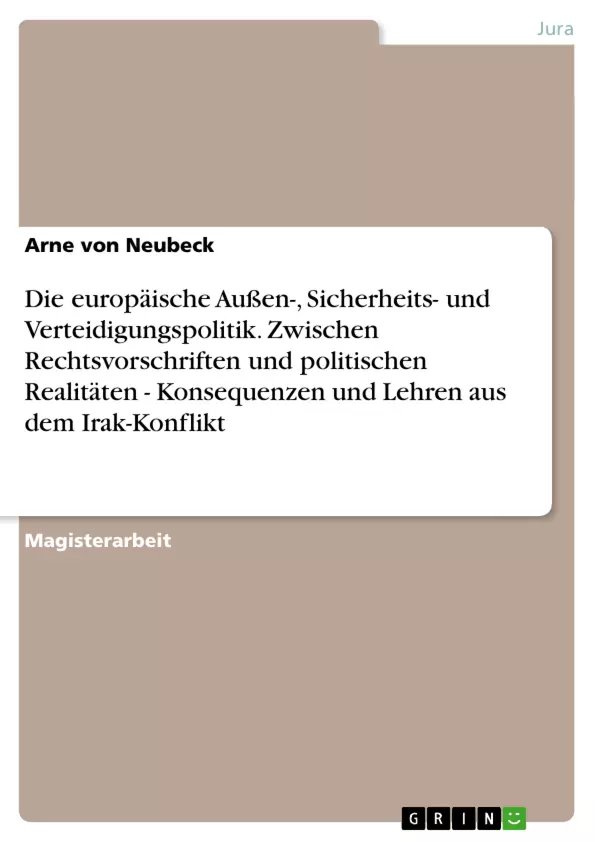Als mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 80er und Ende der 90er der Warschauer Pakt verschwand, befand sich die Welt im großen sicherheitspolitischen Umschwung. Eine Neudefinition der Sicherheitslage war notwendig geworden. Während die Transformation der mittel- und osteuropäischen Staaten vom sozialistischem Vasallenstaat zu einem demokratischen System im Wesentlichen erfolgreich verlief, wuchs die Hoffnung auf ein vereintes Europa. Die EU-Osterweiterung ist ein Jahrzehnt später Ausdruck dieser positiven Entwicklungen. Hingegen sorgte die Fragmentierung im östlichen Europa für regionale Spannungen und schwerere Konflikte. Insgesamt blieben diese Auseinandersetzungen aber regional begrenzt und fanden kaum eine Internationalisierung. Für die Europäische Gemeinschaft erwuchsen hieraus keine besonderen Herausforderungen.
Es war der ausbrechende Konflikt im ehemaligen Jugoslawien Anfang der 90er, der den Europäern sehr schnell ihre Hilf- und Kraftlosigkeit bewusst machte, auf Konflikte vor ihrer Haustür in adäquater Form zu reagieren. Schon lange hatten sich die Europäer um eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik bemüht. Nachdem erste Versuche in den 50er Jahren gescheitert waren, dauerte es bis 1970, ehe die Frage einer außenpolitischen Koordinierung wieder ernsthaft diskutiert wurde. Dieses Bestreben mündete in der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ). Deren strukturelle Defizite sowie ein fehlender gemeinsamer Wille wurden den Europäern wie der Welt im Jugoslawien-Konflikt vor Augen geführt. Im Bewusstsein der mangelnden Praktikabilität der EPZ hatten sich die Europäer Anfang der 90er dazu entschlossen, in einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu kooperieren. Handelte es sich dabei zweifelsohne um einen integrativen Fortschritt, so wurde alsbald deutlich, dass auch diese Reform zunächst nur Stückwerk bleiben sollte. Im Zuge der Revision des Unionsvertrages in Amsterdam bemühte man sich zwar um eine Fortentwicklung bestehender Strukturen, echte qualitative Änderungen konnten trotz der drängenden Probleme in der Weltpolitik aber nicht erreicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemaufriss
- Herangehensweise und Aufbau
- Forschungsstand und Quellenlage
- Entwicklung einer europäischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- Entwicklung eines Systems europäischer Außenpolitikkoordinierung
- Erste Entwicklungen in der Nachkriegszeit
- Die Einheitliche Europäische Akte
- Ausgestaltung der EPZ nach der EEA
- Rechtliche Einordnung der EPZ
- Bewertung
- Entwicklung einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
- Entwicklung der GASP durch den Vertrag von Maastricht
- Die GASP nach Maastricht
- Rechtliche Einordnung der GASP
- Bewertung
- Fortentwicklung der GASP durch den Vertrag von Amsterdam
- Ausgestaltung der GASP nach Amsterdam
- Bewertung
- Entwicklung der GASP durch den Vertrag von Maastricht
- Entwicklung einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- Entwicklung der ESVP durch Regierungskonferenzen
- Fortentwicklung von GASP und ESVP durch Nizza
- Rechtliche Einordnung der ESVP
- Bewertung
- Zusammenfassung
- Entwicklung eines Systems europäischer Außenpolitikkoordinierung
- Die EU im Irak-Konflikt
- Veränderte Sicherheitslage nach 9/11
- Europäische Politik nach 9/11
- Irak-Politik als Spaltpilz der EU
- Im Vorfeld des Krieges
- Erklärung der Acht
- Vierergipfel
- Gründe für die Spaltung
- Verständnis der Rollen von NATO und EU
- Vorbehalte gegen eine deutsch-französische Führungsrolle
- Europäische Außenpolitik in den Kinderschuhen
- Divergente außenpolitische Identitäten
- Bewertung
- Europäische Politik nach Ende des Irak-Kriegs
- Bewertung
- ESVP: wirksames Instrument autonomen Handelns?
- Einsätze im Rahmen der ESVP
- EU-Polizeimission EUPM
- Operation Concordia
- EU-Polizeimission Proxima
- Operation Artemis
- SFOR-Mission
- Bewertung der Einsätze
- Der Konvent zur Reform der EU
- Zusammensetzung und Arbeitsweise
- Arbeitsgruppe Außenpolitisches Handeln
- Aufgabenstellung an die Arbeitsgruppe
- Vorschläge der Arbeitsgruppe
- Wichtigste Ergebnisse des Konvents und Bewertung
- Arbeitsgruppe „Verteidigung“
- Aufgabenstellung an die Arbeitsgruppe
- Die europäische Sicherheitsdoktrin
- Bewertung
- Einsätze im Rahmen der ESVP
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Entwicklung der europäischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) und analysiert deren Wirksamkeit anhand des Irak-Konflikts. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der ESVP aufzuzeigen und deren Handlungsfähigkeit im Kontext der internationalen Politik zu beleuchten.
- Die Entwicklung der ESVP von ihren Anfängen bis zur Gegenwart
- Die Rolle der EU im Irak-Konflikt und die Folgen für die ESVP
- Die Analyse der Wirksamkeit der ESVP als Instrument autonomen Handelns
- Die Herausforderungen und Chancen der ESVP im Kontext der veränderten Sicherheitslage
- Die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung der ESVP
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und die Forschungsmethodik. Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung der europäischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik von ihren Anfängen bis zur Gegenwart dargestellt. Dazu werden die wichtigsten Schritte der Politikkoordinierung und die Rolle der verschiedenen Verträge analysiert.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Rolle der EU im Irak-Konflikt und analysiert die Folgen der europäischen Politik auf die ESVP. Dabei werden die Positionen der einzelnen Mitgliedstaaten im Vorfeld des Krieges, die Erklärung der Acht und die Vierergipfel betrachtet. Die Gründe für die Spaltung der EU im Irak-Konflikt werden untersucht, ebenso wie die Bewertung der europäischen Politik nach Ende des Krieges.
Im vierten Kapitel werden die Einsätze der ESVP unter die Lupe genommen und deren Wirksamkeit als Instrument autonomen Handelns analysiert. Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen Einsätzen wie der EU-Polizeimission EUPM, der Operation Concordia und der SFOR-Mission. Des Weiteren wird der Konvent zur Reform der EU und die Rolle der Arbeitsgruppe Außenpolitisches Handeln sowie die Arbeitsgruppe "Verteidigung" betrachtet. Abschließend wird die europäische Sicherheitsdoktrin untersucht und bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Irak-Konflikt, internationale Beziehungen, NATO, Europäische Union, Mitgliedstaaten, Handlungsfähigkeit, Autonomie, politische Realitäten, Rechtvorschriften.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen GASP und ESVP?
Die GASP ist die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, während die ESVP (Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik) den militärischen und krisenreaktiven Teilbereich davon darstellt.
Warum war der Irak-Konflikt ein „Spaltpilz“ für die EU?
Die Mitgliedstaaten waren uneins über die Rolle der NATO, das Verhältnis zu den USA und eine mögliche deutsch-französische Führungsrolle.
Welche Lehren wurden aus dem Jugoslawien-Konflikt gezogen?
Der Konflikt machte die Hilflosigkeit der Europäer deutlich und führte zur Erkenntnis, dass die bisherige Koordination (EPZ) strukturelle Defizite aufwies.
Was sind Beispiele für ESVP-Einsätze?
Dazu zählen die Polizeimission EUPM, die Operation Concordia in Mazedonien und die Operation Artemis im Kongo.
Welche Rolle spielte der Vertrag von Maastricht?
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die GASP offiziell als eine der Säulen der Europäischen Union etabliert.
- Quote paper
- Arne von Neubeck (Author), 2004, Die europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zwischen Rechtsvorschriften und politischen Realitäten - Konsequenzen und Lehren aus dem Irak-Konflikt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27072