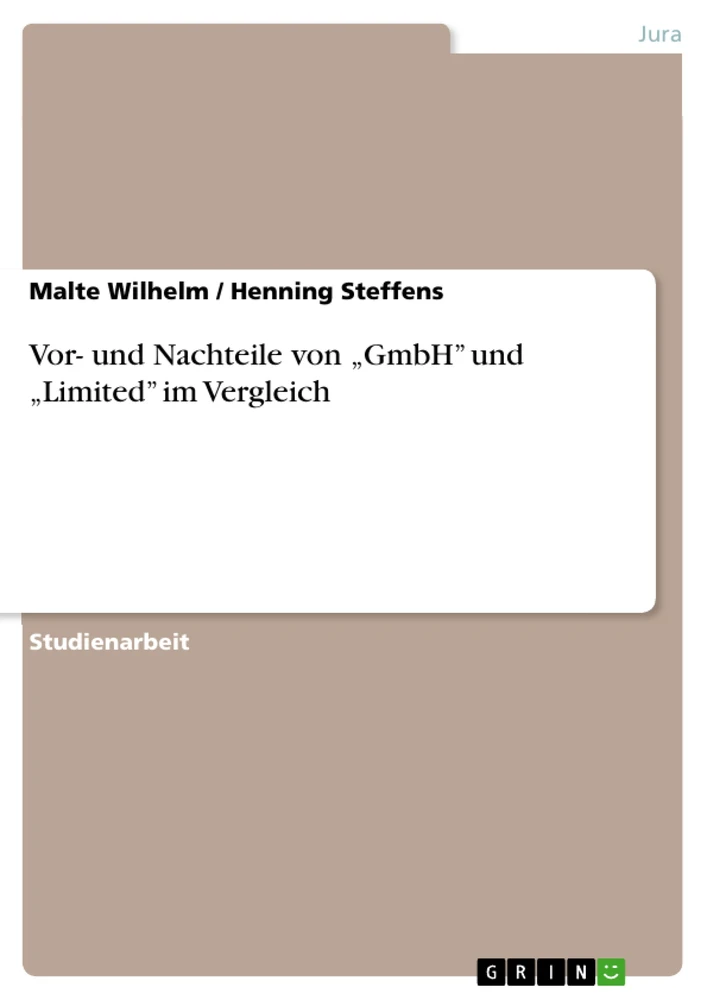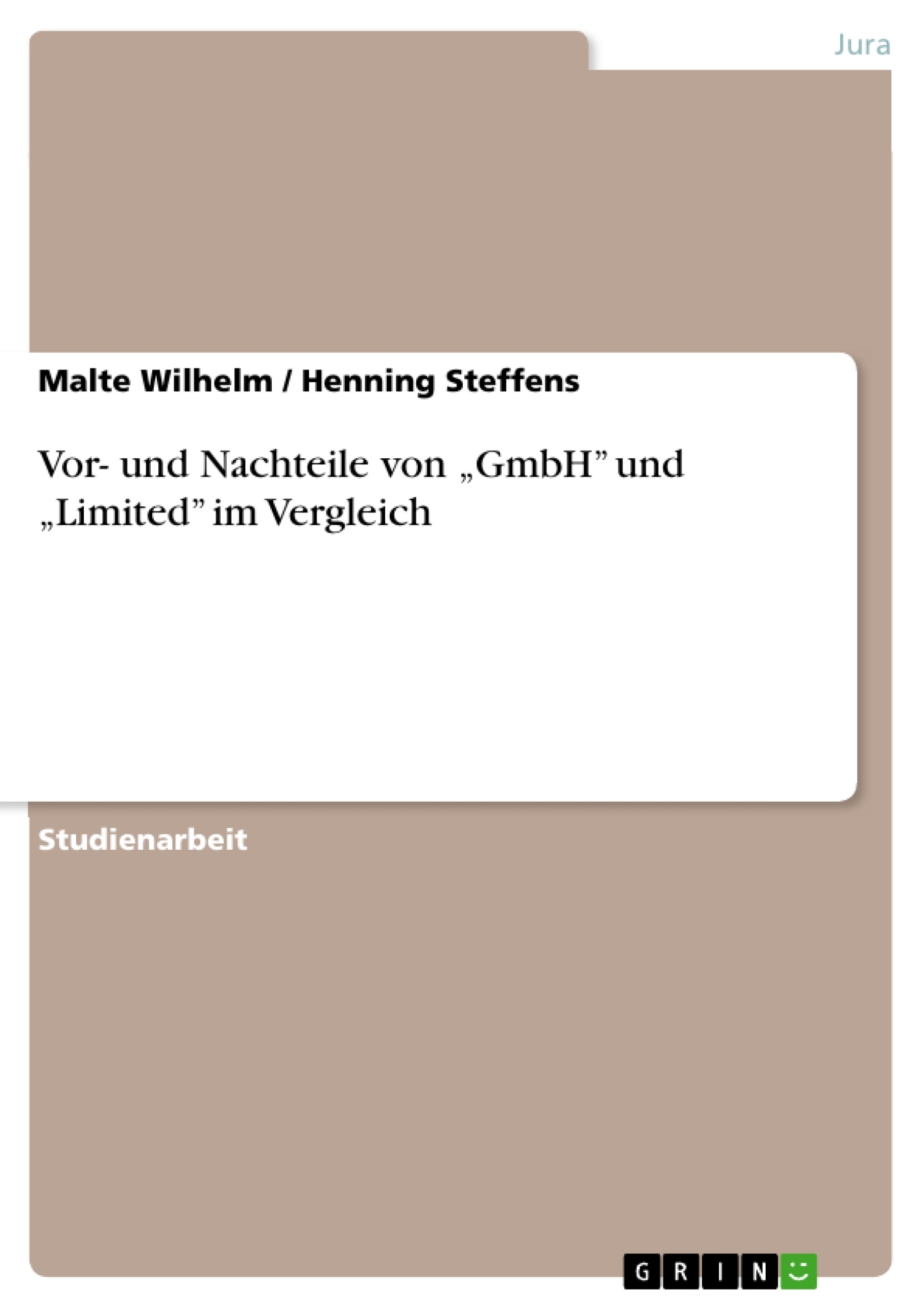Die Niederlassungsfreiheit ist eine der elementaren Grundfreiheiten der Europäischen Union. Sie ist die Grundlage dafür, dass sich EU-Bürger überall in der Europäischen Union niederlassen und sich eine Existenz aufbauen können. Die in den Artikeln 49–55 des Vertrages zur Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verfassten Regelungen beziehen sich sowohl auf natürliche als auch auf juristische Personen. Der AEUV bildet also die Grundlage für die Wahlfreiheit der Gesellschaftsform innerhalb der EU.
Nicht nur die europäischen Verträge, sondern auch der Europäische Gerichtshof hat in wegweisenden Urteilen zu der Wahl- und Niederlassungsfreiheit der Gesellschaftsformen beigetragen. So hat der EuGH unter anderem in der „Centros-Entscheidung“, der „Überseering-Entscheidung“ und der „Inspire Art Entscheidung“ dazu beigetragen, dass Gesellschaften in einem Mitgliedsstaat der EU gegründet werden können und sich gleichzeitig uneingeschränkt in anderen Mitgliedsstaaten der EU betätigen dürfen. Es besteht auch die Möglichkeit, in einem EU-Staat den Gesellschaftssitz zu unterhalten, dort allerdings gar nicht geschäftstätig zu sein, sondern nur die Vorzüge des Nationalrechts zu genießen. In den Mitgliedsstaaten werden zwei Theorien über die Anerkennung ausländischer Gesellschaften und das für sie geltende Gesellschaftsrecht unterschieden. Zum einen gibt es die Theorie, dass Gesellschaftsformen nach einem Umzug in ein anderes EU-Land dem Recht des Staates unterworfen bleiben, in dem sie gegründet wurde. Dies wird im Allgemeinen auch als Gründungstheorie bezeichnet. Entgegen der Gründungstheorie gibt es die sogenannte Sitztheorie. Diese legt fest, dass Gesellschaften sich grundsätzlich dem Recht des Staates unterzuordnen haben, in dem der Verwaltungshauptsitz der Gesellschaft liegt. Bisher galt die Sitztheorie in der deutschen Rechtsprechung als die Vorherrschende, allerdings unterstützt der EuGH mit seinen Urteilen die Anhänger der Gründungstheorie. Die deutschen Regelungen der Sitztheorie haben es ausländischen Gesellschaftsformen vor den Entscheidungen des EuGH schwer gemacht, ihren Sitz nach Deutschland zu verlegen. Bis dahin bestanden die deutschen Behörden darauf, ihre strengen nationalen Gründungsvoraussetzungen für alle Gesellschaften zum Mindeststandard zu machen. Der EuGH hat durch seine Entscheidungen und die damit verbundene Unterstützung der Gründungstheorie, den Eintritt in die Märkte für alle Gesellschaftsformen wesentlich vereinfacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gründungsphase einer Gesellschaft
- 2.1 Startkapital und Mindesteinlage
- 2.2 Vermögensbindung und Kapitalaufbringung
- 2.3 Organisationsverfassung
- 2.4 Notarielle Beurkundung innerhalb der Gesellschaften
- 2.5 Anmeldung, Prüfung und Eintragung im Handelsregister
- 3 Organe
- 3.1 GmbH
- 3.2 Limited
- 4 Sitz der Gesellschaft
- 5 Buchführungspflicht
- 6 Haftung
- 7 Mitbestimmung
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit vergleicht die Vor- und Nachteile der GmbH und der Limited, zwei gängige Gesellschaftsformen in Europa. Die Arbeit untersucht die Gründungsphase, die Organe, den Sitz der Gesellschaft, die Buchführungspflicht, die Haftung und die Mitbestimmung in beiden Gesellschaftsformen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die rechtlichen und organisatorischen Unterschiede zu liefern.
- Gründung und Kapitalaufbringung von GmbH und Limited
- Unterschiede in der Organisationsstruktur und den Organen
- Vergleich der Haftungsregelungen
- Rechte und Pflichten der Gesellschafter
- Sitz der Gesellschaft und rechtliche Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Niederlassungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union ein und betont die Bedeutung der Wahlfreiheit der Gesellschaftsform. Sie skizziert die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und die bestehenden Rechtsauffassungen bezüglich der Gründungstheorie und der Sitztheorie in Bezug auf die Anerkennung ausländischer Gesellschaften. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die ausländische Gesellschaftsformen vor den EuGH-Urteilen in Deutschland hatten, und der Entwicklung der Rechtsprechung hin zu einer stärkeren Unterstützung der Gründungstheorie.
2 Gründungsphase einer Gesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit den Aspekten der Gründungsphase beider Gesellschaftsformen, einschließlich Startkapital, Mindesteinlage, Vermögensbindung, Kapitalaufbringung, notarieller Beurkundung und der Eintragung im Handelsregister. Es analysiert die Unterschiede in den Anforderungen und Verfahren, die für die Gründung einer GmbH und einer Limited notwendig sind. Der Vergleich beleuchtet die jeweiligen rechtlichen und praktischen Implikationen für Gründer.
3 Organe: Dieses Kapitel vergleicht die Organstrukturen der GmbH und der Limited. Es beleuchtet die Unterschiede in der Zusammensetzung, den Befugnissen und der Verantwortung der jeweiligen Organe (z.B. Geschäftsführer/Vorstand, Aufsichtsrat). Der Fokus liegt auf den rechtlichen Regelungen und den daraus resultierenden Konsequenzen für die Entscheidungsfindung und die Unternehmensführung in beiden Gesellschaftsformen. Die Analyse berücksichtigt die jeweiligen Anforderungen an Transparenz und Rechenschaftspflicht.
4 Sitz der Gesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Sitzes der Gesellschaft und seinen rechtlichen Implikationen für GmbH und Limited. Es analysiert die Auswirkungen der Wahl des Sitzes auf das anwendbare Recht und die Beziehungen zu anderen Jurisdiktionen innerhalb der EU. Die Diskussion beleuchtet die Relevanz der Sitztheorie und der Gründungstheorie in diesem Kontext, sowie die Rolle des EuGH in der Entwicklung der Rechtsprechung.
5 Buchführungspflicht: Dieses Kapitel beschreibt und vergleicht die Buchführungspflichten für GmbH und Limited. Es analysiert die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben, die Anforderungen an die Buchführung und die damit verbundenen Meldepflichten. Der Vergleich umfasst die Unterschiede in den Umfang und der Komplexität der Buchführung und die potenziellen Auswirkungen auf die administrative Belastung der Unternehmen.
6 Haftung: Dieses Kapitel vergleicht die Haftungsregelungen für GmbH und Limited. Es untersucht die Unterschiede in der Haftung der Gesellschafter und der Organe und beleuchtet die Folgen für die persönliche Vermögenshaftung. Die Analyse berücksichtigt potenzielle Risiken und Schutzmechanismen für die Gesellschafter und die Bedeutung der Haftungsbeschränkungen für die Attraktivität der jeweiligen Gesellschaftsform.
7 Mitbestimmung: Dieses Kapitel behandelt das Thema der Mitbestimmung in GmbH und Limited. Es analysiert die gesetzlichen Regelungen zur Beteiligung von Arbeitnehmern an der Unternehmensführung und den Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Der Vergleich umfasst Unterschiede in den Mitbestimmungsmodellen und die Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur und das Arbeitsverhältnis.
Schlüsselwörter
GmbH, Limited, Gesellschaftsrecht, Gründung, Haftung, Organe, Sitztheorie, Gründungstheorie, Niederlassungsfreiheit, EU-Recht, Buchführung, Mitbestimmung, Kapitalaufbringung, Vermögensbindung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: GmbH vs. Limited
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit vergleicht die Vor- und Nachteile der GmbH und der Limited, zwei gängige Gesellschaftsformen in Europa. Sie untersucht die Gründungsphase, die Organe, den Sitz der Gesellschaft, die Buchführungspflicht, die Haftung und die Mitbestimmung in beiden Gesellschaftsformen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die rechtlichen und organisatorischen Unterschiede zu liefern.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Gründung und Kapitalaufbringung von GmbH und Limited, Unterschiede in der Organisationsstruktur und den Organen, Vergleich der Haftungsregelungen, Rechte und Pflichten der Gesellschafter, Sitz der Gesellschaft und rechtliche Implikationen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur Gründungsphase, den Organen, dem Sitz der Gesellschaft, der Buchführungspflicht, der Haftung und der Mitbestimmung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte für sowohl GmbH als auch Limited und schließt mit einem Fazit ab.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema der Niederlassungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union ein und betont die Bedeutung der Wahlfreiheit der Gesellschaftsform. Sie skizziert die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und die bestehenden Rechtsauffassungen bezüglich der Gründungstheorie und der Sitztheorie in Bezug auf die Anerkennung ausländischer Gesellschaften. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die ausländische Gesellschaftsformen vor den EuGH-Urteilen in Deutschland hatten, und der Entwicklung der Rechtsprechung hin zu einer stärkeren Unterstützung der Gründungstheorie.
Welche Aspekte der Gründungsphase werden verglichen?
Das Kapitel zur Gründungsphase befasst sich mit Startkapital, Mindesteinlage, Vermögensbindung, Kapitalaufbringung, notarieller Beurkundung und der Eintragung im Handelsregister für beide Gesellschaftsformen. Es analysiert die Unterschiede in den Anforderungen und Verfahren und deren rechtlichen und praktischen Implikationen.
Wie werden die Organe der GmbH und der Limited verglichen?
Das Kapitel zu den Organen vergleicht die Organisationsstrukturen, die Zusammensetzung, die Befugnisse und die Verantwortung der jeweiligen Organe (z.B. Geschäftsführer/Vorstand, Aufsichtsrat). Der Fokus liegt auf den rechtlichen Regelungen und deren Konsequenzen für die Entscheidungsfindung und Unternehmensführung. Die Anforderungen an Transparenz und Rechenschaftspflicht werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Bedeutung hat der Sitz der Gesellschaft?
Das Kapitel zum Sitz der Gesellschaft analysiert die rechtlichen Implikationen der Sitzwahl für GmbH und Limited, die Auswirkungen auf das anwendbare Recht und die Beziehungen zu anderen Jurisdiktionen innerhalb der EU. Die Relevanz der Sitztheorie und der Gründungstheorie sowie die Rolle des EuGH werden beleuchtet.
Welche Unterschiede gibt es in der Buchführungspflicht?
Das Kapitel zur Buchführungspflicht beschreibt und vergleicht die gesetzlichen Vorgaben, Anforderungen an die Buchführung und die Meldepflichten für GmbH und Limited. Es umfasst den Umfang und die Komplexität der Buchführung und deren Auswirkungen auf die administrative Belastung.
Wie werden die Haftungsregelungen verglichen?
Das Kapitel zur Haftung vergleicht die Haftungsregelungen für Gesellschafter und Organe in GmbH und Limited, beleuchtet die Folgen für die persönliche Vermögenshaftung und berücksichtigt potenzielle Risiken und Schutzmechanismen. Die Bedeutung der Haftungsbeschränkungen für die Attraktivität der jeweiligen Gesellschaftsform wird ebenfalls analysiert.
Was wird zum Thema Mitbestimmung gesagt?
Das Kapitel zur Mitbestimmung behandelt die gesetzlichen Regelungen zur Beteiligung von Arbeitnehmern an der Unternehmensführung und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Es vergleicht die Mitbestimmungsmodelle und deren Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur und das Arbeitsverhältnis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: GmbH, Limited, Gesellschaftsrecht, Gründung, Haftung, Organe, Sitztheorie, Gründungstheorie, Niederlassungsfreiheit, EU-Recht, Buchführung, Mitbestimmung, Kapitalaufbringung, Vermögensbindung.
- Quote paper
- Malte Wilhelm (Author), Henning Steffens (Author), 2012, Vor- und Nachteile von „GmbH” und „Limited” im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270847