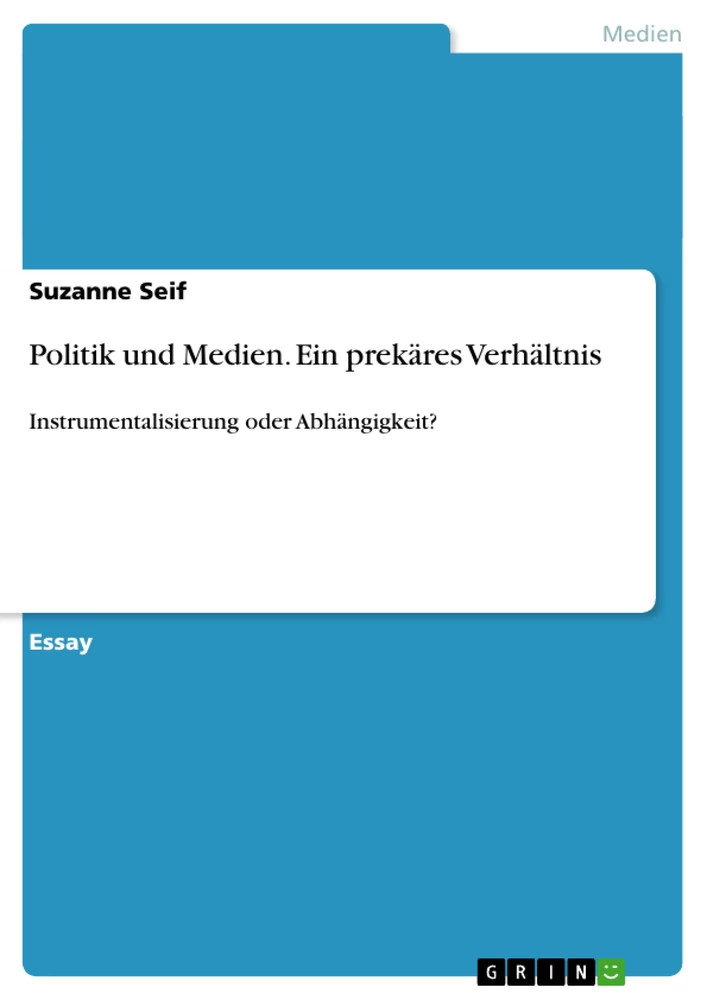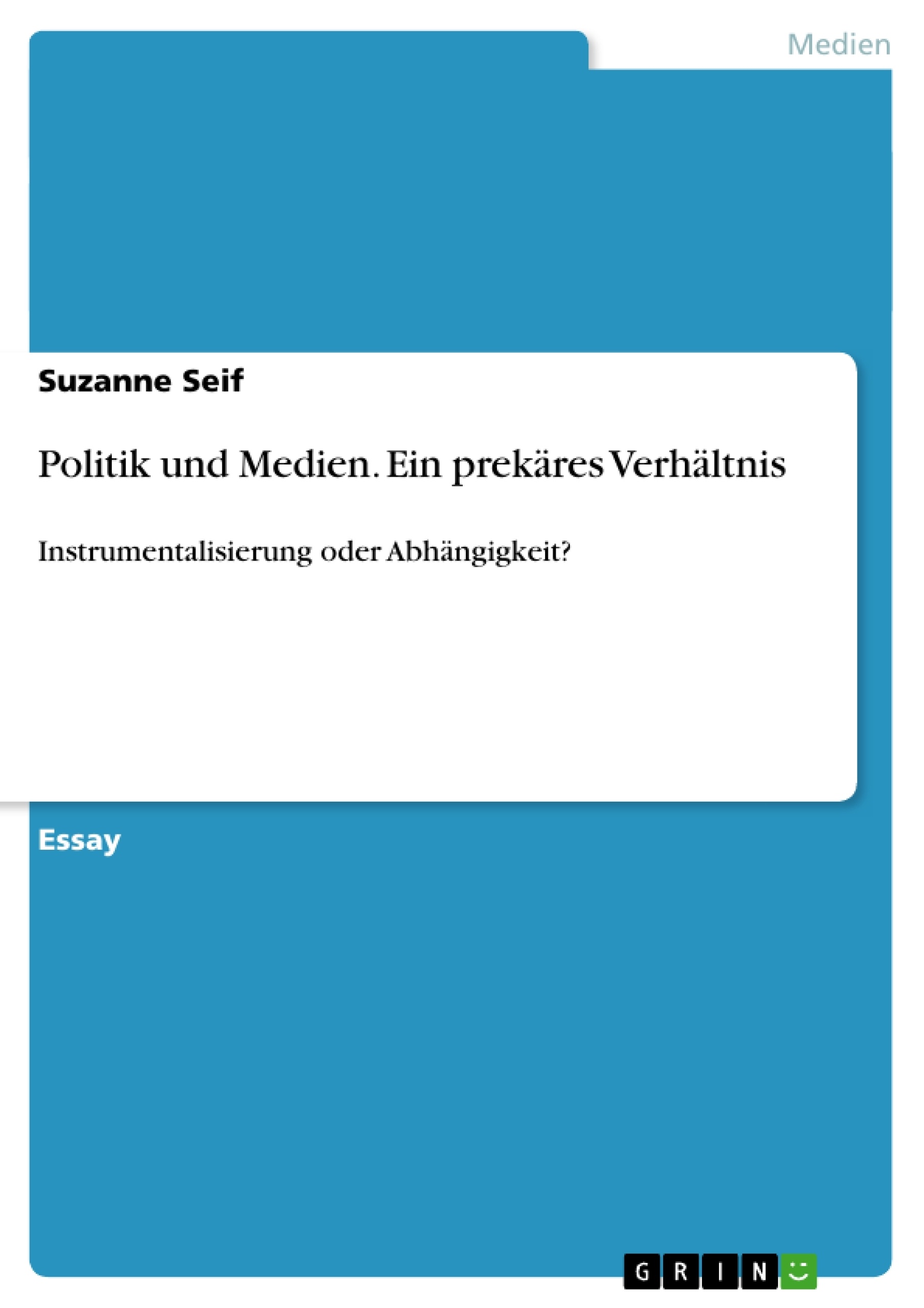Gegenwartsgesellschaften der westlichen Welt sind in den letzten Jahrzehnten einer zunehmenden funktionalen Differenzierung und Komplexität ausgesetzt, der sich nur schwer zu entziehen ist. Diese Prozesse haben Auswirkungen auf alle Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens. Innerhalb moderner Demokratien hat sich somit auch das Verhältnis zwischen Politik und Medien sukzessiv gewandelt. Politik ist seit jeher auf die Aufmerksamkeit von Medien angewiesen um mit der Wählerschaft in einen kommunikativen Austausch zu treten. Massenmedien erfüllen ihrerseits die essentiellste Funktion der öffentlichen Meinungsbildung für den demokratischen Prozess. Das Wirkungsgerüst von Politik und Medien hat sich jedoch dahingehend verändert, als dass es sich zusehends komplexer ausgestaltet. Durch dynamische Prozesse der Entpolitisierung sowie Popularisierung der Medienlandschaft gewannen Print, Rundfunk und Onlinemedien stärkeren Einfluss auf die Politik und daraus resultierend auf deren öffentlichen Wahrnehmung. In der politischen Kommunikationsforschung ist gegenwärtig von „Mediendemokratien“, einer „Mediatisierung der Politik“ und anderen Schlüsselbezeichnungen die Rede. All jene Begrifflichkeiten beziehen sich auf die mittlerweile verbreiteten These, einer zunehmenden Abhängigkeit der Politik und Parteien von massenmedialer Darstellung (Pfetsch/Perc 2004: 34). Doch lässt sich die Beziehung dieser beiden Teilsysteme wirklich so einseitig beschreiben? Genauso gut könnte postuliert werden, dass Politik die Medien instrumentalisiert. Oder besteht hier gar ein wechselseitiger Austausch beider Bereiche, der durch gesunden Ausgleich gekennzeichnet ist? Diesen Fragen werde ich mich im Folgenden widmen und diskutieren, ob und inwiefern Massenmedien Einfluss auf Politik und wiederum Politik Einfluss auf Massenmedien ausüben.
Essay
Politik und Medien – ein prekäres Verhältnis Instrumentalisierung oder Abhängigkeit?
Gegenwartsgesellschaften der westlichen Welt sind in den letzten Jahrzehnten einer zunehmenden funktionalen Differenzierung und Komplexität ausgesetzt, der sich nur schwer zu entziehen ist. Diese Prozesse haben Auswirkungen auf alle Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens. Innerhalb moderner Demokratien hat sich somit auch das Verhältnis zwischen Politik und Medien sukzessiv gewandelt. Politik ist seit jeher auf die Aufmerksamkeit von Medien angewiesen um mit der Wählerschaft in einen kommunikativen Austausch zu treten. Massenmedien erfüllen ihrerseits die essentiellste Funktion der öffentlichen Meinungsbildung für den demokratischen Prozess. Das Wirkungsgerüst von Politik und Medien hat sich jedoch dahingehend verändert, als dass es sich zusehends komplexer ausgestaltet. Durch dynamische Prozesse der Entpolitisierung sowie Popularisierung der Medienlandschaft gewannen Print, Rundfunk und Onlinemedien stärkeren Einfluss auf die Politik und daraus resultierend auf deren öffentlichen Wahrnehmung. In der politischen Kommunikationsforschung ist gegenwärtig von „Mediendemokratien“, einer „Mediatisierung der Politik“ und anderen Schlüsselbezeichnungen die Rede. All jene Begrifflichkeiten beziehen sich auf die mittlerweile verbreiteten These, einer zunehmenden Abhängigkeit der Politik und Parteien von massenmedialer Darstellung (Pfetsch/Perc 2004: 34). Doch lässt sich die Beziehung dieser beiden Teilsysteme wirklich so einseitig beschreiben? Genauso gut könnte postuliert werden, dass Politik die Medien instrumentalisiert. Oder besteht hier gar ein wechselseitiger Austausch beider Bereiche, der durch gesunden Ausgleich gekennzeichnet ist? Diesen Fragen werde ich mich im Folgenden widmen und diskutieren, ob und inwiefern Massenmedien Einfluss auf Politik und wiederum Politik Einfluss auf Massenmedien ausüben.
Um sich dieser Problematik nähern zu können, sollte ein kurzer Abriss des gesamtgesellschaftlichen Kontextes betrachtet werden. Die Medienlandschaft (Print, Rundfunk, Onlinemedien) der letzten Jahre hat sich enorm verändert. Zu den ursprünglich traditionellen öffentlich-rechtlichen parteinahen Rundfunksystemen und Zeitungen gesellten sich nach und nach unzählige private Rundfunk- und Fernsehanstalten. Damit einhergehend hat sich der öffentliche Mediensektor zu einer Wachstums- und Unterhaltungsbranche kommerzialisiert, in deren Fokus möglichst hohe Einschaltquoten stehen. Die Medienangebote haben sich vervielfacht, das Kommunikationstempo beschleunigt und neue Kommunikationstechnologien, wie das Internet, sind entstanden. Natürlich betreffen diese Wandlungen und Neuerungen auch dementsprechend den politischen Sektor. Es erweitern sich insbesondere die expliziten Handlungsoptionen und Maßnahmen der Politik, um in der politischen Öffentlichkeit – der Wählerschaft – Gehör zu finden und zu agieren.
Hierin spiegelt sich die bedeutsame Rolle der Medien wieder. In komplexer werdenden Grundvoraussetzungen für die Demokratie stellen sie die elementare Schnittstelle zwischen Bevölkerung und Politik dar. Durch die Massenmedien werden bereitgestellte Inhalte und Parteienprogramme der Politik in der Öffentlichkeit artikuliert (Kommunikation). Sie informieren die Bürger über die aktuelle politische Agenda. Die Medien entscheiden hierbei selbst, welchen Geschehnissen innerhalb öffentlicher Wahrnehmung Aufmerksamkeit zukommt und welchen nicht. Politik versucht dabei sowohl Vertrauen zwischen Partei und Bürger aufzubauen als sich auch in Form von verschiedenen Parteien im Wettbewerb zu behaupten. Andererseits wird hier für das Volk das Fundament zur politischen Teilhabe gewährleistet und Politik wiederum demokratisch legitimiert (Legitimierung). Politik muss primär Programme entwickeln, die die Bürger als wichtig und regelungsbedürftig empfinden (Responsivität).
In der Öffentlichkeit finden überwiegend ver öffentlichte Meinungen Gehör. Die Politik ist also stark auf diese kommunikative und artikulierende Leistung der Medien angewiesen. Diese dagegen kann die bereitgestellten politischen Inhalte kritisch hinterfragen und somit das politische Handeln kontrollieren (z.B. indem politische Missstände oder Skandale aufgedeckt werden). Denn: Veröffentlichtes findet nicht nur Gehör, sondern übt gleichzeitig einen gewissen Handlungsdruck auf die Politik aus. Je nachdem, wie und welche politischen Sachverhalte durch die Medien dargestellt werden, können sie die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen und politische Brisanz erzeugen (Agenda-Setting). Sie prägen den Deutungs- und Interpretationsrahmen eines berichteten Sachverhaltes (Framing-Effekte) als auch die Bewertungsmaßstäbe der Politik, durch den direkten Kontext der Berichterstattung (Priming-Effekte) (Pfetsch/Perc 2004: 38f.).
Diese konstruierte Medienrealität fungiert entsprechend der sogenannten Nachrichtenwerte, die entscheiden, ob und wie ein Thema veröffentlicht wird, oder nicht. Nachrichtenfaktoren sind Status und Prominenz der Akteure, räumliche und kulturelle Nähe des Ereignisses, sowie Konflikt-, Schaden- und Überraschungsansprüche spielen hier eine einschlägige Rolle (Pfetsch/Perc 2004: 40). Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Massenmedien an dieser Stelle partiell ein gewisses Eigeninteresse bei der Auswahl der Themen und der Dramatisierung, unterstellt wird. Auch sie müssen sich in der kommerziellen Medienlandschaft, bestehend aus mittlerweile unzähligen Formaten und Angeboten, behaupten. Gleichzeitig versuchen sie, mehr oder minder stark, ihre eigenen Positionen in die Berichterstattung mit einfließen zulassen. An dieser Stelle muss jedoch immer differenziert werden zwischen den unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedienungen privat-kommerzieller und öffentlich-rechtlicher Medien. Da letztere sich primär durch Gebühren finanzieren, sind sie weniger abhängig von Einschaltquoten. Hingegen sind sie festgelegt auf spezifische Programmaufträge und Ausgewogenheit ihrer Formate. Quote und unbedingte Publikumsattraktivität sind hingegen die wichtigen Eckpfeiler, nach denen sich die Berichterstattung kommerzieller Sender richtet. Es werden Ereignisse so ausgewählt und durch Dramatisierungs- und Spannungsmomente präsentiert und inszeniert, dass sie möglichst genau den Publikumsgeschmack treffen. Dessen ungeachtet, haben jedoch alle Medien bestimmte organisations-strukturelle Rahmenbedingungen gemein: einen stetigen Zeitdruck mit kurzem Zeithorizont bei der Produktion von Informationen, Aktualitäts- und Neuigkeitswerte. Kontextbedingungen, wie Redaktionsschluss, Seitenumfang und Sendezeit bestimmen bei allen Medienanbietern, die Themenwahl und -Aufmachung.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Mediatisierung der Politik"?
Es beschreibt die zunehmende Abhängigkeit der Politik von den Logiken und Darstellungsformen der Massenmedien.
Wie beeinflussen Medien die öffentliche Meinung durch "Framing"?
Framing bedeutet, dass Medien einen Deutungsrahmen vorgeben, der bestimmt, wie ein Sachverhalt vom Publikum wahrgenommen und bewertet wird.
Welche Rolle spielt das "Agenda-Setting"?
Medien entscheiden durch ihre Themenwahl, welche Probleme von der Gesellschaft als wichtig erachtet werden und erzeugen so Handlungsdruck auf die Politik.
Was unterscheidet öffentlich-rechtliche von privaten Medien in der Politikberichterstattung?
Öffentlich-rechtliche Medien sind weniger quotenabhängig und stärker dem Gemeinwohl verpflichtet, während private Medien stärker auf Dramatisierung und Unterhaltung setzen.
Instrumentalisiert die Politik die Medien oder umgekehrt?
Die Arbeit diskutiert ein prekäres Wechselverhältnis, in dem beide Seiten versuchen, Einfluss auszuüben, während sie gleichzeitig voneinander abhängig sind.
- Quote paper
- Suzanne Seif (Author), 2013, Politik und Medien. Ein prekäres Verhältnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270873