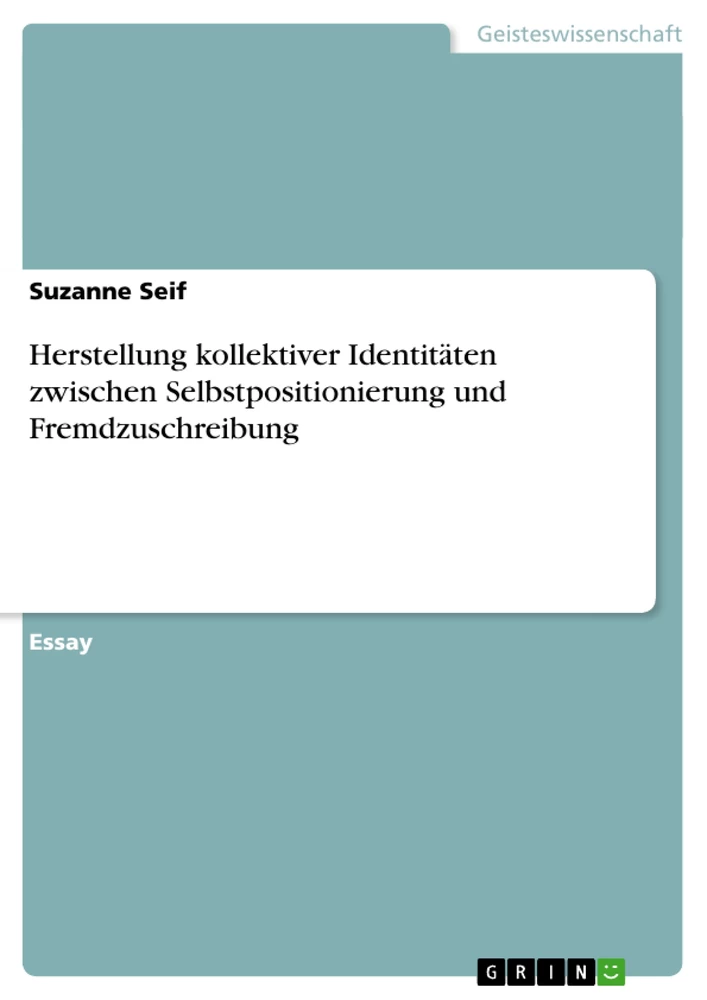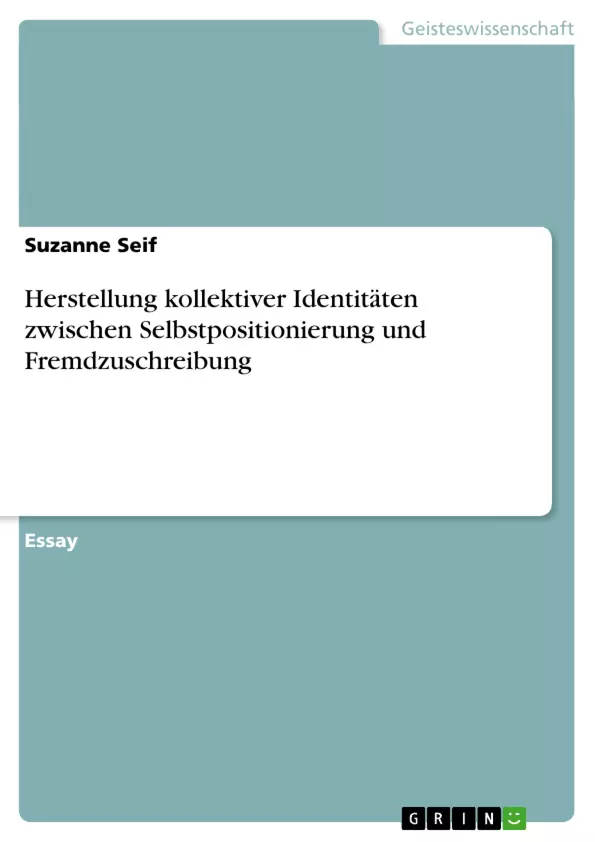„Döner-Morde“ ist das Unwort des Jahres 2011.(http://www.sueddeutsche.de) Kein anderer Begriff sorgte im letzten Jahr und darüber hinaus für so große Kontroversen. Er meint nicht nur den vorsätzlichen Tod mehrerer Menschen. Vielmehr spiegelt sich in diesem Wort die beständige Diffamierung türkischstämmiger Bürger in Deutschland und die Stigmatisierung dieser nach Stereotypen wider. Zudem ruft er erneut zu einer verstärkten Integration von Migranten in Deutschland auf und fordert mehr Toleranz gegenüber deren Kultur. Daher ist zentraler Punkt dieses Papers die Frage danach, inwieweit die bundesdeutsche Gesellschaft weiterhin durch Fremdzuschreibungen eine eigentlich integrierte Gruppe, die der türkischen Ausländer, immer noch exkludiert. Exklusion wird hier verstanden, dass durch Stereotype die Mehrheit der türkischen Mitbürger bspw. nach wie vor unter eine homogene Gruppe der Muslime subsumiert wird. Wieso ist das so? Und wie können sich Migranten in diesem Wechselspiel aus Fremdzuschreibung und stereotyper Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft positionieren? Diese Fragen sollen im Folgenden diskutiert werden.
Essay
Herstellung kollektiver Identitäten zwischen Selbstpositionierung und Fremdzuschreibung
„Döner-Morde“ ist das Unwort des Jahres 2011.(http://www.sueddeutsche.de) Kein anderer Begriff sorgte im letzten Jahr und darüber hinaus für so große Kontroversen. Er meint nicht nur den vorsätzlichen Tod mehrerer Menschen. Vielmehr spiegelt sich in diesem Wort die beständige Diffamierung türkischstämmiger Bürger in Deutschland und die Stigmatisierung dieser nach Stereotypen wider. Zudem ruft er erneut zu einer verstärkten Integration von Migranten in Deutschland auf und fordert mehr Toleranz gegenüber deren Kultur. Daher ist zentraler Punkt dieses Papers die Frage danach, inwieweit die bundesdeutsche Gesellschaft weiterhin durch Fremdzuschreibungen eine eigentlich integrierte Gruppe, die der türkischen Ausländer, immer noch exkludiert. Exklusion wird hier verstanden, dass durch Stereotype die Mehrheit der türkischen Mitbürger bspw. nach wie vor unter eine homogene Gruppe der Muslime subsumiert wird. Wieso ist das so? Und wie können sich Migranten in diesem Wechselspiel aus Fremdzuschreibung und stereotyper Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft positionieren? Diese Fragen sollen im Folgenden diskutiert werden.
In der Konstruktion des Fremden ist der Staat der Mehrheitsgesellschaft die erste legitimierte Instanz. Wer Ausländer oder Einheimischer ist, wird durch sie bestimmt und statistisch festgehalten. Auf dieser ersten, juristischen Ebene findet eine staatliche Konstruktion des Fremden statt. Es wird entlang von Herkunft hierarchisiert, klassifiziert und differenziert. Gleichzeitig aber wird zur Integration aufgerufen. Diese Prozess erschafft eine Minderheit, die es einzugliedern gilt, welches jedoch selbst nach etlichen Integrationsdebatten und -gipfeln weiterhin als Problem deklariert wird. Erst durch diese Ethnisierung der Migranten wird für die Mehrheitsgesellschaft ein 'Problem' konstruiert. Zudem unterstreichen z.B. Aussagen der Bundeskanzlerin: „Der Ansatz für Mulitkulti ist gescheitert, absolut gescheitert.“(http://www.spiegel.de) den Widerspruch zwischen Forderung und Förderung zur Integration. Die Mehrheitsgesellschaft zementieren meiner Meinung nach ein Problem, dass unter dem Schlagwort „Kulturkonflikt“ wiedergefunden werden kann. Denn dieser Begriff besiegelt auf politischer Ebene die Differenzierung zwischen und die Homogenität der Kollektiven einer Kultur.
Wie ist das zu verstehen? Bei der Betrachtung der Fremdzuschreibung und Selbstpositionierung von Einwanderern ist der Kulturbegriff (vor allem die Religionszugehörigkeit) essentiell. Migranten bringen, wie Regina Römhild treffend beschreibt, „kulturelles Gepäck“ (2007: 163) aus ihrem Herkunftsland mit, welches seine Identität als auch seine Fremdheit zur Aufnahmegesellschaft ausmacht. Vor allem die Religion ist ein entscheidendes Charakteristikum, sowohl bei der Exklusion von Migranten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, als auch bei der Subsumierung der türkischstämmigen Migranten als 'muslimische Einheit'. Bezeichnend ist hierfür das Zitat von Lala Akgün in einem Interview mit Riem Spielhaus:“ Man wird zum Muslim durch die bundesdeutsche Gesellschaft gemacht: (...)„Ich bin überzeugte Muslimin. Wissen Sie, das ist so wie mit den andorranischen Juden. Sie werden immer mehr zum Juden gemacht und ich werde immer mehr zu Muslimin gemacht in dieser Gesellschaft.“ (Spielhaus 2011: 139) Der Prozess der Identifikation findet hierbei nicht von innen durch Selbstbeschreibung statt, sondern wird durch die Fremdzuschreibungen der Aufnahmegesellschaft von außen hergestellt. Es wird den türkischen Einwanderern keine andere Wahl geboten sich außerhalb 'der Gruppe der Muslime' zu positionieren - zumindest in deren Wahrnehmung.
Die Herstellung kollektiver Identitäten findet hierbei meiner Ansicht nach geschlossen von außen statt – durch die Aufnahmegesellschaft. Das heißt, dass durch die Exklusion der türkischen Einwanderer mithilfe von kulturellen Stereotypen, wie z.B. der Religion, dem Tragen eines Kopftuchs oder dem Glauben an eine patriarchalische Hierarchie, eine Gruppe von Individuen zusammengefasst wird, welche sich besonders durch Heterogenität auszeichnet.
Dennoch ist es mehr als nur die Ethnisierung „der Anderen“. Vielmehr ist es auch ein Prozess der Selbst-Ethnisierung, welche eine wesentliche Ressource des politischen Alltags darstellt. Was wären wir, wenn nicht Deutsche, Engländer oder Russen? Die Herstellung von Wir-Gruppen, Nationalität und damit die Abgrenzung zu Anderen ist somit keine „natürliche Folge des Migrationsprozesses“ (Römhild 2007:163), sondern Instrument zur Etablierung der Identitäten sowohl der Aufnahmegesellschaft als auch der der Einwanderer.
Trotzdem ist der Zwang zur Selbstpositionierung der Migranten stärker als ihn ein Einheimischer je erfahren wird. Amir-Moazami beschreibt eindeutig, wie türkische Frauen mit der „Andersartigkeit“ aufwachsen, gerade weil die Aufnahmegesellschaft dieser Abgrenzung bedarf, um sich selbst zu profilieren und zu behaupten. Hierbei ist es außerdem hinfällig, ob sie in Deutschland aufgewachsen sind oder nicht. Der Umgang mit dem Stigma des Anderen, fordert sie regelrecht auf sich in der Gesellschaft zu positionieren. Die interviewten Frauen zeigten hierbei klare Tendenzen sich dem 'Türkisch-Sein' in Form von Religiosität anzunähern (vgl. Amir -Moazami 2007:226f.). Dies deckt sich mit dem bereits oben erwähnten Zitat Lala Akgün. Ethnisierung erfolgt durch die Mehrheitsgesellschaft.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert die Arbeit am Begriff „Döner-Morde“?
Der Begriff wird als stigmatisierend und diffamierend kritisiert, da er eine ganze Bevölkerungsgruppe über Stereotype exkludiert und die Opfer entmenschlicht.
Wie findet Fremdzuschreibung bei türkischstämmigen Migranten statt?
Oft werden sie von der Mehrheitsgesellschaft pauschal als homogene Gruppe der „Muslime“ wahrgenommen, ungeachtet ihrer tatsächlichen individuellen Identität oder Religiosität.
Was bedeutet „Ethnisierung“ in diesem Zusammenhang?
Es ist der Prozess, bei dem soziale Probleme oder Gruppenmerkmale primär auf die kulturelle oder ethnische Herkunft zurückgeführt werden, um eine Abgrenzung zum „Wir“ zu schaffen.
Was ist der Unterschied zwischen Selbstpositionierung und Fremdzuschreibung?
Fremdzuschreibung ist die Etikettierung von außen durch die Gesellschaft; Selbstpositionierung ist der Versuch der Migranten, sich in diesem Spannungsfeld eine eigene Identität zu geben.
Warum ist der Kulturbegriff bei der Integration problematisch?
Die Arbeit argumentiert, dass Begriffe wie „Kulturkonflikt“ Differenzen zementieren und die Integration eher behindern, indem sie Homogenität unterstellen, wo Heterogenität herrscht.
- Citar trabajo
- Suzanne Seif (Autor), 2011, Herstellung kollektiver Identitäten zwischen Selbstpositionierung und Fremdzuschreibung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270874