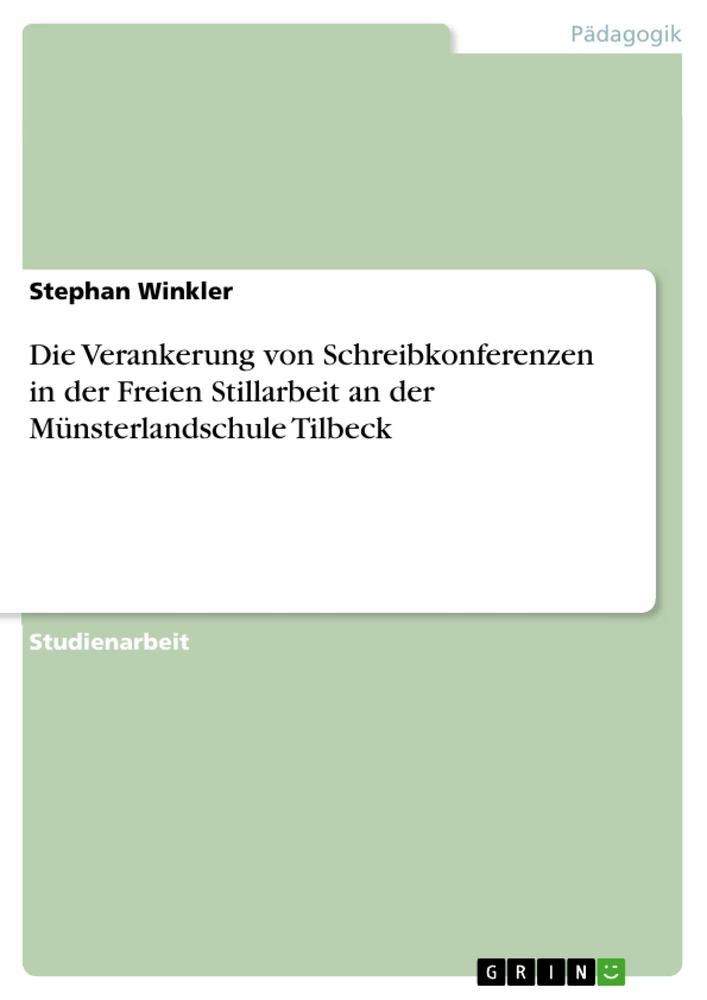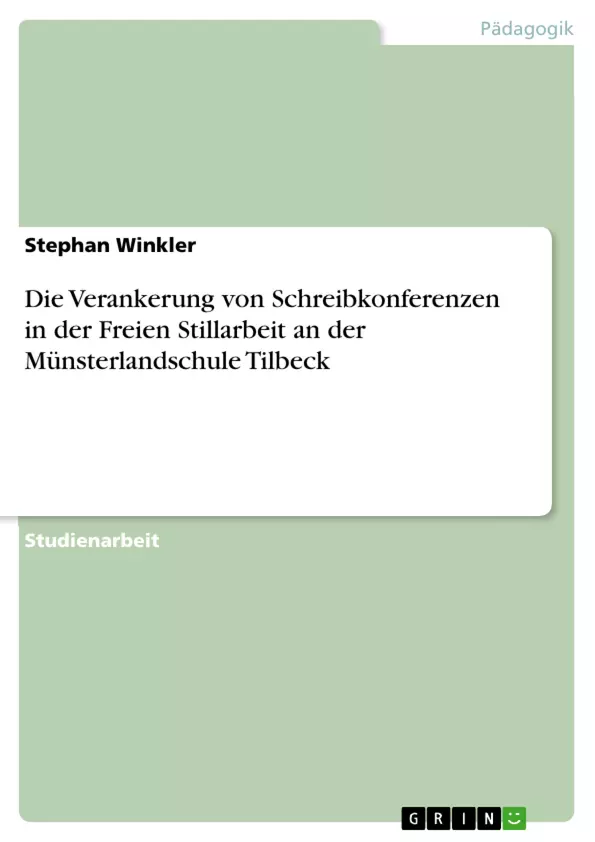„Ach ich will das jetzt nicht nochmal korrigieren, dann muss ich das ja noch einmal abschreiben.“ So oder ähnlich reagieren Kinder oft, wenn es darum geht die selbst verfassten Texte zu überarbeiten. Besonders wenn die Texte in irgendeiner Weise veröffentlicht werden sollen, kommt es zu solchen Situationen. Manche Kinder können es schwer einsehen, einen Text den sie mit Herzblut geschrieben haben, noch einmal zu überarbeiten und fehlerfrei abzuschreiben. Für viele stellt dies eine zu große Herausforderung dar. In dem überarbeiten und dem wiederholten Abschreiben sehen sie eine deutliche Mehrarbeit. Dies nimmt die Kinder meist so gefangen, dass sie die positiven Aspekte des Überarbeitens und der fehlerfreien Endfassung aus dem Blick verlieren. Für viele geht dadurch die Motivation verloren und sie überarbeiten die Geschichte nur unter Murren oder brechen die Geschichte ab. In seltenen Fällen kann es sogar dazu führen, dass die Kinder völlig die Lust daran verlieren eine Geschichte zu verfassen, da sie schon zu Beginn das Überarbeiten im Hinterkopf haben. Wie reagiert man auf Kinder, die solche Sätze äußern? Wie können die Kinder in der Phase des Überarbeitens unterstützt werden? Wie können im Bezug auf das Geschichtenschreiben demotivierte Kinder neu motiviert werden? Diese Fragen und noch einigen mehr begleiteten die Suche. Damit Kinder die Vorteile des Schreibens oder des Verfassens von Texten erkennen und nutzen können, müssen sie an hilfreiche Strategien des Schreibens herangeführt und zum Schreiben motiviert werden. Die Kinder müssen frühzeitig erkennen, dass das Schreiben und Verfassen von Texten ihnen ermöglicht sich auszudrücken und sich anderen mitzuteilen. Sind die Kinder zum Schreiben motiviert und erfahren sie hilfreiche Unterstützung, um auch selbstständig voranzukommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ihre Schreibfähigkeiten sukzessiv ausbauen können und letztendlich zu kompetenten Schreibern ausgebildet werden. Doch wie kann dies in der Schule erreicht werden? Eine Möglichkeit auf das eben genannte hinzuarbeiten, ist die Methode der Schreibkonferenzen. In dieser Arbeit wird ein Konzept entwickelt, um diese Methode im Schulalltag der Kinder zu verankern. Durch dieses Konzept soll sowohl die Schreibmotivation, als auch die Überarbeitungsmotivation erhöht und die Schreibkompetenz der Kinder verbessert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitende Bemerkungen
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- Abschnitt 2.1: Definitionen
- Abschnitt 2.2: Konzepte
- Kapitel 3: Empirische Untersuchung
- Kapitel 4: Diskussion der Ergebnisse
- Kapitel 5: Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, [hier die Ziele des Werkes einfügen, z.B.: ein komplexes Thema zu untersuchen, einen neuen Ansatz zu präsentieren, vorhandene Forschungsergebnisse zu synthetisieren]. Die Analyse basiert auf [hier die Methodik nennen, z.B.: qualitativen Interviews, quantitativen Daten, einer Literaturrecherche].
- Thema 1: [Hier ein zentrales Thema des Textes einfügen, ohne Spoiler]
- Thema 2: [Hier ein weiteres zentrales Thema des Textes einfügen, ohne Spoiler]
- Thema 3: [Hier ein drittes zentrales Thema des Textes einfügen, ohne Spoiler]
- Thema 4: [Hier ein viertes zentrales Thema des Textes einfügen, falls zutreffend, ohne Spoiler]
- Thema 5: [Hier ein fünftes zentrales Thema des Textes einfügen, falls zutreffend, ohne Spoiler]
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitende Bemerkungen: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die Forschungsfrage. Sie gibt einen Überblick über den Aufbau und die Methodik der Arbeit und benennt die wichtigsten theoretischen und methodischen Ansätze, die in den folgenden Kapiteln detailliert behandelt werden. Die Einleitung dient der Orientierung des Lesers und bereitet ihn auf die komplexen Themen der Arbeit vor. Sie betont die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Forschung und verweist auf die Lücken in der bestehenden Literatur, die diese Arbeit zu schließen versucht.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es präsentiert und diskutiert relevante Theorien und Modelle, die für das Verständnis des Forschungsthemas unerlässlich sind. Die ausgewählten Theorien werden kritisch beleuchtet und in ihren Stärken und Schwächen analysiert. Die einzelnen Abschnitte dieses Kapitels bauen aufeinander auf und schaffen ein kohärentes Verständnis des theoretischen Rahmens, der der empirischen Untersuchung zugrunde liegt. Es werden wichtige Begriffsdefinitionen eingeführt und die Verbindungen zwischen den verschiedenen theoretischen Ansätzen hergestellt.
Kapitel 3: Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte empirische Untersuchung. Es werden die Forschungsmethoden detailliert erläutert, die Stichprobenselektion beschrieben und die Datenerhebungsverfahren dargestellt. Die Vorgehensweise wird transparent und nachvollziehbar dargestellt, so dass der Leser die Ergebnisse kritisch beurteilen kann. Hier werden die konkreten Daten und Ergebnisse der Studie präsentiert, ohne bereits Interpretationen oder Schlussfolgerungen vorwegzunehmen. Das Kapitel ist so aufgebaut, dass die einzelnen Schritte der empirischen Untersuchung präzise nachvollzogen werden können.
Kapitel 4: Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel interpretiert die im vorherigen Kapitel präsentierten empirischen Ergebnisse im Lichte der in Kapitel 2 vorgestellten theoretischen Grundlagen. Es werden mögliche Erklärungen für die Ergebnisse gegeben und deren Bedeutung im Kontext der Forschungsfrage diskutiert. Die Ergebnisse werden mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen und abgewogen. Die Diskussion ist kritisch und reflektiert die Limitationen der eigenen Studie. Potentielle zukünftige Forschungsfragen werden aufgezeigt.
Kapitel 5: Ausblick: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten. Es werden offene Fragen und mögliche Weiterentwicklungen der Forschung thematisiert. Dabei werden auch die Grenzen der vorliegenden Arbeit und mögliche Einschränkungen der Ergebnisse reflektiert. Es wird eine Perspektive für zukünftige Forschungen gegeben, die auf den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit aufbaut und die Forschungslücke weiter verkleinert.
Schlüsselwörter
Hier die Schlüsselwörter einfügen: [z.B. Forschungsthema, wichtige Begriffe, Methoden, Theorien, Ergebnisse (allgemein formuliert, keine konkreten Ergebnisse)].
Häufig gestellte Fragen zu dieser wissenschaftlichen Arbeit
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit bietet einen umfassenden Überblick, inklusive Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Sie untersucht ein komplexes Thema (welches im Detail nicht spezifiziert ist) mittels einer bestimmten Methodik (ebenfalls nicht im Detail spezifiziert). Der Fokus liegt auf der systematischen Analyse und Darstellung der Ergebnisse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitende Bemerkungen) stellt das Thema und den Forschungsansatz vor. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) erläutert die relevanten Theorien und Modelle. Kapitel 3 (Empirische Untersuchung) beschreibt die Methodik und die Ergebnisse der empirischen Forschung. Kapitel 4 (Diskussion der Ergebnisse) interpretiert die Ergebnisse im Kontext der theoretischen Grundlagen. Kapitel 5 (Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Untersuchung eines komplexen Themas (genaue Spezifikation fehlt im gegebenen Text). Die Arbeit möchte möglicherweise einen neuen Ansatz präsentieren oder vorhandene Forschungsergebnisse synthetisieren. Die Methodik basiert auf (unbekannter Methode, da im gegebenen Text nicht näher spezifiziert).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt mehrere zentrale Themenschwerpunkte, die im gegebenen Text allerdings nicht explizit benannt werden. Es werden jedoch fünf Platzhalter für diese Themen bereitgestellt.
Wie sind die einzelnen Kapitel aufgebaut?
Jedes Kapitel hat einen klar definierten Fokus: Kapitel 1 dient der Einführung, Kapitel 2 der theoretischen Fundierung, Kapitel 3 der Darstellung der empirischen Ergebnisse, Kapitel 4 der Interpretation und Diskussion dieser Ergebnisse und Kapitel 5 der Zusammenfassung und des Ausblicks auf zukünftige Forschung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind im Text als Platzhalter angegeben und müssen durch die relevanten Begriffe aus der eigentlichen Arbeit ersetzt werden. Sie sollten das Forschungsthema, wichtige Begriffe, Methoden, Theorien und die Ergebnisse (allgemein formuliert) umfassen.
Wo finde ich detailliertere Informationen zum Inhalt?
Detailliertere Informationen zum Inhalt der Arbeit können nur durch Einsicht in den vollständigen Text gewonnen werden. Der hier bereitgestellte HTML-Code dient lediglich als Strukturvorlage und enthält Platzhalter für die eigentlichen Inhalte.
- Arbeit zitieren
- Master of Education Stephan Winkler (Autor:in), 2012, Die Verankerung von Schreibkonferenzen in der Freien Stillarbeit an der Münsterlandschule Tilbeck, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270954