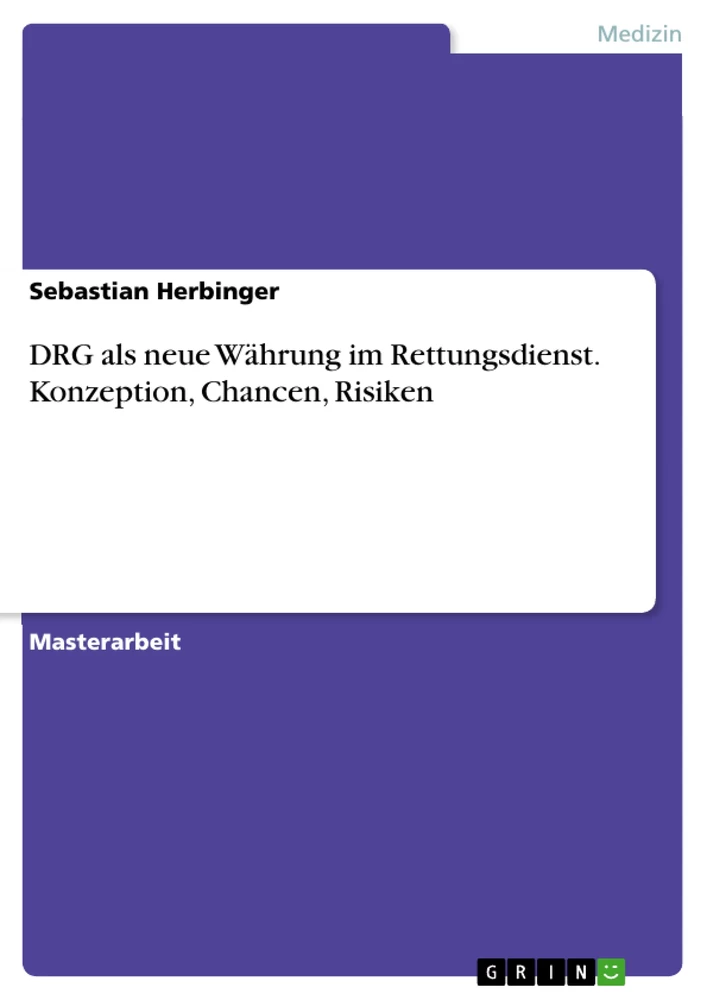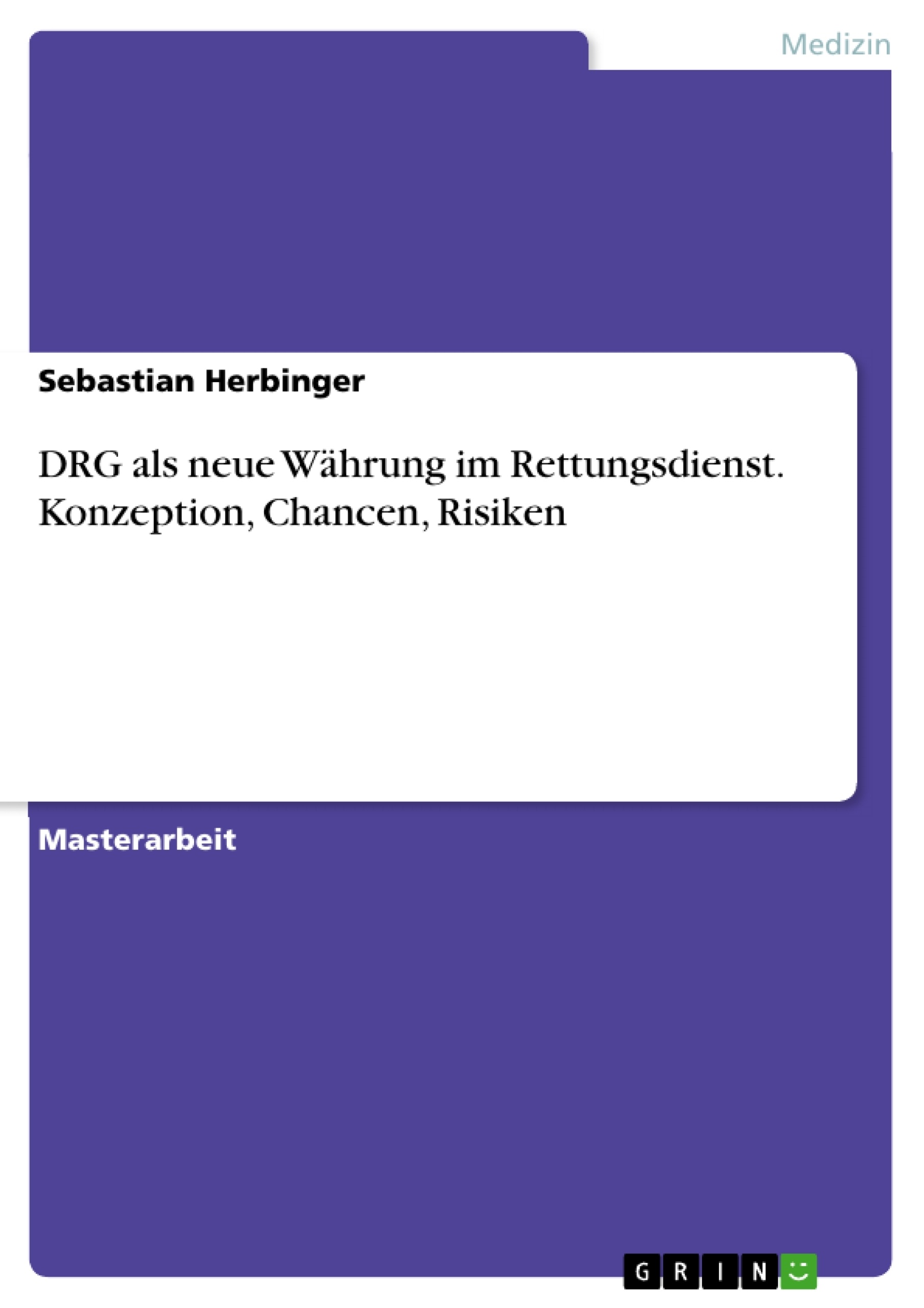Der bodengebundene Rettungsdienst in Deutschland, aber auch weltweit unterliegt seit einigen Jahren einem Wandel von der reinen Transportaufgabe hin zur medizinischen Versorgung und Behandlung von Notfallpatienten am Einsatzort. Galt es früher den Patienten so schnell wie möglich in eine geeignete Zielklinik zu transportieren, rückt heute die medizinische Versorgung immer mehr in den Mittelpunkt und nimmt einen entscheidenden Anteil im Einsatzgeschehen ein. Mit der Einführung des Notfallsanitäters / der Notfallsanitäterin zu Beginn des Jahres 2014 haben die Entscheidungsträger konsequenterweise auf diesen Aufgabenwandel in der präklinischen Notfallversorgung reagiert. Bisher erhalten die Rettungsdienstorganisationen lediglich eine Vergütung für den Transport, jedoch nicht für die medizinische Versorgung, Behandlung und Betreuung von Notfallpatienten.
Aus gesundheitspolitischer Betrachtung werden hierdurch falsche Anreize für die Rettungsdienstorganisationen gesetzt. Eine denkbare und potenzielle Abhilfe könnte die Einführung der sogenannten Rettungsdienst Diagnosis Related Group, kurz R-DRG sein. Die bereits in der stationären Versorgung etablierten German DRG bilden die ideale Grundlage für die R-DRG. So wird auch bei den R-DRG der individuelle ökonomische Aufwand am Patienten berücksichtigt. Ein großer Vorteil dieser Finanzierungsform ist, dass sie die Grundkosten und somit die Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes sicherstellt. Zusätzlich werden durch Belohnungs- bzw. Bestrafungssysteme neue Anreize für alle Beteiligten geschaffen. So erhalten Rettungsdienstorganisationen eine Bonuszahlung, wenn sie bzw. als Ausbildungsbetrieb agieren oder die gesetzlich definierte Hilfsfrist einhalten.
Trotz der starken landesrechtlichen Prägung des Rettungsdienstes könnte mit Hilfe der R-DRG eine bundesweite Finanzierung sichergestellt werden. Branchenspezifische Benchmarks, eine hohe Versorgungsqualität in der notfallmedizinischen Versorgung sowie neue Anreize zur effektiven Standortbestimmung von Rettungswachen gehören somit in die Zukunft des deutschen Rettungswesens.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Geschichte des Rettungsdienstes
- 2.1 Rettungsdienst heute
- 2.2 Finanzierungsstruktur im Rettungsdienst
- 2.2.1 Externe Finanzierung
- 2.2.2 Tariffinanzierung
- 2.2.3 Interne Finanzierung
- 2.2.4 Finanzierungsbeiträge Dritter
- 2.3 Kostenstruktur im Rettungsdienst
- 2.4 Kritische Betrachtung der Rettungsdienst- und Finanzstruktur
- 3. Pay for Performance
- 3.1 Begriffsdefinition
- 3.1.1 Kopfpauschale
- 3.1.2 Fallpauschale
- 3.1.3 Einzelleistungsvergütung
- 3.1.4 Erfolgsorientierte Vergütung
- 4. Konzeption der Rettungsdienst Diagnosis Related Group
- 4.1 Rettungsdienst Diagnosis Related Group
- 4.2 Patientenklassifikation
- 4.2.1 Glasgow Coma Scale
- 4.2.2 Vitalparameter
- 4.2.2.1 Atemfrequenz
- 4.2.2.2 Sauerstoffsättigung
- 4.2.2.3 Herzfrequenz
- 4.2.2.4 Blutdruck
- 4.2.2.5 EKG-Befund
- 4.2.2.6 Schmerzen
- 4.2.2.7 Körperkerntemperatur
- 4.2.2.8 Blutzucker
- 4.2.2.9 Körpergewicht
- 4.2.3 Interpretation der Patientenklassifikation
- 4.3 Haupt- und Nebendiagnosen nach ICD-10
- 4.4 Leistungserfassung mit OPS-Maßnahmenkatalog Rettungsdienst
- 4.5 Datenschutz und Hilfsfrist
- 4.5.1 Patientendatenschutz
- 4.5.2 Hilfsfrist
- 5. Kostenermittlung der Rettungsdienst DRG
- 5.1 Rettungsleitstellen
- 5.1.1 Rettungsfahrzeuge
- 5.1.2 Rettungsdienstpersonal
- 5.2 Buchführungssysteme
- 5.2.1 Inventur und Inventar
- 5.2.2 Bilanz
- 5.3 Doppelte Buchführung und Kosten- und Leistungsrechnung
- 5.3.1 Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
- 5.3.2 Kostenartenrechnung
- 5.3.3 Kostenartenrechnung im Rettungsdienst
- 5.3.3.1 Personalkosten
- 5.3.3.2 Kosten für Dienstleistungen Dritter
- 5.3.3.3 Materialkosten
- 5.3.3.4 Kapitalkosten
- 5.4 Kostenverteilung im Rettungsdienst
- 5.5 Abrechnungsverfahren mit den Rettungsdienst-DRG
- 6. Diskussion der Chancen und Risiken
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Einführung von Diagnosis Related Groups (DRG) im Rettungsdienst, genannt R-DRG, als neue Finanzierungsmethode. Ziel ist es, die Chancen und Risiken dieses Systems zu analysieren und dessen Konzeption zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Finanzierungsstruktur des Rettungsdienstes und deren Schwachstellen.
- Analyse der aktuellen Finanzierungsstruktur des Rettungsdienstes in Deutschland
- Bewertung der R-DRG als alternatives Finanzierungsmodell
- Untersuchung der Patientenklassifizierung im Rahmen der R-DRG
- Diskussion der Chancen und Risiken der R-DRG-Einführung
- Kostenermittlung im Kontext der R-DRG
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Masterarbeit ein, beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Es wird der Wandel im Rettungsdienst von der reinen Transportaufgabe hin zur medizinischen Versorgung beleuchtet und die Problematik der bisherigen, transportorientierten Vergütung aufgezeigt. Die Einführung der R-DRG als potenzielle Lösung wird vorgestellt.
2. Geschichte des Rettungsdienstes: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung des Rettungsdienstes und analysiert die aktuelle Finanzierungsstruktur mit ihren verschiedenen Komponenten (externe, tarifliche und interne Finanzierung sowie Beiträge Dritter). Es werden die Kostenstrukturen des Rettungsdienstes detailliert untersucht und die bestehenden Defizite der gegenwärtigen Finanzierungsmodelle kritisch bewertet. Der Fokus liegt auf der Aufdeckung von Ineffizienzen und dem Bedarf an einer reformierten Finanzierungsstruktur.
3. Pay for Performance: Dieses Kapitel definiert verschiedene Vergütungsmodelle im Gesundheitswesen wie Kopfpauschalen, Fallpauschalen, Einzelleistungsvergütungen und erfolgsorientierte Vergütungen. Es wird ein Vergleich der Modelle hinsichtlich ihrer Eignung für den Rettungsdienst durchgeführt, um den Kontext für die spätere Diskussion der R-DRG zu schaffen. Der Abschnitt dient der Begriffsklärung und der Einordnung der R-DRG in bestehende Systeme.
4. Konzeption der Rettungsdienst Diagnosis Related Group: Dieses Kapitel stellt die Konzeption der R-DRG detailliert vor. Es umfasst die Patientenklassifizierung anhand von Parametern wie der Glasgow Coma Scale und Vitaldaten, die Bestimmung von Haupt- und Nebendiagnosen nach ICD-10, die Leistungserfassung mit einem OPS-Maßnahmenkatalog und die Berücksichtigung von Datenschutz und Hilfsfrist. Das Kapitel legt den Schwerpunkt auf die methodische Umsetzung der R-DRG.
5. Kostenermittlung der Rettungsdienst DRG: Dieses Kapitel widmet sich der konkreten Kostenermittlung im Kontext der R-DRG. Es beinhaltet die Betrachtung der Kosten von Rettungsleitstellen, Rettungsfahrzeugen und Personal, die Analyse von Buchführungssystemen, die Anwendung der doppelten Buchführung und Kosten- und Leistungsrechnung. Es werden verschiedene Kostenarten detailliert aufgeführt und die Kostenverteilung im Rettungsdienst erläutert. Der Abschnitt zielt auf eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der Kostenkalkulation ab.
6. Diskussion der Chancen und Risiken: Dieses Kapitel analysiert die Chancen und Risiken der R-DRG-Einführung. Es werden die positiven Aspekte wie eine verbesserte Wirtschaftlichkeit, höhere Versorgungsqualität und neue Anreize für die Beteiligten erörtert. Gleichzeitig werden die potenziellen Probleme, wie der bürokratische Aufwand und die Gefahr von Fehlanreizen, kritisch diskutiert. Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Abwägung der Vor- und Nachteile des Systems.
Schlüsselwörter
Rettungsdienst, DRG, R-DRG, Finanzierung, Kostenstruktur, Patientenklassifizierung, Pay for Performance, ICD-10, OPS, Wirtschaftlichkeit, Hilfsfrist, Datenschutz, Gesundheitsökonomie, Notfallsanitäter
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Rettungsdienst Diagnosis Related Groups (R-DRG)
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Einführung von Diagnosis Related Groups (DRG) im Rettungsdienst, genannt R-DRG, als neue Finanzierungsmethode. Ziel ist die Analyse der Chancen und Risiken dieses Systems und die Bewertung seiner Konzeption.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die aktuelle Finanzierungsstruktur des Rettungsdienstes und deren Schwachstellen, die Bewertung der R-DRG als alternatives Finanzierungsmodell, die Patientenklassifizierung im Rahmen der R-DRG, die Chancen und Risiken der R-DRG-Einführung und die Kostenermittlung im Kontext der R-DRG.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Geschichte des Rettungsdienstes, Pay for Performance, Konzeption der R-DRG, Kostenermittlung der R-DRG, Diskussion der Chancen und Risiken und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird unter "Pay for Performance" verstanden?
Das Kapitel "Pay for Performance" definiert verschiedene Vergütungsmodelle im Gesundheitswesen, wie Kopfpauschalen, Fallpauschalen, Einzelleistungsvergütungen und erfolgsorientierte Vergütungen. Es vergleicht diese Modelle hinsichtlich ihrer Eignung für den Rettungsdienst.
Wie funktioniert die Patientenklassifizierung im Rahmen der R-DRG?
Die Patientenklassifizierung basiert auf Parametern wie der Glasgow Coma Scale und Vitaldaten (Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, Blutdruck, EKG-Befund, Schmerzen, Körperkerntemperatur, Blutzucker, Körpergewicht). Haupt- und Nebendiagnosen werden nach ICD-10 bestimmt.
Welche Kosten werden bei der Kostenermittlung der R-DRG berücksichtigt?
Die Kostenermittlung umfasst die Kosten von Rettungsleitstellen, Rettungsfahrzeugen und Personal. Es werden Buchführungssysteme, die doppelte Buchführung und Kosten- und Leistungsrechnung angewendet. Berücksichtigt werden Personalkosten, Kosten für Dienstleistungen Dritter, Materialkosten und Kapitalkosten.
Welche Chancen und Risiken birgt die Einführung der R-DRG?
Die R-DRG bieten Chancen wie verbesserte Wirtschaftlichkeit und höhere Versorgungsqualität. Risiken sind der bürokratische Aufwand und die Gefahr von Fehlanreizen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rettungsdienst, DRG, R-DRG, Finanzierung, Kostenstruktur, Patientenklassifizierung, Pay for Performance, ICD-10, OPS, Wirtschaftlichkeit, Hilfsfrist, Datenschutz, Gesundheitsökonomie, Notfallsanitäter.
Welche Finanzierungsstrukturen des Rettungsdienstes werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die externe, tarifliche und interne Finanzierung sowie Beiträge Dritter im Rettungsdienst und beleuchtet deren Defizite.
Wie wird die Kosten- und Leistungsrechnung im Rettungsdienst im Kontext der R-DRG dargestellt?
Die Arbeit beschreibt den Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung, die Kostenartenrechnung (Personalkosten, Kosten für Dienstleistungen Dritter, Materialkosten, Kapitalkosten) und die Kostenverteilung im Rettungsdienst.
- Citar trabajo
- Sebastian Herbinger (Autor), 2013, DRG als neue Währung im Rettungsdienst. Konzeption, Chancen, Risiken, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270969