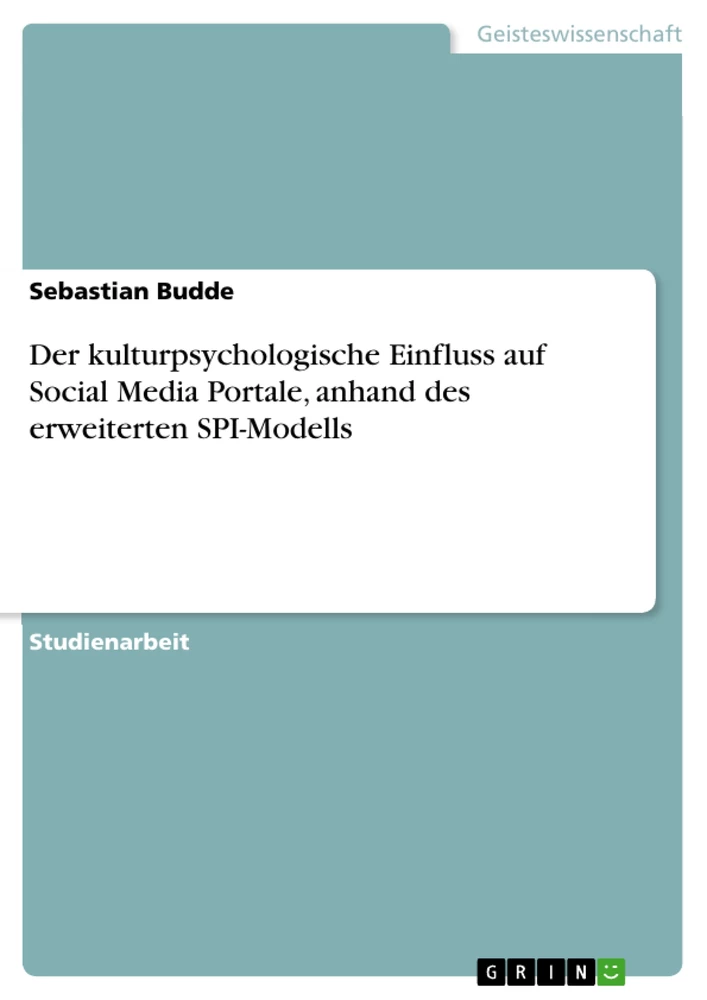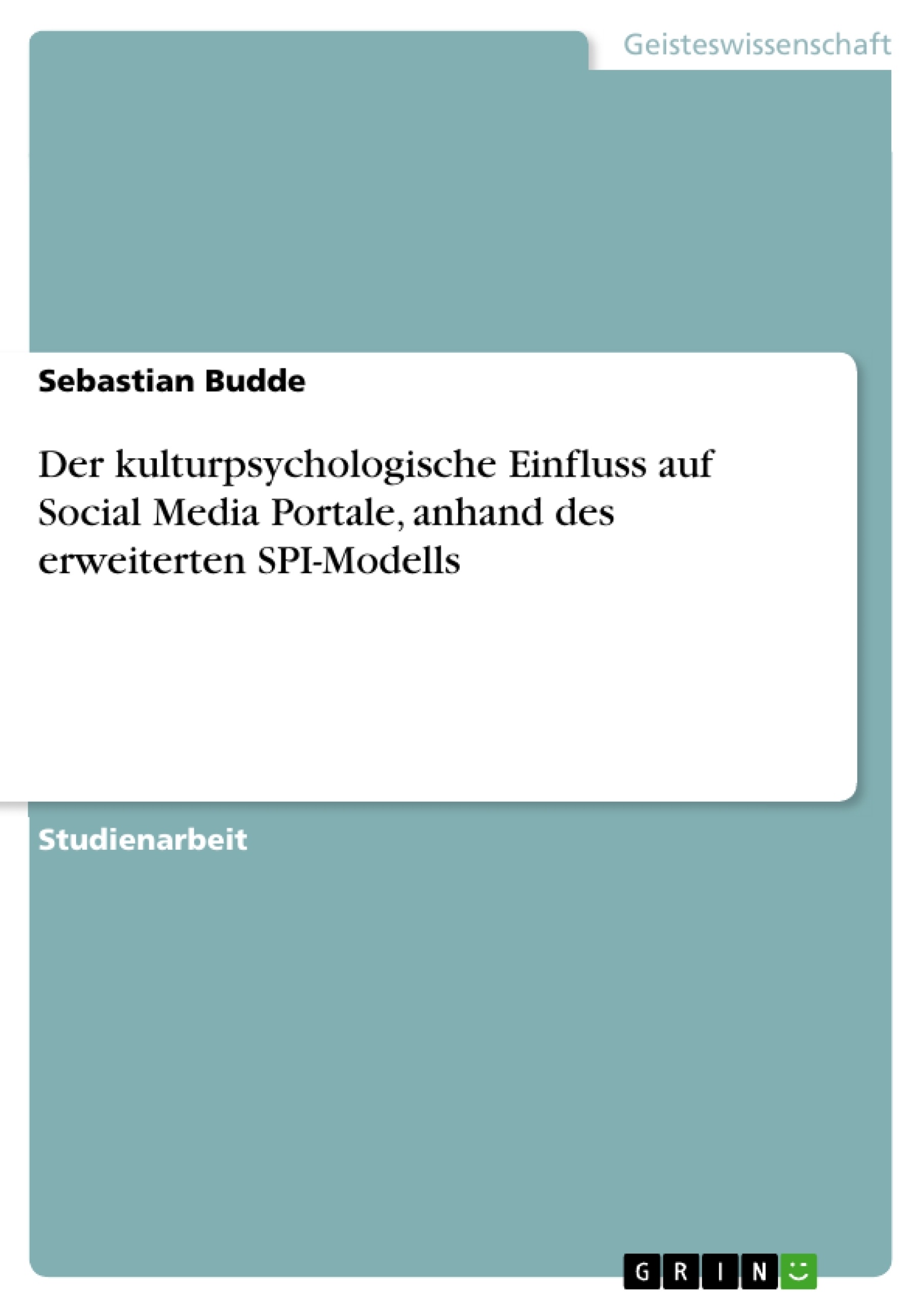In dieser Arbeit wurden Profilfotos von der Social Media Plattform Facebook genutzt, um einen kulturpsychologischen Einfluss anhand des erweiterten SPI-Modells, zu untersuchen.
Da nicht die Mittel zu eigenen Untersuchungen gegeben waren und es mit großer Wahrscheinlichkeit zu datenschutzrechtlichen Problemen kommen würde, wurde sich auf die Selbstdarstellungsbeschreibung ausgewählter Benutzerprofile beschränkt. Als Grundlage bilden sich hier ausgewählte Facebook Foto-Collagen von Irrgang/ Piatoni (2011).
Diese Profile wurden mit kulturpsychologischem Hintergrund analysiert, ehe am Ende ein Resultat erzielt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das SPI-Modell
2.1. Zugänglichkeit im SPI-Modell
2.2. Semantischer Mechanismus
2.3. Prozeduraler Mechanismus
3. Das erweiterte SPI-Modell
3.1. Erste Erweiterung
3.2. Zweite Erweiterung
4. Kultureller Einfluss
4.1. Westliche Kulturen
4.2. Östliche Kulturen
5. Zusammenfassung
5.1. Fazit
5.2. Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
- Quote paper
- Sebastian Budde (Author), 2013, Der kulturpsychologische Einfluss auf Social Media Portale, anhand des erweiterten SPI-Modells, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271018