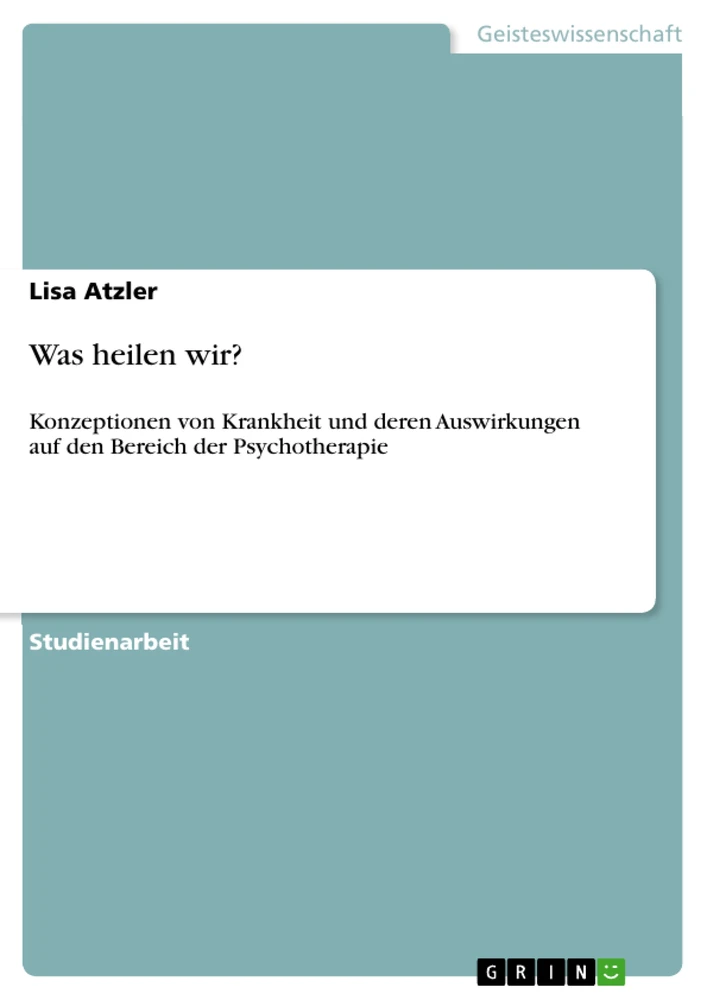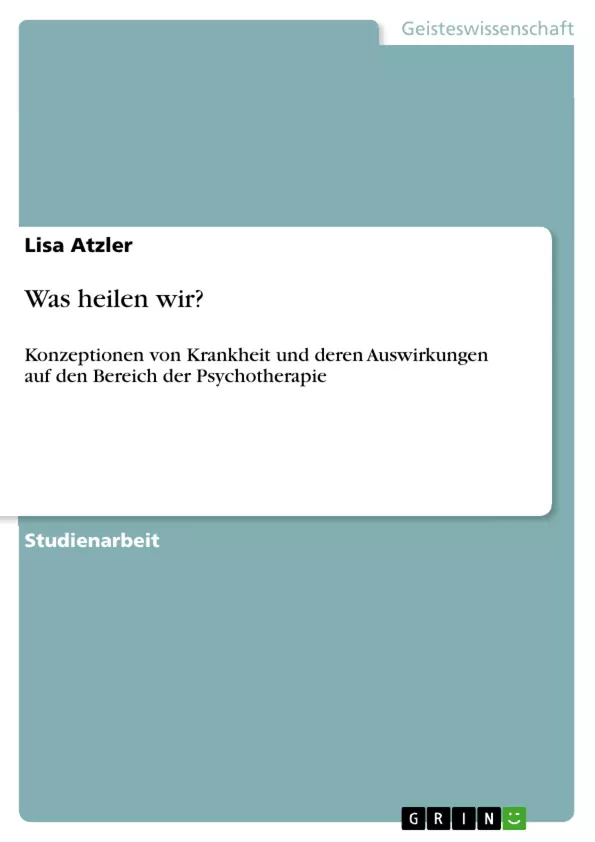Wenn ich mit einer Körpertemperatur von 41°C im Bett liege, ist es naheliegend diesen Zustand als ,krankʻ zu bezeichnen. Wenn meine Schilddrüse nachweislich zu wenig Hormon produziert, wird mir wahrscheinlich eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, die mich als ,krankʻ ausweist.
Sitz mir in der Bahn ein Mann gegenüber, der einen Dialog mit einem imaginären Gesprächspartner in seinen Bart nuschelt, denke ich wahrscheinlich etwas wie: „Der spinnt doch“ oder „der ist sicher psychisch krank“. Doch was, wenn ich weiß, dass dieser Mann ein erfolgreicher Autor ist, der seine fiktiven Briefromane zunächst verbal für sich artikulieren muss, um diese anschließend kunstvoll zu Papier bringen zu können? Denke ich dann anders über diesen Mann? Wenn ja, was macht diesen Sinneswandel aus? Welche Umstände lassen einen Menschen als Genie erscheinen, welche als Wahnsinnigen? Ab wann ist die Abweichung meines Cholesterinspiegels krankhaft – und wovon wird da abgewichen?
Inhaltsverzeichnis
- Rechtfertigung eines Begriffs: „krank“.
- Kranke Seele, kranke Psyche?….....
- Die biologische Norm
- Geisteskrankheit als Mythos
- ,wahnsinnig als Urteil
- Wie wird der Begriff heute verwendet?
- Vom Konzept zur Therapie..
- Der Krankheitsbegriff in der Psychopharmakotherapie.........
- Der Krankheitsbegriff in der Psychoanalyse.
- Der Krankheitsbegriff in der Verhaltenstherapie.….….………………….
- Das biopsychosoziale Modell von Gesundheit und Krankheit
- Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Krankheitsbegriff im Kontext der Psychotherapie und untersucht, wie verschiedene Konzeptionen von Krankheit die Praxis der Behandlung beeinflussen. Er stellt die Frage, wie der Begriff „krank“ gerechtfertigt werden kann und wie er sich in unterschiedlichen Bereichen der Psychotherapie (z. B. Psychopharmakotherapie, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie) manifestiert. Darüber hinaus wird das biopsychosoziale Modell von Gesundheit und Krankheit als umfassender Ansatz beleuchtet.
- Die Problematik des Krankheitsbegriffs und seine Ambivalenz
- Der Einfluss von sozialen Normen und gesellschaftlichen Werten auf den Krankheitsbegriff
- Die verschiedenen Konzeptionen von Krankheit in unterschiedlichen Therapieformen
- Das biopsychosoziale Modell als umfassendes Verständnis von Gesundheit und Krankheit
- Die Bedeutung des Krankheitsbegriffs für das Gesundheitswesen und die individuelle Lebensführung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel thematisiert die Komplexität des Krankheitsbegriffs und die Schwierigkeiten, ihn eindeutig zu definieren. Es wird anhand von Beispielen aus dem Alltag gezeigt, wie subjektive Wahrnehmungen und gesellschaftliche Normen unsere Beurteilung von Krankheit beeinflussen können. Weiterhin wird die historische Entwicklung des Krankheitsbegriffs beleuchtet, wobei die Abschaffung der Homosexualität als psychiatrische Diagnose als Schlüsselbeispiel für den Wandel gesellschaftlicher Wertvorstellungen und deren Auswirkungen auf den Krankheitsbegriff angeführt wird.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Unterscheidung zwischen körperlichen und geistigen Erkrankungen und den Herausforderungen, die sich aus der subjektiven Natur psychischer Phänomene ergeben. Es wird der Ansatz der somatischen Medizin erläutert, der auf der Annahme eines normativen Werts basiert und verschiedene Vergleichbarkeitskriterien für die Beurteilung von Gesundheit und Krankheit einführt. Im Kontext der psychiatrischen und psychotherapeutischen Praxis wird die Trennung zwischen somatischen und psychischen Erkrankungen diskutiert, wobei verschiedene methodische und historische Aspekte dieser Unterscheidung hervorgehoben werden.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der Anwendung des Krankheitsbegriffs in verschiedenen Therapieformen. Es werden die unterschiedlichen Konzeptionen von Krankheit in der Psychopharmakotherapie, der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie beleuchtet. Die jeweiligen Ansätze zur Definition von Krankheit und deren Auswirkungen auf die therapeutische Praxis werden hier näher betrachtet.
- Das vierte Kapitel stellt das biopsychosoziale Modell von Gesundheit und Krankheit vor. Dieses Modell integriert biologische, psychische und soziale Faktoren in ein umfassendes Verständnis von Krankheit. Es bietet einen Ansatz, der die Komplexität menschlichen Leidens berücksichtigt und eine ganzheitliche Betrachtungsweise von Gesundheit und Krankheit ermöglicht.
Schlüsselwörter
Krankheitsbegriff, Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, biopsychosoziales Modell, Gesundheit, Krankheit, Norm, gesellschaftliche Werte, soziale Normen, subjektive Wahrnehmung, objektive Messung, Diagnostik, Behandlung, Therapie.
Häufig gestellte Fragen
Wann gilt ein Mensch als „krank“?
Der Text zeigt, dass die Definition von „krank“ oft von subjektiven Wahrnehmungen, biologischen Normen und gesellschaftlichen Werten abhängt, statt nur von objektiven Messwerten.
Was ist der Unterschied zwischen körperlicher und psychischer Krankheit?
Während somatische Medizin oft auf festen Normwerten basiert, sind psychische Phänomene subjektiver Natur und hängen stärker von sozialen Urteilen ab (z.B. Genie vs. Wahnsinn).
Wie definiert die Psychoanalyse den Krankheitsbegriff?
Die Arbeit untersucht, wie Konzepte von Krankheit in der Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und Psychopharmakotherapie unterschiedlich angewandt werden.
Was ist das biopsychosoziale Modell?
Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der biologische, psychische und soziale Faktoren integriert, um Gesundheit und Krankheit umfassend zu verstehen.
Wie verändern sich Krankheitsdiagnosen über die Zeit?
Ein Beispiel ist die Homosexualität, die früher als psychiatrische Diagnose galt und heute aufgrund geänderter gesellschaftlicher Werte gestrichen wurde.
- Citar trabajo
- Lisa Atzler (Autor), 2013, Was heilen wir?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271107