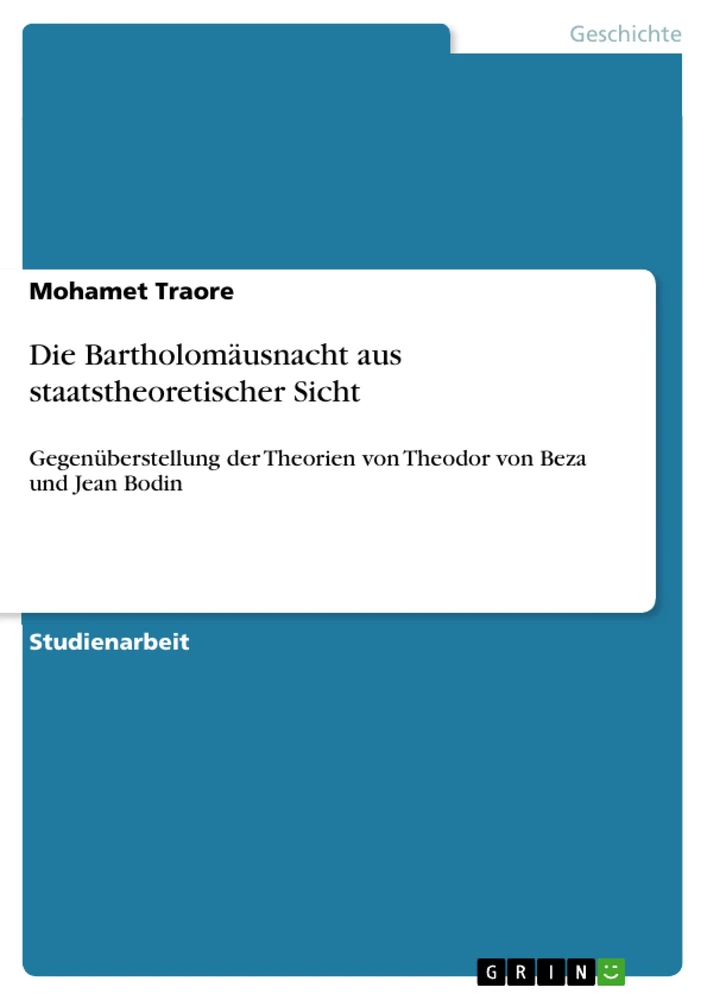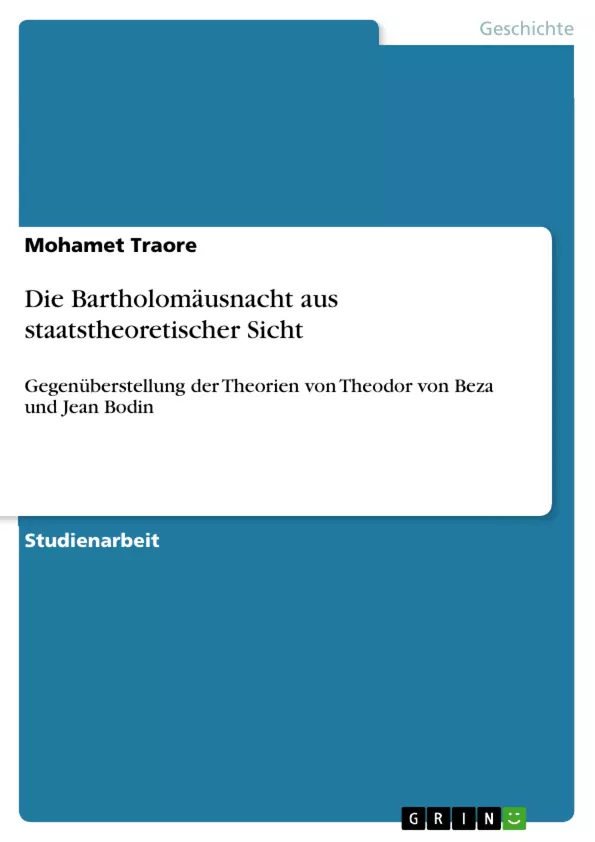Am 24. August 1572 ereignete sich in Paris ein Massaker, dem schätzungsweise 3000 Menschen, vorwiegend Hugenotten (französische Calvinisten) zum Opfer fielen. Angesicht der konfessionellen Unterschiede zwischen Täter und Opfer und des immensen menschlichen Leides der mit diesem Ereignis einherging, hatte die Bartholomäusnacht eine eminente Bedeutung nicht nur für die französische, sondern auch für die europäische Geschichte. Während Freuderufe im katholischen Lager laut wurden, ant-worteten die Calvinisten auf den Massaker mit einer Flut von politischen Schriften. Einige prominente Beispiele wären Hotmans Franco-Gallia (1573) und Le reveille-matin (1574) sowie Bezas Du droit des magistrats sur leur sujets (1574). Jean Bodin, einer der ersten bedeutenden französi-schen Staatstheoretiker, erwiderte deren Angriffe mit seinem Les six livres de la République zwei Jahre später.
Im 16. Jh. gab es noch keine Trennung von Politik und Religion; die offizielle Religion des Landes war gleichzeitig Staatsreligion. Häresie wurde rasch mit Rebellion gleichgesetzt. Und weil die Hugenotten trotz allem Untertanen des französischen Königs waren, bewegten sie sich stets in ei-nem gewissen Spannungsverhältnis zwischen Gewissensfreiheit und Staats-souveränität. Diese Arbeit ist also ein Beitrag zur Herrschaftsgeschichte des 16. Jh. am Beispiel von König Karls IX. Umgang mit seinen Hugenotten. Es geht um das Verhältnis zwischen den Herrschern und Beherrschten und insbesondere um das Widerstandsrecht der Letzteren. Kurzum um die politischen Lehren, die aus der Pariser Bluthochzeit gezogen worden sind. Ich habe dafür exemplarisch zwei Autoren gewählt, die Stellvertreter für die hugenottische Partei (Beza) und die Partei der „Politiques“ (Jean Bodin)stehen. Gibt es trotz der unterschiedlichen Schlussfolgerungen Ähnlichkeiten in der Argumentation unserer Staatstheoretikern? Widerspiegelt sich ihre eigene religiöse Vorstellungen in ihrem politischen Schriften? Auf diesen und weiteren Fragen werde ich in zwei Kapitel eingehen, wobei die Autoren und dann deren Werke in Mittelpunkt der Betrachtung stehen und vergleichend analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Autoren und ihr Umfeld
- Lebensweg und Persönlichkeit
- Verbindung zu den Hugenottenkriegen
- Die Werke
- Entstehungsgeschichte
- Inhalt
- Schlusswort
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bartholomäusnacht (B.) vom 24. August 1572 aus staatstheoretischer Perspektive. Sie befasst sich mit dem Widerstandsrecht der Hugenotten, den französischen Calvinisten, im Kontext der Konflikte zwischen Gewissensfreiheit und Staatssouveränität im 16. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert die politischen Lehren, die aus dem Massaker gezogen wurden, am Beispiel des Umgangs von König Karl IX. mit seinen Hugenotten.
- Das Verhältnis zwischen Herrschern und Beherrschten im 16. Jahrhundert
- Die Rolle der Religion im politischen Diskurs
- Die Argumentation von Staatstheoretikern zur Bartholomäusnacht
- Das Widerstandsrecht und die Grenzen der Staatssouveränität
- Die Bedeutung der Bartholomäusnacht für die französische und europäische Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit widmet sich zunächst den Autoren, die den Kontext der Bartholomäusnacht aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Es werden die Lebenswege und Persönlichkeiten von Théodore Beza, einem wichtigen Reformator des Calvinismus, und Jean Bodin, einem der ersten bedeutenden französischen Staatstheoretiker, vorgestellt. Die Analyse fokussiert auf die jeweiligen Beziehungen der Autoren zu den Hugenottenkriegen und auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Lebensläufe und Bildungsgänge. Im weiteren Verlauf werden die Werke der Autoren in Bezug auf ihre Argumentation und ihre politische Bedeutung analysiert. Es werden die Entstehungshintergründe und die zentralen Inhalte der Schriften von Beza und Bodin beleuchtet, die sich kritisch mit der Bartholomäusnacht auseinandersetzen. Die Arbeit vergleicht die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren auf das Widerstandsrecht und die Rolle des Staates.
Schlüsselwörter
Bartholomäusnacht, Hugenottenkriege, Widerstandsrecht, Staatssouveränität, Gewissensfreiheit, Staatstheorie, Jean Bodin, Théodore Beza, Monarchomachen, 16. Jahrhundert, Frankreich, Religion, Politik
Häufig gestellte Fragen
Was geschah in der Bartholomäusnacht 1572?
In der Nacht zum 24. August 1572 ereignete sich in Paris ein Massaker an schätzungsweise 3000 Hugenotten (französischen Calvinisten), das weitreichende Folgen für die europäische Geschichte hatte.
Wer waren die Hugenotten?
Hugenotten waren die Anhänger des Calvinismus in Frankreich, die im 16. Jahrhundert in religiöse und politische Konflikte mit der katholischen Staatsmacht gerieten.
Welche staatstheoretischen Lehren wurden aus dem Massaker gezogen?
Das Ereignis löste eine Flut politischer Schriften aus, die sich mit dem Widerstandsrecht der Untertanen gegenüber tyrannischen Herrschern befassten.
Wer war Jean Bodin und was war seine Position?
Jean Bodin war ein bedeutender Staatstheoretiker, der in seinem Werk „Les six livres de la République“ die absolute Souveränität des Staates zur Friedenssicherung betonte.
Was forderte Théodore Beza in seinen Schriften?
Beza, ein Vertreter der Hugenotten, argumentierte für ein Recht der Magistrate, Widerstand gegen Herrscher zu leisten, wenn diese die Religionsfreiheit verletzten.
Gab es im 16. Jahrhundert eine Trennung von Religion und Politik?
Nein, Politik und Religion waren untrennbar verbunden; die Staatsreligion galt als verbindlich, und religiöse Abweichung wurde oft als politische Rebellion gewertet.
- Citation du texte
- B.A. Mohamet Traore (Auteur), 2011, Die Bartholomäusnacht aus staatstheoretischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271139