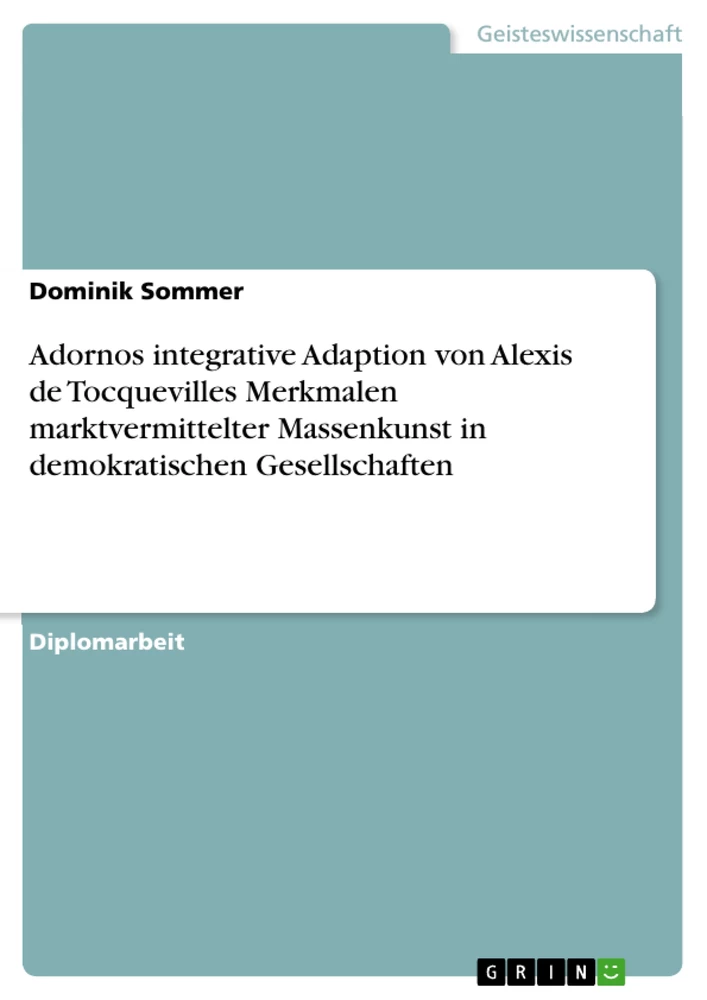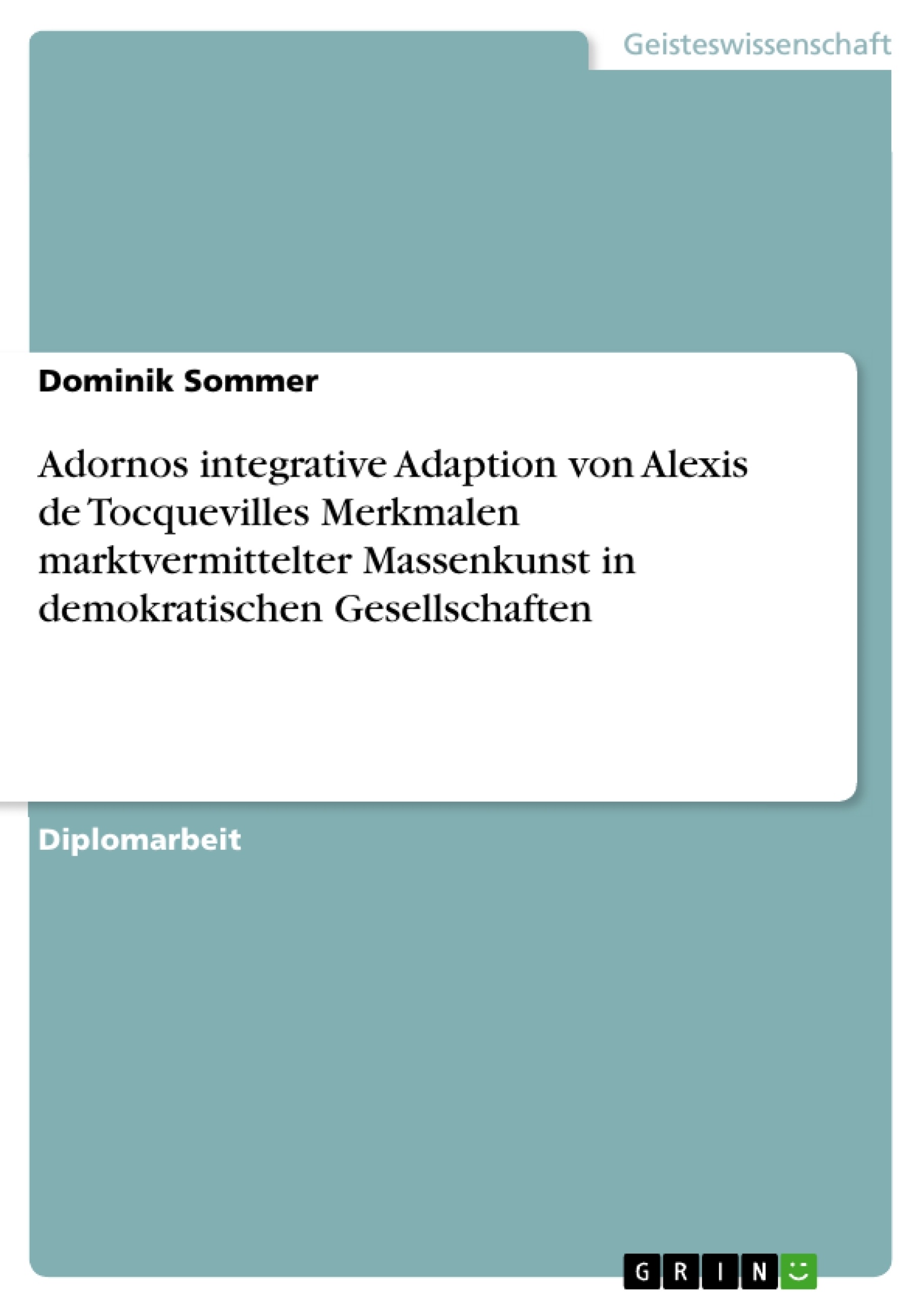Masse, Markt und Alltäglichkeit sind Begriffe, die dem Konzept der amerikanischen Popular Art gerecht werden können. Roy Lichtenstein und Andy Warhol, als zwei ihrer prominentesten Vertreter, holten durch Provokation mit dem Trivialen die darstellende Kunst von ihrem Sockel der „Hohenkünste“ in die Welt des Alltags einer demokratisierten westlichen Welt. Ihr Kunstkonzept, bevor es als fetischisierte corporate identity den Markt eroberte, basierte auf der bewussten Provokation mit alltäglichen Inhalten oder auf der Veralltäglichung vormaliger gehobener Sinnzusammenhänge.
Eine inhaltliche Profanisierung der Malerei, die an die Stelle von Heiligen oder Herrschern den privaten Alltag durchschnittlicher Menschen stellt, bestimmt das Werk Lichtensteins. Portraits von Männern und Frauen, die in Sprechblasen einen kurzen Einblick in ihre privatistische Beziehungswelt geben, sind im als trivial geltenden Comic-Stil aufbereitet. Der Stil stellt die Antithese zur Werksästhetik bürgerlicher Kunst dar, verweist er doch auf die Anonymität unbekannter Zeichner und die technische Reproduzierbarkeit billiger Hefte. Als Beispiel für die Veralltäglichung gehobener Sinnzusammenhänge können die in knalligen Farben aufbereiteten Drucke Warhols gelten, die Mao Tse-tung in eine Reihe mit Marilyn Monroe stellen. Warhols und Lichtensteins Produktionen gelten gerade auch deshalb als Kunst, weil sie die High-Art radikal und plakativ in Frage stellten und diese mit den Mitteln der Low-Art bis in den Kitsch transszendierten. Natürlich wurden sie für ihre Entweihungen der hohen Kunst entlohnt: Die auf Grund ihrer trivialen Inhalte voraussetzungslose individuelle Zugänglichkeit machten sie zum künstlerischen Standartgut der modernen Weltgesellschaft und trieben die Preise ihrer Bilder und die Anzahl ihrer wie auch immer gearteten Reproduktionen in schwindelerregende Höhen. Ergibt sich der künstlerische Wert Warhols und Lichtensteins eher aus ihrem Platz innerhalb eines Diskurses der Kunst über ihre Grenzen, so ist ihr marktlicher Wert der Perfektionierung eines Prinzips zu verdanken, dessen Funktionsprinzipien bei Alexis de Tocqueville und Theodor W. Adorno grundsätzlich untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Masse, Markt, Alltäglichkeit.
- A. Kunst- und Kultursoziologie bei Alexis de Tocqueville und Theodor W. Adorno
- I. Alexis de Tocqueville
- 1. Kontextualisierung von Tocquevilles Kultursoziologie in Über die Demokratie in Amerika
- 2. Die deduzierte Gleichheit: Zur Methodologie Tocquevilles
- 3. Tocquevilles Kunstsoziologie
- 1. die Architektur
- 2. das Handwerk.
- 3. die schönen Künste
- 4. die Literatur
- 5. das Theater
- II. Theodor W. Adorno
- 1. Ureigenstes und gesellschaftliches Ganzes: Die Methodologie Adornos
- 2. Kontextualisierung der Dialektik der Aufklärung
- 1. Kernaussage
- 2. Struktur und Aufbau
- 3. Geschichtlicher Kontext
- 4. Die Ideologiekritik der Ideologiekritik
- 5. Die Wirkungsmacht der Dialektik der Aufklärung
- 3. Die Kontextualisierung der Kulturindustrie innerhalb der Dialektik der Aufklärung.
- 4. Bestimmung des Kulturindustriebegriffs: Definition und Merkmale
- 5. Kunstbegriff Adornos
- 1. Ökonomische Vermittlung ästhetischer Phänomene.
- 2. Versöhnung von Mensch und Natur.
- 3. Funktionslosigkeit als Aufgabe der Kunst
- 4. Beschaffenheit der Kunst
- 5. Ästhetischer Schein
- 6. Gesellschaftskritik vs. Vergesellschaftung
- 7. Zusammenfassung
- 26. Theorie der Kulturindustrie
- 1. Charakteristika kulturindustrieller Produkte.
- 2. Ideologien der Kulturindustrie
- 3. Schließungsmechanismen der Kulturindustrie
- 4. Innere und äußere Herrschaft der Kulturindustrie
- 5. Kulturindustrie als Bewusstseinsindustrie
- 6. Manipulation und rückwirkendes Bedürfnis.
- 7. Folgen.
- B. Vergleich
- I. Übereinstimmungen in der Sache
- II. Zwei Perspektiven auf Kultur
- 1. Tocquevilles Blick auf demokratische Massenkultur
- 1. Gleichheit als Vorsehung: Tocquevilles geschichtsphilosophische Prämisse
- 2. Ideologie aristokratischer Kultur und Politik: Tocquevilles persönliche Perspektive
- 3. Die demokratische höfische Gesellschaft: Demokratie und individuelles Bewusstsein
- 2. Adornos Blick auf Kulturindustrie
- 1. Die Masse als Träger sozialen Fortschritts
- 2. Scheitern der Masse als revolutionären Subjekt
- 3. Kunst als Widerstand gegen universelle Vermittlung
- 4. Entsubjektivierung und Manipulation durch Kulturindustrie
- 5. Die Reaktion auf den Verlust progressiver Dialektik: Negative Geschichtsphilosophie
- 6. Kritik 1: Zweiseitige Kausalzurechnung
- 7. Kritik 2: Pessimismus gegenüber den kommunikativen Formen der Rationalität
- 8. Die ästhetische Betrachtungsweise der Moderne
- 9. Adorno als Vertreter der bürgerlichen Werkskunst
- 10. Zusammenfassung
- 1. Tocquevilles Blick auf demokratische Massenkultur
- III. Die Integriertheit der demokratisch-,,höfischen Gesellschaft“: Adaptive Elemente von Tocquevilles Kunstdiagnose bei Adorno.
- 3C. Kritik (Fortsetzung) und Ausblick
- I. Affirmative Zeitdiagnose: Die Bestätigung Adornos
- II. Kritik 3: Die kulturkonservative Verengung Adornos
- III. Kritik 4: Selbstkorrektur Adornos
- 1. Medienspezifische Vermittlungsformen
- 2. Betrug und Selbstbetrug: das doppeltes Bewusstsein der Rezipienten
- 3. Veränderung kulturindustrieller Inhalte
- 4. Erziehung der Rezipienten
- IV. Kritik 5: Die Differenzierung des Rezipientenverhaltens in den Cultural Studies
- V. Kritik 6: Kritik an der postmodernen Kritik
- 1. Täuschung und Wiederkehr des Verdrängten
- 2. Künstler in den Kontrollturm
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Integration der demokratischen höfischen Gesellschaft unter Bezugnahme auf die Werke von Alexis de Tocqueville und Theodor W. Adorno. Sie untersucht, wie die Kunst in demokratischen Gesellschaften durch den Markt und die Massen geprägt wird und welche Folgen dies für die Kultur und das Bewusstsein der Menschen hat. Die Arbeit setzt sich mit dem Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, dem Einfluss der Massenmedien und dem Wandel von Kunstbegriffen auseinander.
- Kunst und Gesellschaft in demokratischen Gesellschaften
- Die Rolle des Marktes und der Massen in der Kunst
- Kulturindustrie und ihre Auswirkungen
- Kritik an der Vermassung von Kunst und Kultur
- Die Bedeutung der ästhetischen Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Masse, Markt, Alltäglichkeit. Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentralen Begriffe Masse, Markt und Alltäglichkeit vor. Es wird erläutert, wie die Kunst von ihren traditionellen Eliten und der „Hohenkunst“ in die Welt des Alltags einer demokratisierten Gesellschaft gelangt ist.
- A. Kunst- und Kultursoziologie bei Alexis de Tocqueville und Theodor W. Adorno Dieser Abschnitt befasst sich mit den zentralen Theorien von Tocqueville und Adorno zur Kunst und Kultur in demokratischen Gesellschaften.
- I. Alexis de Tocqueville: Das Kapitel analysiert die Kultursoziologie von Tocqueville im Kontext seiner Werke „Über die Demokratie in Amerika". Es werden seine Methodologie und seine Ansichten zur Kunst in demokratischen Gesellschaften betrachtet.
- II. Theodor W. Adorno: Hier wird Adornos Methodologie in Verbindung mit dem Begriff des „Ureigensten“ und „gesellschaftlichen Ganzen“ erläutert. Es erfolgt eine detaillierte Kontextualisierung der „Dialektik der Aufklärung“ mit ihren Kernaussagen, dem Aufbau, dem historischen Kontext und der Ideologiekritik. Weiterhin wird die Kulturindustrie innerhalb der „Dialektik der Aufklärung“ betrachtet und der Kulturindustriebegriff mit seinen Merkmalen definiert. Schliesslich werden Adornos Kunstbegriff, seine Ansichten zur Ökonomischen Vermittlung ästhetischer Phänomene und die Funktionslosigkeit der Kunst analysiert. Der Abschnitt schliesst mit einer Zusammenfassung von Adornos Gedanken zur Kulturindustrie und ihren Auswirkungen.
- B. Vergleich: Dieses Kapitel setzt sich mit den Übereinstimmungen und Unterschieden in den Ansichten von Tocqueville und Adorno auseinander.
- I. Übereinstimmungen in der Sache
- II. Zwei Perspektiven auf Kultur: Hier werden die Ansichten von Tocqueville und Adorno zur demokratischen Massenkultur und zur Kulturindustrie kontrastiert.
- III. Die Integriertheit der demokratisch-,,höfischen Gesellschaft“: Adaptive Elemente von Tocquevilles Kunstdiagnose bei Adorno. Dieses Kapitel untersucht, wie Adorno die Ansätze von Tocqueville in seiner Analyse der Kulturindustrie integriert.
- 3C. Kritik (Fortsetzung) und Ausblick: Dieser Abschnitt befasst sich kritisch mit den Theorien von Adorno und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
- I. Affirmative Zeitdiagnose: Die Bestätigung Adornos
- II. Kritik 3: Die kulturkonservative Verengung Adornos
- III. Kritik 4: Selbstkorrektur Adornos: Hier werden Adornos Ansichten zur medienspezifischen Vermittlung, zum doppelten Bewusstsein der Rezipienten, zur Veränderung kulturindustrieller Inhalte und zur Erziehung der Rezipienten kritisch betrachtet.
- IV. Kritik 5: Die Differenzierung des Rezipientenverhaltens in den Cultural Studies
- V. Kritik 6: Kritik an der postmodernen Kritik:
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Kunst- und Kultursoziologie, insbesondere mit der Beziehung von Kunst und Gesellschaft, dem Einfluss der Massenmedien auf die Kultur und dem Wandel von Kunstbegriffen in demokratischen Gesellschaften. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: demokratische höfische Gesellschaft, Markt, Masse, Alltäglichkeit, Kulturindustrie, ästhetische Erfahrung, Kunstdiagnose, gesellschaftliche Integration, Medienkritik, Ideologiekritik, Geschichtsphilosophie.
Häufig gestellte Fragen zu Adorno und Tocqueville
Was versteht Adorno unter „Kulturindustrie“?
Die kommerzielle Vermarktung von Kultur, die zu Standardisierung, Manipulation und dem Verlust der kritischen Funktion von Kunst führt.
Welche Parallelen gibt es zwischen Tocqueville und Adorno?
Beide untersuchten kritisch die Auswirkungen der Massengesellschaft auf die Kunst und die Gefahr der Nivellierung in demokratischen Systemen.
Was bedeutet „Profanisierung der Malerei“ bei Roy Lichtenstein?
Lichtenstein holte die Kunst durch die Verwendung von Comic-Stilen und trivialen Alltagsszenen von ihrem „hohen Sockel“ in den Alltag.
Was ist der „ästhetische Schein“ nach Adorno?
Die Eigenschaft wahrer Kunst, eine eigene Realität zu schaffen, die im Gegensatz zur verwalteten Welt steht und Widerstand ermöglicht.
Wie sah Tocqueville die Kunst in der amerikanischen Demokratie?
Er beobachtete einen Trend zu nützlicher, massentauglicher Kunst auf Kosten der aristokratischen, idealisierten Formen.
- I. Alexis de Tocqueville
- Citation du texte
- Dominik Sommer (Auteur), 2004, Adornos integrative Adaption von Alexis de Tocquevilles Merkmalen marktvermittelter Massenkunst in demokratischen Gesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27130