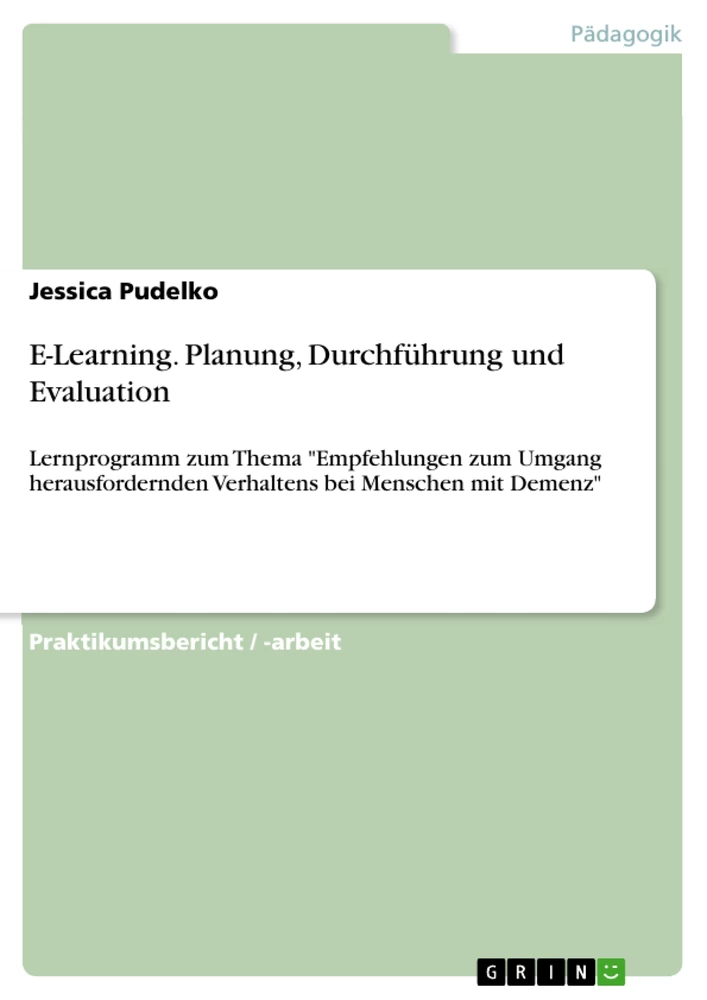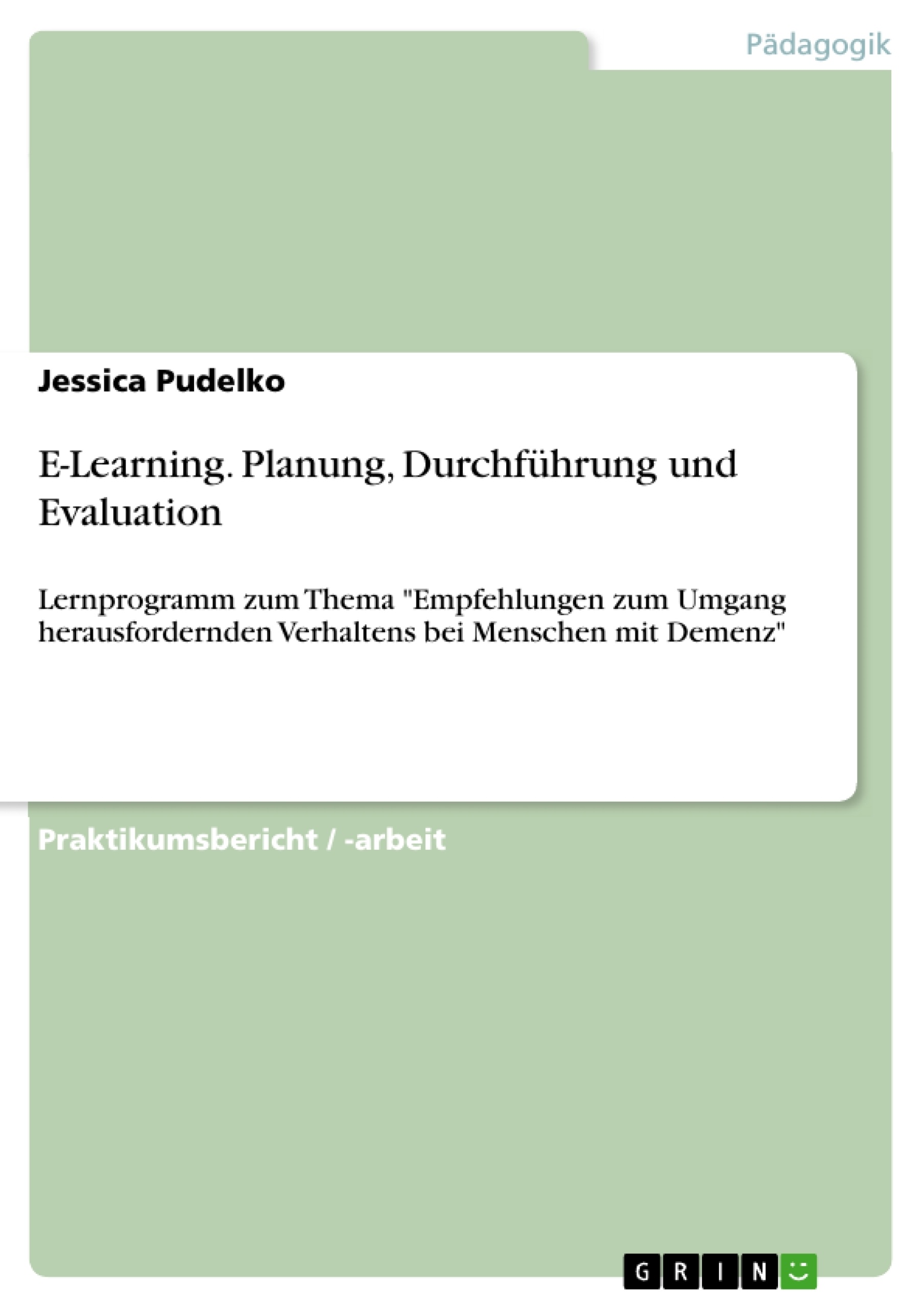Diese Hausarbeit ist eine reflektierende Dokumentation zum geleisteten Praktikum im Modul 3B im Studiengang B.A. Bildungswissenschaften. Ziel dieser reflektierenden Dokumentation ist es, die Erfahrungen innerhalb des Praktikums mit seinen theoretischen und praktischen Elementen der Bildungswissenschaft zu vereinen und die eigene Einschätzung bezüglich der geleisteten Tätigkeiten zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Das Praktikum wurde im Altersheim Dorf am Hagebölling in Hagen geleistet. Durch den demografischen Wandel, der sich durch eine alternde Gesellschaft abzeichnet, verstärkt sich die Wichtigkeit der Aus - und Weiterbildung immer mehr auf den Dienstleistungssektor. Auf Grund dieser Problematik entstand die Projektidee eines E-Learning Programms, als Weiterbildungsmaßnahme.
Die Aufgabe innerhalb des Praktikums beinhaltete die Planung, Konzipierung, Durchführung und Evaluation eines E-Learning Programms zum Thema ,,Empfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz“. Im Verlauf dieser Dokumentation wird der gesamte Ablauf des zu realisierenden Projektes von der Planung bis zur Evaluation in einer vollständigen Handlung beschrieben und in einen theoretischen Rahmen gebettet. Das abschließende Fazit reflektiert nochmal die Entstehung einer bildungswissenschaftlichen Profession hinsichtlich des geleisteten Praktikums
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Praktikumsstelle
3. Bildungstheoretische Rahmung
3.1 PlanungsmodellR2D2
3.2 Medienwahl eXeleaming
3.3 Cognitive Apprenticeship
3.4 Implementation
3.5 Evaluation
4. Projektmanagement
4.1 Initiierung
4.2 Planung
4.3 Steuerung
4.4 Abschluss
5. Qualitätssicherung
6. Evaluation
7. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Diese Hausarbeit ist eine reflektierende Dokumentation zum geleisteten Praktikum im Modul 3B im Studiengang B.A. Bildungswissenschaften. Ziel dieser reflektierenden Dokumentation ist es, die Erfahrungen innerhalb des Praktikums mit seinen theoretischen und praktischen Elementen der Bildungswissenschaft zu vereinen und die eigene Einschätzung bezüglich der geleisteten Tätigkeiten zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Das Praktikum wurde im Altersheim geleistet. Durch den demografischen Wandel, der sich durch eine alternde Gesellschaft abzeichnet, verstärkt sich die Wichtigkeit der Aus - und Weiterbildung immer mehr auf den Dienstleistungssektor. Auf Grund dieser Problematik entstand die Projektidee eines E-Learning Programms, als Weiterbildungsmaßnahme. Die Aufgabe innerhalb des Praktikums beinhaltete die Planung, Konzipierung, Durchführung und Evaluation eines E-Learning Programms zum Thema „Empfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz“. Im Verlauf dieser Dokumentation wird der gesamte Ablauf des zu realisierenden Projektes von der Planung bis zur Evaluation in einer vollständigen Handlung beschrieben und in einen theoretischen Rahmen gebettet. Das abschließende Fazit reflektiert nochmal die Entstehung einer bildungswissenschaftlichen Profession hinsichtlich des geleisteten Praktikums.
2. Praktikumsstelle
Das Praktikum wurde in einem Altersheim absolviert. Die Institution gehört einer Stiftung an, die mehrere Altersheime, aber auch Krankenhäuser, Wohnheime und Werkstätten für Behinderte führt und zudem eine Akademie für Forschung, Lehre und Ausbildung besitzt. Durch einen Nebenjob der dort von mir ausgeübt wird, ist mir das Altersheim bekannt und durfte dort auch das Praktikum ableisten. Als Projekt wurde die Erstellung eines E-Learning Programms in Auftrag gegeben, das als Inhalt Empfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz beinhalten sollte. Um die Institution besser kennen zu lernen und sich intensiver mit dem Thema Demenz zu beschäftigen und Beobachtungen zu tätigen wurde an der Beschäftigung des Sozialen Dienstes teilgenommen. Dort wurde dann Gedächtnistraining, Bewegungstraining, singen und vorlesen zum größten Teil angeboten. Zwischenzeitlich fanden Gespräche mit dem sozialen Dienst und dem Pflegepersonal statt um die Methoden, demenzkranke den Alltag zu verschönern, zu eruieren. In Abspreche mit dem Pflegepersonal und der Heimleitung wurden dann die Methoden und die Struktur des E-Learning Programms entwickelt. Durch Beobachtungen im täglichen Arbeitsablauf wurde deutlich, dass häufig Praktikanten oder junge Leute die ein Freiwilliges soziales Jahr in diesem Altersheim absolvieren, kaum bis gar keine Erfahrungen mit Demenzkranken Menschen haben. Es bot sich die Möglichkeit, in Absprache mit der Hausleitung ein E-Learning Programm zu planen und zu konzipieren. Ziel des E-Learning Programms sollte sein, die ersten Ängste und Schwierigkeiten in der Arbeit mit Demenzkranken Menschen zu erleichtern, sowie für mehr Verständnis für ihr herausforderndes Verhalten zu sorgen. Dieses Lernprogramm wurde anschließend im Intranet angeboten, damit die Mitarbeiter und Praktikanten ständig Zugang zu dem multimedialen Lernprogramm haben. Im Laufe des Projektes wurde abschließend an das Lernprogramm ein Online-Fragebogen aufgeführt um das erstellte Lernprogramm zu evaluieren. Stetiger Ansprechpartner im Laufe des Projektes war die Hausleitung.
3. Bildungstheoretische Rahmung
Das Projekt muss als erstes geplant werden, um es im nächsten Schritt durchzuführen, dann zu implementieren und es zuletzt zu evaluieren. Voraussetzung für das E-Learning Programm war ein Computer mit Internetverbindung, der für die Mitarbeiter zugänglich ist. Die Bildungstheoretische Rahmung zeigt den bildungswissenschaftlichen Bezug des geplanten Projektes.
3.1 Planungsmodell R2D2
Als Planungsmodell wurde das konstruktivistische Planungsmodell R2D2 von Jerry Willis gewählt. ,,Die Bezeichnung R2D2 steht für rekursiv und reflektiert, Design und Development“. Es zeichnet sich durch eine Annäherung des Ziels aus. Es ist im Gegensatz zu den traditionellen Planungsmodellen ein iterativer statt linearer Prozess. Die Planungsstufen der Entwicklung und Planung werden mehrmals durchlaufen. Lernziele verändern sich stetig im Laufe des Prozesses. Es gibt drei Fokussierte Punkte die bei der Planung essentiell sind:
1. Fokus auf Analyse (Bedarfsanalyse, Analyse von Tätigkeiten und Lerninhalten, Analyse von Lernenden und Lernumwelt )
2. Fokus auf Design und Entwicklung ( Medienwahl, Aufbau der Entwicklungsumgebung, Produktgestaltung und -umsetzung, Prototyp - Entwicklung, formative Evaluation )
3. Fokus auf Einführung und Durchführung ( Erstellung des Endprodukts, Einführung, Schulung, Wartung, Verbesserung ) (Kerres, M.,2012,S.211).
Dieses Planungsmodell wurde gewählt, da der Konstruktivistische Ansatz den Fokus auf die Eigenaktivität des Lernenden mit dem Lerngegenstand setzt (Jost, MB, Mumma, P. & Willis, J. (1999). R2D2: Eine konstruktivistische / Interpreti- vist Instructional Design Modell. In J. Price et al. (Hrsg.), Proceedings der Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 1999 (S. 1489-1494). Chesapeake, VA: AACE. Abgerufen 23. Januar 2014 von http://www.editlib.Org/p/8201). Durch den Prozess der Bedarfsanalyse wurde ersichtlich, dass die Zielgruppe neue Mitarbeiter wie Praktikanten oder Jahrespraktikanten des Freiwilligen sozialen Jahres sind. Durch Beobachtungen im Arbeitsalltag wurde das Problem ersichtlich, dass dieser Mitarbeiterkreis häufig Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit Demenz aufweisen. Insbesondere bei Auftreten von herausforderndem Verhalten der Bewohner. Somit wurde als Lernziel mehr Handlungskompetenz im Umgang mit Menschen mit Demenz und ein Basiswissen über Demenz und die dazugehörigen Methoden festgelegt. Da die Lernenden über wenig Vorwissen bezüglich Demenz verfügen, sollte der Lerninhalt Schrittweise gesteigert werden, jedoch eher einen Überblick verschaffen und nicht zu sehr auf Expertenwissen aus sein. Die Lernumgebung sollte einfach, seriös und übersichtlich gestaltet sein, dem Thema entsprechend und jederzeit zugänglich sein.
3.2 Medienwahl: eXelearning
Bei der Frage der Medienwahl fiel die Entscheidung auf ein E-Learning Programm, dass jederzeit zugänglich ist, da die Zielgruppe zu unterschiedlichen Zeiten das Programm benötigt. Die Einstellung von Praktikanten erfolgt ganzjährig. Zudem wurde E-Learning soweit bekannt, in dieser Institution noch nicht Angeboten, deshalb war das Interesse groß, inwiefern E-Learning akzeptiert wird und auch gewünscht wird. Hinzukommt, dass die Zielgruppe des Projektesjede Altersschicht abdeckt und daher eine gewisse Sicherheit im Umgang mit Computern, zur Nutzung des E-Learning Programms, von Vorteil ist. Zur Gestaltung der Lernumgebung wurde im Internet nach einem passenden Open Source Programm gesucht. Durch Bewertungen anderer Nutzer hinsichtlich der Handhabung und Gestaltungsmöglichkeiten, wurde das Programm eXelearning gewählt. Es stehen einem verschiedene Layouts zur Verfügung, zwischen denen man Wählen kann, ebenso kann man aus einem Pool von iDevices wählen, um sein E-Learning Programm zu gestalten und zu entwickeln. Beispielsweise, ob man einen freien Text hinzufügen möchte oder Multiple Choice Fragen erstellen will. Durch diese Vorauswahl von Möglichkeiten wurde die Gestaltung des E-Learning Programms nach einer gewissen Eingewöhnungszeit wesentlich vereinfacht, da fur Menschen mit wenig IT-Kenntnissen eine solche Erstellung eines E-Learning Programms schwer zu bewerkstelligen ist.
3.3 Cognitive Apprenticeship
Zur Erstellung einer Lernumgebung wird ein didaktisches Design benötigt, damit man anhand dessen die Lernumgebung aufbauen kann. In diesem Fall ist es das Instruktionsdesign Cognitive Apprenticeship. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der Lehrende mit der Zeit seine Hilfestellung bezüglich Aufgaben zurücknimmt bis der Lernende ohne Hilfe des Lehrenden Aufgaben löst und die Aufgaben und der Lerninhalt von einfach zu immer komplexeren steigt. Da die Zielgruppe wenig Vorwissen mitbringt und das Ziel ist, dass sie die vermittelten Inhalte und Methoden im Umgang mit den Bewohnern beherzigen und wenigstens teilweise anwenden erschien das Cognitive Apprenticeship als die geeignete Didaktik (Lehmann, 2007, S.17-18). Zuvor wurde das Anchored Instruction als mögliches Modell in Betracht gezogen, jedoch schien es eher unpassend, da es vor allem mit Problemsituationen arbeitet, so genannten „Ankern“ an denen sich die Lernenden besser orientieren können und realistische Kontexte, die aktive Wissenskonstruktion anregen ( Lehmann, 2007, S.15-16). Da wir aber Primär ein Grundwissen über die Krankheit Demenz mit anschließender Vertiefung zum Umgang mit herausforderndem Verhalten erreichen wollten, bot sich das Cognitive Apprenticeship eher an. Durch die langsame Heranführung an das Thema mit steigernden Aufgaben und abnehmender Unterstützung erschien es für die Zielgruppe passender zu sein. Denkbar wäre das Anchored Instruction für eine Vertiefung des Themas, wenn schon Grundwissen über Demenz und herausforderndes Verhalten vorhanden ist. Nachdem die Didaktik nach der das Lernprogramm konzipiert werden sollte fest stand, wurden Informationen zum Thema Demenz, herausforderndem Verhalten und die dazugehörigen Methoden aus einschlägiger Fachliteratur gesichtet. Auch eine Medienauswahl wurde getroffen. Mehrere unterstützende Applikationen und zwei Videos wurden in das Lernprogramm integriert. Die Videos zeigen einmal grundsätzlich ein Altersheim mit demenzkranken und dem Personal und dann die Methode der Validation. Das erste Video soll als erste Identifikation mit der eigenen Arbeitssituation und der Arbeitsumgebung dienen. Da verstärkt auf das Thema Validation in dem Lernprogramm eingegangen wird, stellt das zweite Video eine gute Hilfestellung dar, um die Vorgehensweise und Gegenreaktion von Validation zu erfassen. Die einzelnen Applikationen sollen die Methoden verdeutlichen und bestenfalls als Erinnerungsbrücken den Lernenden im Gedächtnis bleiben. So ist beispielsweise für die Methode Erinnerungsarbeit eine Uhr abgebildet oder zur Bewegungsförderung ein laufender Mensch mit einer Herzfrequenz im Hintergrund zu sehen. Das einsetzen der Applikationen verlief zügig, jedoch dauerte das einsetzen der Videos eine gewisse Zeit, da sie eine falsche Formatierung hatten und gewisse Plug-ins zum abspielen der Videos fehlten. Die Gestaltung der Informationstexte war simpel und das einfügen von Wikipedia texten für Definitionen verlief Problemlos. Das erstellen der Multiple Choice Fragen und den verdeckten Antworten, sowie Fallbeispielen mit verdeckten Feedback gelang auch schnell, jedoch wurden bei der Kontrolle des Lernprogramms immer wieder Lernaufgaben hinzugefügt oder abgeändert. Eine sinnvolle Strukturierung der Themen mit Unterpunkten wurde immer wieder bearbeitet,damit eine sinnvolle und klare Gliederung für die Lernenden entstehen konnte. Abschließend fehlte noch eine Online Umfrage, zur Evaluierung des E-Learning Programms. Durch viele Programme die im Internet Angeboten werden, wurde auf der Seite www.UmfrageOnline.com mit Hilfe des Studentenstatus und einer Registrierung auf der Website eine Umfrage zur Handhabbarkeit, Layout, Weiterempfehlung und weitere Fragen erstellt. Das Layout wurde in einem schlichten grün gehalten, sodass keine große Ablenkung durch Verschiedene Farben entstehen kann. Somit war der Prototyp des Lernprogramms fertig. Für eine hinreichende formative Evaluation fehlte die Zeit. Dies ist eher bei Projekten mit größerer Zeitspanne effektiv. Anschließend wurde das Lernprogramm mit Hilfe der Option des exportierens auf einen Selbstschreibenden Ordner verlegt, um es dann mit Hilfe einer Website zu öffnen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des E-Learning-Programms für Demenz?
Es soll neuen Mitarbeitern und Praktikanten Basiswissen über Demenz vermitteln und Ängste im Umgang mit herausforderndem Verhalten abbauen.
Was besagt das Planungsmodell R2D2?
R2D2 steht für einen rekursiven, reflektierten Design- und Entwicklungsprozess, der iterativ (wiederholend) statt linear verläuft.
Was ist „Cognitive Apprenticeship“ im E-Learning?
Ein didaktisches Design, bei dem die Unterstützung durch den Lehrenden schrittweise abnimmt, während die Komplexität der Aufgaben für den Lernenden steigt.
Warum wurde eXelearning als Software gewählt?
Es ist ein Open-Source-Programm, das auch Personen mit geringen IT-Kenntnissen ermöglicht, strukturierte Lernumgebungen mit interaktiven Elementen zu erstellen.
Wie wird der Erfolg des Lernprogramms überprüft?
Durch eine abschließende Evaluation mittels eines Online-Fragebogens, der die Akzeptanz und den Wissenszuwachs bei den Nutzern misst.
- Quote paper
- Jessica Pudelko (Author), 2014, E-Learning. Planung, Durchführung und Evaluation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271402