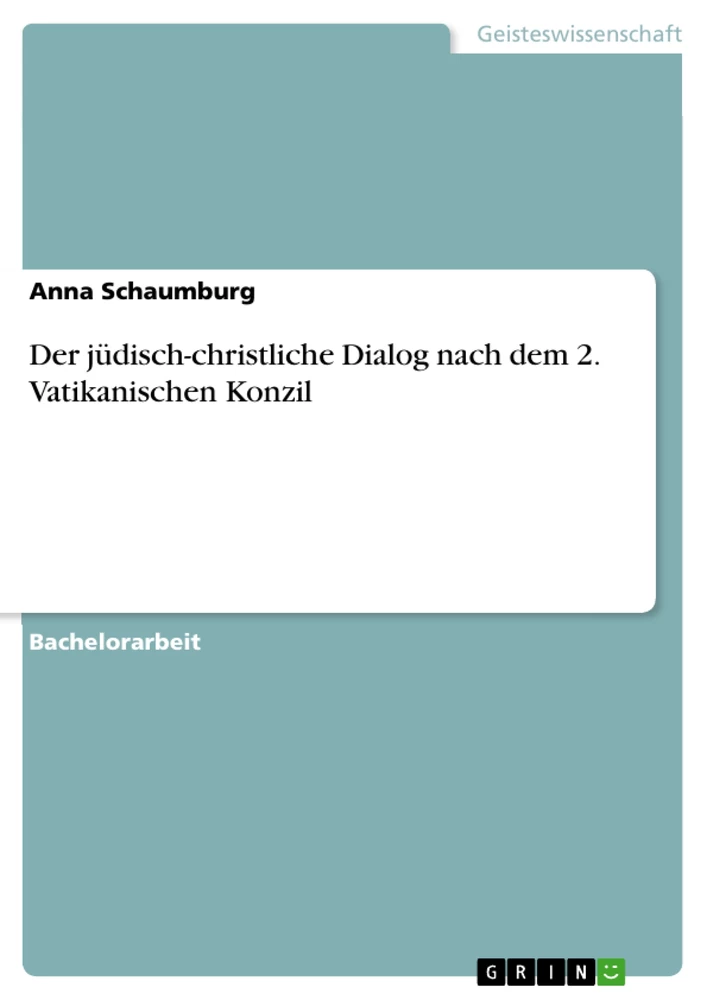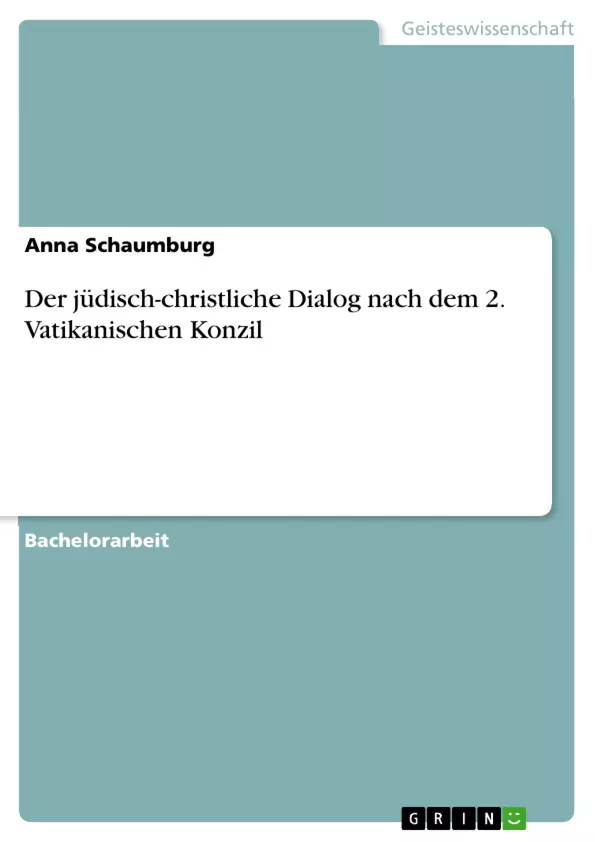"Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert, hat mir Tränen genug gekostet, wenn Christen so sehr vergessen konnten, daß unser Herr ja selbst ein Jude war."
Dieses Zitat stammt aus dem Werk Nathan der Weise, veröffentlicht 1779 von Gotthold Ephraim Lessing (*1729, † 1789), der seinem Freund Moses Mendelssohn (*1729, † 1786), dem Begründer der jüdischen Aufklärung, damit ein literarisches Denkmal setzen wollte. Es beinhaltet zentrale Wahrheiten im Verhältnis von Christentum und Judentum: Ein Judentum ohne das Christentum kann man sich leicht denken, niemals jedoch ein Christentum ohne das Judentum. „Das Christentum steht in einem Familienzusammenhang mit dem Judentum, wie er enger nicht gedacht werden kann: Das Christentum ist aus dem Schoß des Judentums hervorgegangen.” Die Kirche hat ihren Ursprung in Israel, in Jesus von Nazareth, einem Juden unter dem mosaischen Gesetz (Gal 4,4f). Dies erkennt sie zum ersten Mal 1965 in der Erklärung über die Haltung der katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Nostra Aetate an. In der fast zweitausendjährigen Geschichte davor hat sie ihren Ursprung allzu oft vergessen und mit antijüdischen Traditionen und Feindlichkeit gar unterdrückt. Judenmission war im Mittelalter keine Seltenheit. Den Höhepunkt der Grausamkeit bildet schließlich im 20. Jahrhundert die Schoa. Der Gesprächskreis Juden und Christen fragt zu recht: „Wie haben Menschen, wie haben Christen damals auf Ermordungen, Mißhandlungen und Schändungen in der Reichspogromnacht, die im Gegensatz zu dem, was sich in den Konzentrationslagern abspielte, in aller Öffentlichkeit stattfand, reagiert?[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Erklärung Nostra Aetate
- Entstehungsgeschichte
- Inhalt der Erklärung Nostra Aetate
- Artikel 1
- Artikel 2
- Artikel 3
- Artikel 4
- Artikel 5
- Rezeption und jüdisch-christlicher Dialog nach Nostra Aetate
- Der Gesprächskreis Juden und Christen
- Der niemals gekündigte Bund Gottes
- Nein zur Judenmission
- Ein Dialog nach der Schoa?
- Zukunft braucht Erinnerung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem jüdisch-christlichen Dialog und analysiert die Entwicklungen seit der Erklärung Nostra Aetate. Sie untersucht den Einfluss des Gesprächskreises Juden und Christen auf das Verhältnis beider Religionsgemeinschaften und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen eines Dialogs nach der Schoa.
- Die Bedeutung der Erklärung Nostra Aetate für den jüdisch-christlichen Dialog
- Die Rolle des Gesprächskreises Juden und Christen bei der Förderung des Dialogs
- Die Frage nach Schuld, Leid und Versöhnung im Kontext der Schoa
- Die Bedeutung des niemals gekündigten Bundes Gottes mit Israel
- Die Ablehnung der Judenmission und die Bedeutung des Dialogs ohne Mission
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des jüdisch-christlichen Dialogs ein und beleuchtet die Bedeutung der Erklärung Nostra Aetate als Wendepunkt in der Geschichte der Beziehungen zwischen Judentum und Christentum. Die Erklärung wird in Kapitel 2 ausführlich dargestellt, wobei der Fokus auf dem vierten Artikel liegt, der sich mit dem besonderen Verhältnis von Kirche und Judentum auseinandersetzt. Die Rezeption von Nostra Aetate und die Entwicklungen im jüdisch-christlichen Dialog werden in diesem Kapitel ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem Gesprächskreis Juden und Christen, einem wichtigen Dialogorgan, das sich mit der Aufarbeitung der Vergangenheit und der Gestaltung der Zukunft des jüdisch-christlichen Verhältnisses auseinandersetzt. Die zentralen Themen dieses Kapitels sind der niemals gekündigte Bund Gottes mit Israel, die Ablehnung der Judenmission und die Herausforderungen eines Dialogs nach der Schoa.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Bedeutung der Erinnerung im Kontext der Schoa und beleuchtet die Notwendigkeit, die Vergangenheit zu bewahren, um zukünftige Gräueltaten zu verhindern. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die aktuellen Entwicklungen im jüdisch-christlichen Dialog zusammenfasst und die Bedeutung des Dialogs für die Zukunft beider Religionsgemeinschaften hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den jüdisch-christlichen Dialog, die Erklärung Nostra Aetate, den Gesprächskreis Juden und Christen, den niemals gekündigten Bund Gottes mit Israel, die Schoa, Schuld, Leid und Versöhnung, Antijudaismus, Judenmission, Dialog ohne Mission, Erinnerungskultur und die Bedeutung des Dialogs für die Zukunft beider Religionsgemeinschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Nostra Aetate" und warum ist es wichtig?
"Nostra Aetate" ist eine Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1965, die das Verhältnis der katholischen Kirche zu nichtchristlichen Religionen, insbesondere zum Judentum, grundlegend neu definierte.
Was bedeutet der "niemals gekündigte Bund"?
Es ist die theologische Erkenntnis, dass Gottes Bund mit dem jüdischen Volk weiterhin besteht und nicht durch das Christentum ersetzt wurde (Abkehr von der Substitutionstheorie).
Wie steht die Kirche heute zur Judenmission?
Im modernen jüdisch-christlichen Dialog wird die Judenmission abgelehnt; stattdessen steht die Begegnung im Zeichen des gegenseitigen Respekts und Dialogs.
Welche Rolle spielt die Schoa im heutigen Dialog?
Die Schoa ist der schmerzhafte Hintergrund, der eine kritische Aufarbeitung der christlichen Antijudaismus-Tradition und eine neue Ethik der Erinnerung notwendig gemacht hat.
Was ist der "Gesprächskreis Juden und Christen"?
Ein Gremium, das sich aktiv für die Förderung des Dialogs, die Versöhnung und die gemeinsame Gestaltung der Zukunft beider Religionsgemeinschaften einsetzt.
- Citation du texte
- Anna Schaumburg (Auteur), 2013, Der jüdisch-christliche Dialog nach dem 2. Vatikanischen Konzil, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271518