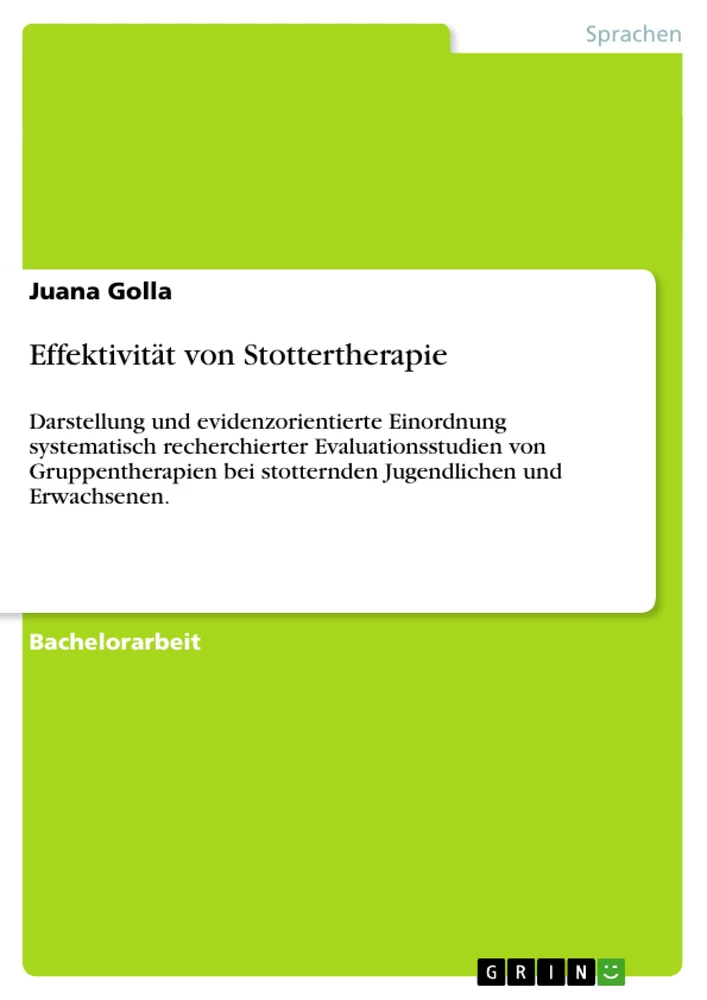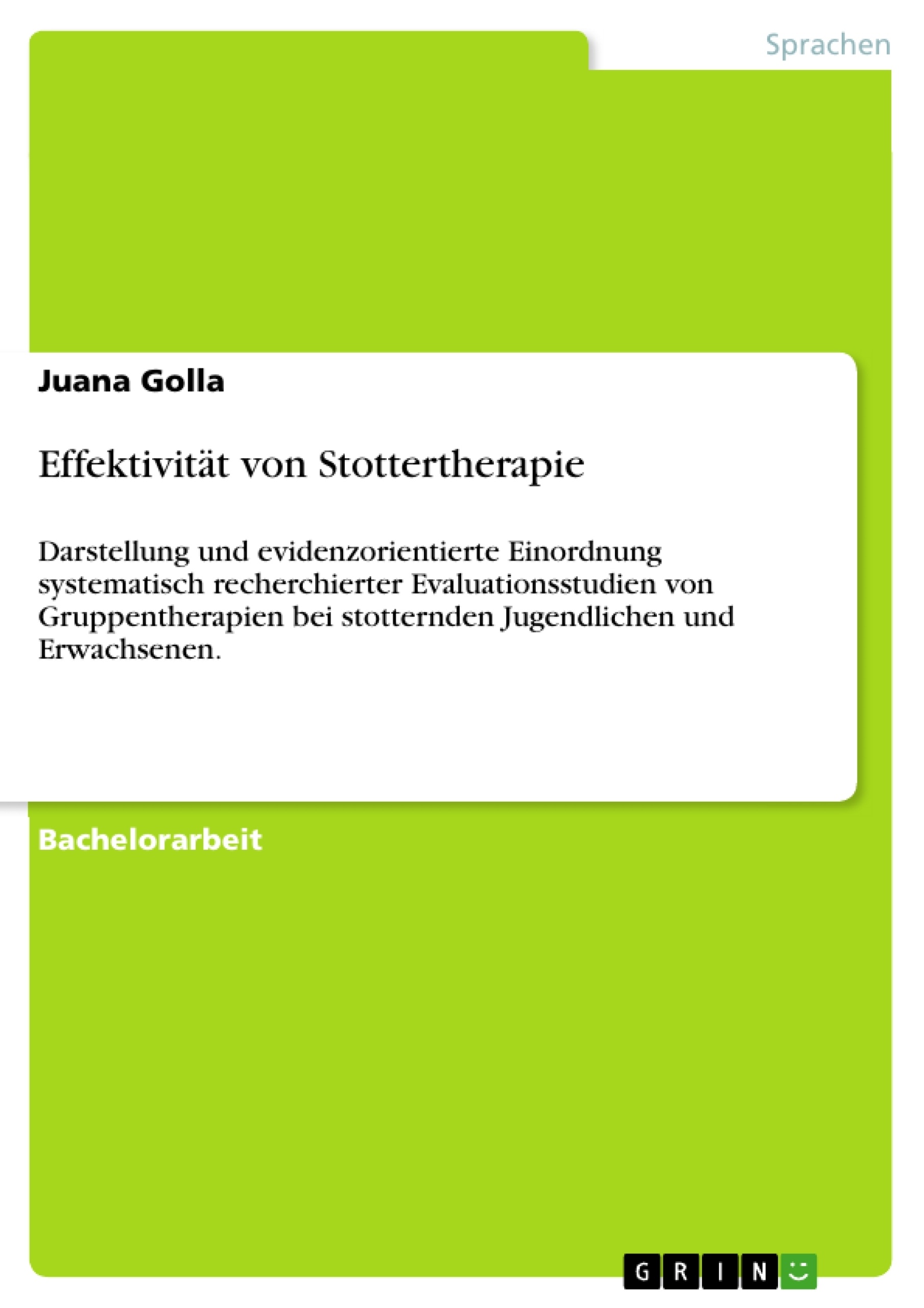Stottern ist eine Unterbrechung im Fluss des verbalen Ausdrucks, die charakterisiert ist durch unwillkürliche, hörbare oder stille Wiederholungen und Dehnungen bei der Äußerung kurzer Sprachelemente […]. Diese Unterbrechungen geschehen in der Regel häufig oder sind deutlich ausgeprägt und sind nicht ohne Weiteres kontrollierbar. (Windgate, 1964; zit. in Kuhr, 1991, S. 3)
Diese häufig verwendete deskriptive Definition für das Störungsbild Stottern gilt als sog. Standard Definition of Stuttering. In der Bundesrepublik Deutschland weisen 3-5 % aller Kinder eine Stottersymptomatik auf (Ochsenkühn, Thiel & Ewerbeck, 2010). Diese tritt bei ca. 800.000 Personen noch im Erwachsenenalter auf, was mit einer Prä-valenz von ca. 1% angegeben wird (Iven & Kleissendorf, 2010). Die Behandlungsmöglichkeiten für stotternde Kinder, Jugendliche und Erwachsene und die Veröffentlichungen zum Stottern nehmen stetig zu (Sandrieser & Schneider, 2008). So gibt es aktuell z. B. zahlreiche Veröffentlichungen evaluierter Verfahren in nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Dies macht eine Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis möglich (Bürki, Kempe, Kohler & Steiner, 2011).
Die Internationale Klassifizierung zur Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), fasst das Syndrom unter dem Punkt „Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus“ (b33) zusammen (WHO, 2001) und bietet sich als einheitlicher Rahmen für den Umgang mit der Redeflussstörung Stottern an.
Inhaltsverzeichnis
- ZUSAMMENFASSUNG
- ABSTRACT
- INHALTSVERZEICHNIS
- 1 Einleitung
- 2 Das Phänomen Stottern
- 2.1 Kern- und Begleitsymptomatik sowie Copingstrategien
- 3 Grundgedanken zu Diagnostik und Therapie
- 3.1 Diagnostik
- 3.2 Therapie des Stotterns
- 3.2.1 Therapierichtungen und Behandlungsformen
- 3.3 Stottern und die ICF
- 4 Rahmenbedingungen der Therapieforschung
- 4.1 Studientypen - Studienverlauf
- 4.2 Effektivität und evidenzbasierte Medizin
- 4.2.1 Evidenzklassifikation
- 5 Effektivität von Gruppenstottertherapie
- 5.1 Methodische Vorgehensweise
- 5.1.1 Einschlusskriterien
- 5.1.2 Suchmethoden für die Identifizierung von Studien
- 5.2 Darstellungen der Ergebnisse
- 5.2.1 Beschreibung der eingeschlossenen Studien
- 5.1 Methodische Vorgehensweise
- 6 Diskussion der Ergebnisse und Einordnung der Studien in Evidenzklassen
- 6.1 Kritik der eigenen Studie
- 7 Zusammenfassung und Ausblick
- LITERATURVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ANHANG A
- ANHANG B
- ANHANG C
- ANHANG D
- ANHANG E
- ANHANG F
- ANHANG G
- ANHANG H
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage nach der Wirksamkeit von Stottertherapien, insbesondere Gruppentherapien für stotternde Jugendliche und Erwachsene im deutschen und angloamerikanischen Sprachraum. Die Arbeit analysiert systematisch recherchierte Evaluationsstudien und ordnet diese nach Evidenzstufen ein.
- Effektivität von Gruppentherapie bei Stottern
- Evidenzbasierte Einordnung von Evaluationsstudien
- Methodische Vorgehensweise bei der Auswahl und Analyse von Studien
- Kritik und Diskussion der Ergebnisse
- Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Stottern ein und erläutert die Relevanz von Wirkungsnachweisen in der Therapie. Kapitel 2 beleuchtet das Phänomen Stottern, beschreibt Kernsymptome, Begleitsymptome und Copingstrategien. Kapitel 3 behandelt die Grundgedanken zu Diagnostik und Therapie von Stottern, einschließlich verschiedener Therapierichtungen und Behandlungsformen. Zudem wird die Bedeutung der ICF (Internationale Klassifizierung zur Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) für das Verständnis von Stottern und die Therapieentwicklung hervorgehoben. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen der Therapieforschung, wobei verschiedene Studientypen und die Bedeutung evidenzbasierter Medizin erläutert werden. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche zu Gruppentherapien bei stotternden Jugendlichen und Erwachsenen. Es werden verschiedene Therapiekonzepte wie das SSMP (Successful Stuttering Management Program), das Sommercamp der Therapie Cook, die Intensiv-Modifikation Stottern (IMS), die Kasseler Stottertherapie (KST) und das Comprehensive Stuttering Program (CSP) vorgestellt und deren Ergebnisse detailliert beschrieben. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse der Studien und ordnet diese nach Evidenzstufen ein. Dabei werden die methodischen Stärken und Schwächen der einzelnen Studien beleuchtet und die Herausforderungen bei der Vergleichbarkeit von Studienergebnissen aufgezeigt. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stottertherapie, Gruppentherapie, Jugendliche, Erwachsene, Evidenzbasierte Medizin, Evaluationsstudien, Stottermodifikation, Fluency Shaping, SSMP, Sommercamp der Therapie Cook, Intensiv-Modifikation Stottern, Kasseler Stottertherapie, Comprehensive Stuttering Program, ICF, Wirksamkeit, Therapieerfolg, Methodische Kritik.
- Citation du texte
- Juana Golla (Auteur), 2011, Effektivität von Stottertherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272058