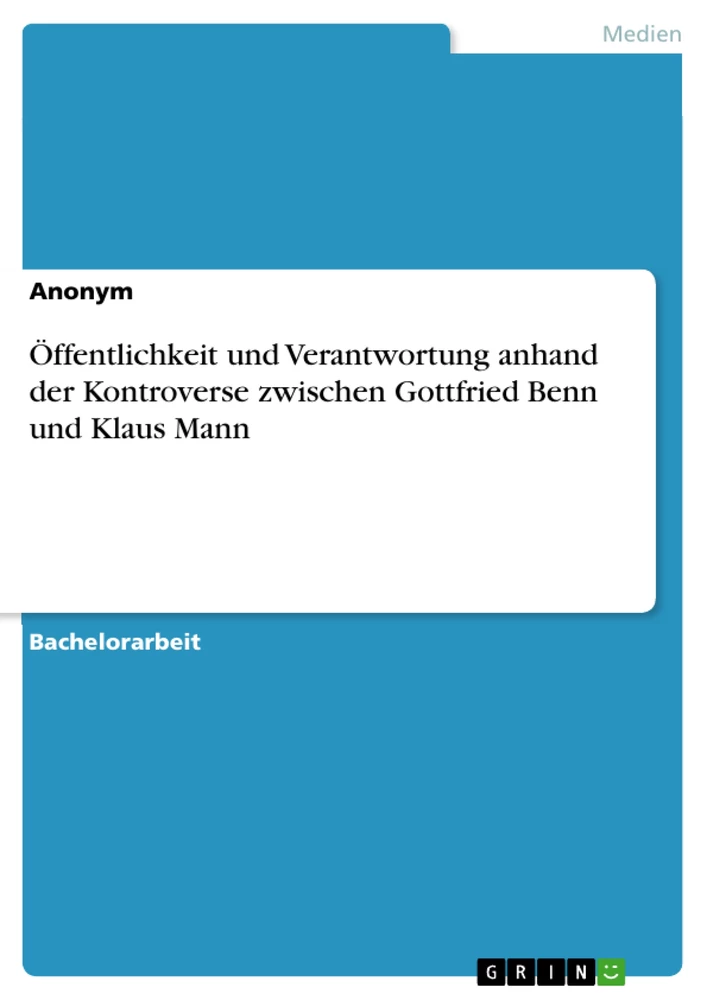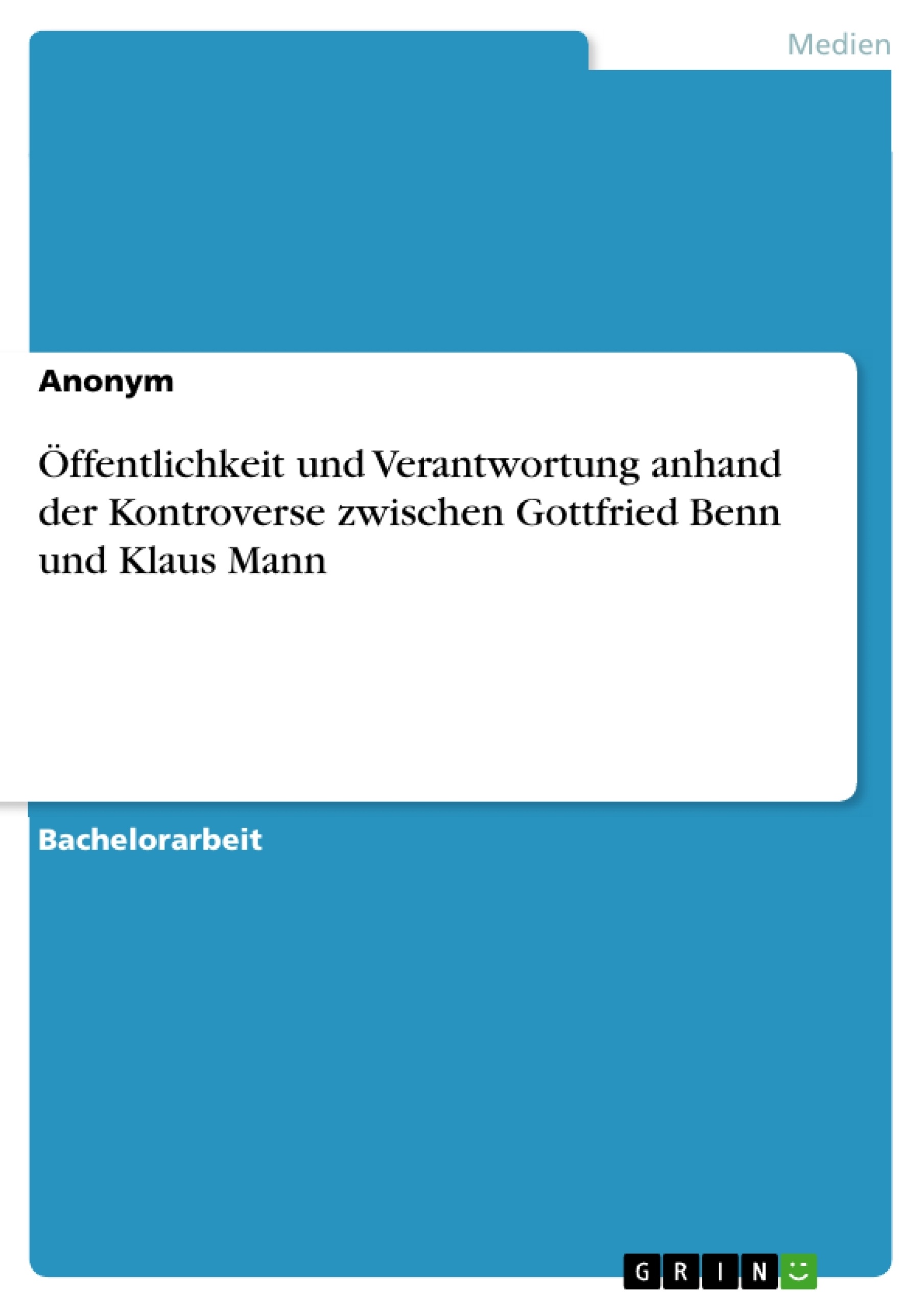Mit diesen Worten beschrieb der Schriftsteller Klaus Mann, Sohn von Thomas Mann und Neffe von Heinrich Mann, den expressionistischen Dichter und Arzt Gottfried Benn 1942 in seiner Autobiografie „Der Wendepunkt“. Mann verehrte den 20 Jahre älteren Benn und sah in ihm ein Vorbild. Die Freundschaft, die beide verband, zerbrach allerdings anlässlich einer etwa neun Jahre zuvor öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung; Grund waren die unterschiedlichen politischen Positionen beider Literaten. Denn Gottfried Benn wandte sich 1933 zunächst den Nationalsozialisten zu und sprach sich mit großer Überzeugung für den „Neuen Staat“ aus, während sich Klaus Mann dagegen wandte und wie viele andere Schriftsteller Deutschland verließ. Benns Haltung konnte er nicht akzeptieren und formulierte seine Enttäuschung darüber in einem persönlichen Brief an Benn, der diesen öffentlich beantwortete. In der Antwort bezog Benn nicht nur Stellung zu Manns Brief, sondern nahm ihn außerdem zum Anlass, seine Meinung zur Emigration von Schriftstellern überhaupt darzustellen. Die Auseinandersetzung beider wurde zu einer öffentlichen Kontroverse, die Thema der vorliegenden Arbeit ist. Dabei steht die Frage im Vordergrund, warum sie eine solche öffentliche Relevanz erlangte und welches Verständnis Benn und Mann von Verantwortung der Gesellschaft gegenüber hatten.
Um die Motive und Positionen von Benn und Mann besser nachvollziehbar zu machen, gehe ich auf einige Ereignisse vor der hier schwerpunktmäßig untersuchten Debatte ein. Denn Benn geriet bereits Ende der zwanziger Jahre von einem „repräsentativen literaturpolitischen Konflikt“ in den nächsten (Ziegler, S. 29), was Auswirkungen auf seine Reaktionen nach 1933 im Allgemeinen und im Konflikt mit Mann im Besonderen hatte.
Anschließend betrachte ich wichtige Ereignisse aus Benns und Manns Leben, wobei ich mich auf die Zeit bis zu der Kontroverse beschränke. Anschließend gebe ich einen kurzen Überblick über die politische Situation in Deutschland vor und während des Konflikts, den ich anschließend nachzeichne. Schließlich erfolgt die Einordnung der Kontroverse in Bezug auf die Relevanz für die Öffentlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gottfried Benn und seine „Rolle als Schriftsteller in dieser Zeit"
- „Können Dichter die Welt ändern?" — Die erste Debatte um Benn in der „Neuen Bücherschau"
- „Eine Geburtstagsrede und die Folgen"— Die Kritik an Benns Rede für Heinrich Mann
- „Die Einwirkung der Kritik auf den Schaffenden" — Benns weitere Entwicklung ab 1932
- Auf der Suche nach einem Wegu — Zum Leben von Klaus Mann
- Die politische Situation in Deutschland 1929-1933
- Die Kontroverse zwischen Gottfried Benn und Klaus Mann
- Der Brief von Klaus Mann an Gottfried Benn
- Benns öffentliche „Antwort an die literarischen Emigranten"
- „Gottfried Benn. Oder: Die Entwürdigung des Geistes" Manns Reaktion auf Benns öffentliche Antwort
- Die weiteren Entwicklungen nach der Kontroverse und Benns „innere Emigration"
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die öffentliche Kontroverse zwischen Gottfried Benn und Klaus Mann im Jahr 1933, die sich aus ihren gegensätzlichen politischen Positionen im Kontext der NS-Machtergreifung entwickelte. Die Arbeit untersucht die Motive und Argumente beider Schriftsteller im Detail und beleuchtet die Frage, warum diese Auseinandersetzung eine solche öffentliche Relevanz erlangte.
- Die unterschiedlichen politischen Positionen von Benn und Mann im Kontext der NS-Machtergreifung
- Die Rolle der literarischen Öffentlichkeit und die Bedeutung von Verantwortung im Angesicht der politischen Entwicklungen
- Die Auswirkungen der Kontroverse auf die Karrieren und Lebenswege beider Schriftsteller
- Die Bedeutung von Kunst und Politik im Dritten Reich und die Frage nach der Trennung oder Verbindung beider Bereiche
- Die unterschiedlichen Strategien von Schriftstellern im Angesicht der NS-Diktatur: Emigration, innere Emigration, Anpassung und Widerstand
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Kontroverse zwischen Benn und Mann vor und skizziert den thematischen Rahmen der Arbeit. Sie erläutert die besondere Bedeutung dieser Auseinandersetzung im Kontext der politischen Entwicklungen in Deutschland und hebt die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Politik hervor.
Kapitel 2 beleuchtet Benns Leben und Werk vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Situation in Deutschland. Es beschreibt die frühen Debatten um Benns Werk und seine Person, insbesondere die Auseinandersetzung mit den kommunistischen Autoren Egon Erwin Kisch und Johannes R. Becher. Dieses Kapitel zeichnet Benns Entwicklung zum „politischen Schriftsteller" nach und analysiert seine Haltung zur Weimarer Republik und zum Verhältnis von Kunst und Politik.
Kapitel 3 gibt einen Überblick über Klaus Manns Leben und Werk. Es konzentriert sich auf die Zeit vor der Kontroverse mit Benn und beschreibt Manns politische Entwicklung, sein wachsendes politisches Bewusstsein und seinen frühen Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Kapitel 4 bietet einen kurzen Überblick über die politische Situation in Deutschland von 1929 bis 1933. Es beschreibt die wirtschaftliche Krise, die Radikalisierung der politischen Landschaft und die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen der NS-Diktatur für die Gesellschaft und die Kunst, insbesondere die Bücherverbrennungen und die Gleichschaltung des kulturellen Lebens.
Kapitel 5 widmet sich der Kontroverse zwischen Benn und Mann. Es analysiert den Brief von Klaus Mann an Gottfried Benn, der den Konflikt auslöste, und Benns öffentliche „Antwort an die literarischen Emigranten". Dieses Kapitel untersucht die Argumente und Positionen beider Schriftsteller im Detail und zeigt die unterschiedlichen Vorstellungen von Verantwortung und dem Verhältnis von Kunst und Politik auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kontroverse zwischen Gottfried Benn und Klaus Mann, die NS-Machtergreifung, die politische Situation in Deutschland 1929-1933, die Rolle von Kunst und Politik im Dritten Reich, die literarische Öffentlichkeit, Verantwortung, Emigration, innere Emigration und das Verhältnis von Kunst und Politik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Kontroverse zwischen Gottfried Benn und Klaus Mann?
Die Kontroverse dreht sich um die gegensätzlichen politischen Positionen der beiden Schriftsteller im Jahr 1933, als Benn sich den Nationalsozialisten zuwandte, während Mann emigrierte.
Wie reagierte Gottfried Benn auf Klaus Manns Kritik?
Benn antwortete öffentlich mit der „Antwort an die literarischen Emigranten“, in der er seine Unterstützung für den neuen Staat rechtfertigte und die Emigration kritisierte.
Welches Verständnis von Verantwortung hatten die beiden Autoren?
Die Arbeit untersucht, wie Mann die Verantwortung des Geistes gegen die Barbarei betonte, während Benn Kunst und Politik in einem spezifischen zeitgeschichtlichen Kontext verknüpfte.
Was versteht man unter Benns „innerer Emigration“?
Nach seiner anfänglichen Begeisterung für das NS-Regime und späterer Desillusionierung zog sich Benn in eine geistige Distanz zum Regime zurück, was oft als innere Emigration bezeichnet wird.
Welche Rolle spielten die Bücherverbrennungen in diesem Kontext?
Die Bücherverbrennungen und die Gleichschaltung des kulturellen Lebens bildeten den radikalen Hintergrund, vor dem sich die Entscheidung zwischen Anpassung, Widerstand oder Emigration abspielte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Öffentlichkeit und Verantwortung anhand der Kontroverse zwischen Gottfried Benn und Klaus Mann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272076