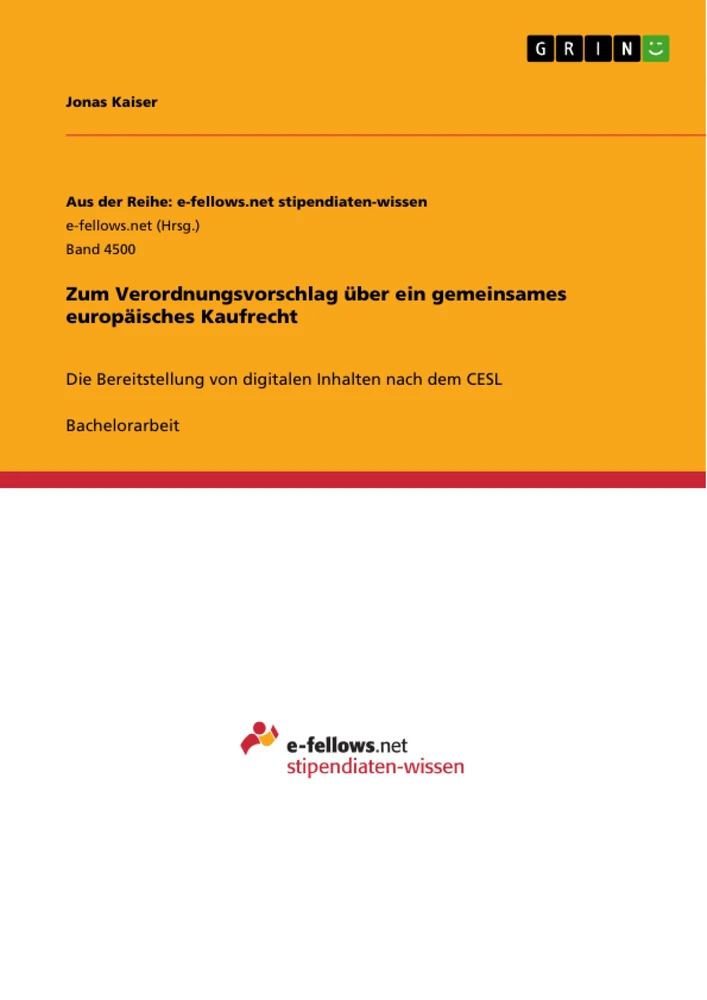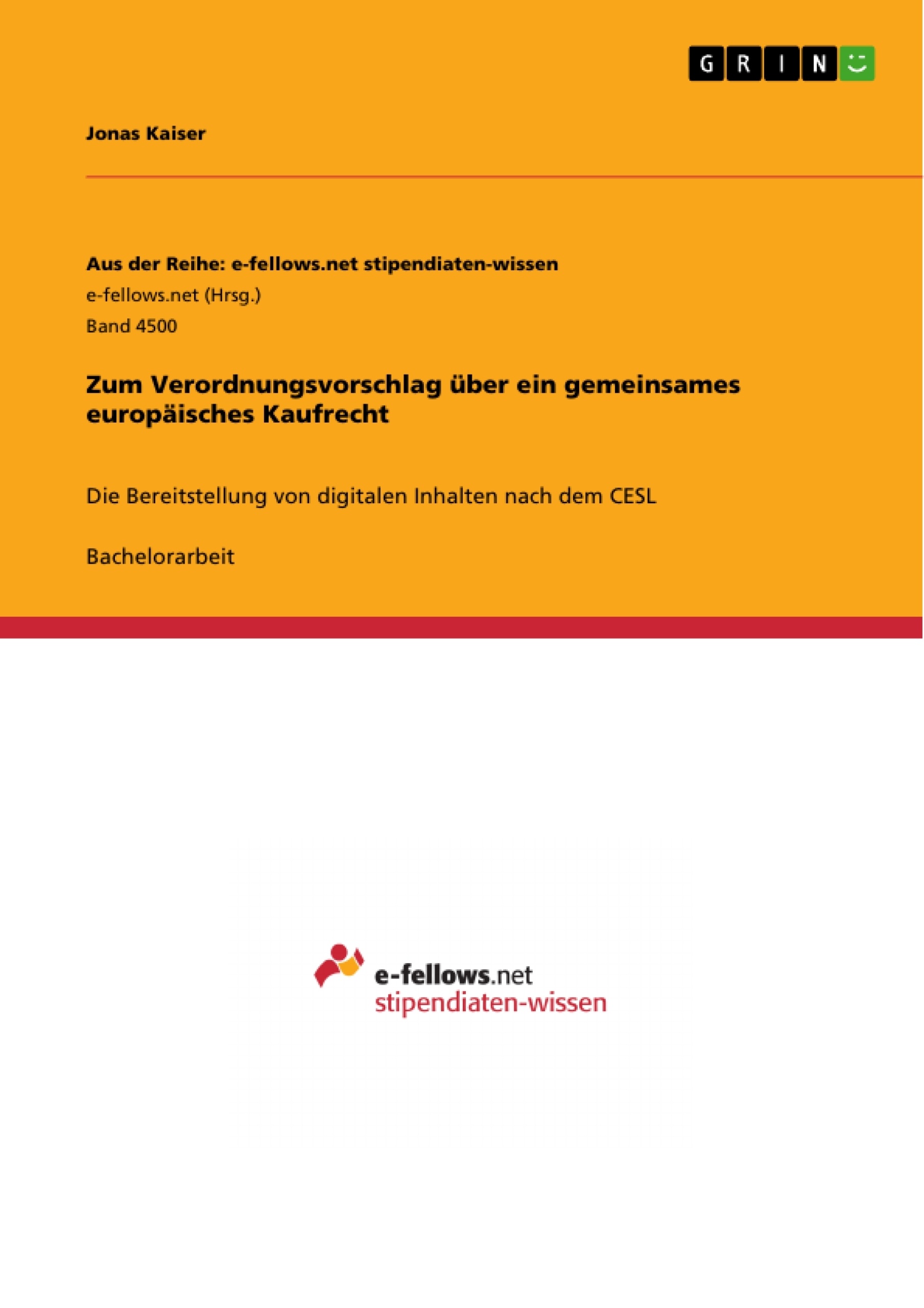Ein „Meilenstein in der Entwicklung des europäischen Vertragsrechts“ – Am 11. Oktober 2011 legte die Europäische Kommission nach mehr als zehnjähriger Vorbereitung den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht vor. Der Vorschlag löste eine breite wissenschaftliche Debatte aus, wagt sich die Kommission doch erstmals in ihrer Geschichte an die Vereinheitlichung materiellen Vertragsrechts in Europa heran.
Das Common European Sales Law („CESL“) ist als fakultatives zweites Vertragsrecht ausgestaltet und als optional anwählbares („opt-in“) Modell zum Kaufrecht der Mitgliedsstaaten konzipiert. Ist der Anwendungsbereich gegeben, können die Vertragsparteien also das CESL als anzuwendendes Recht vereinbaren. Das CESL ist damit nicht als Teil des einzelstaatlichen Rechts zu verstehen, sondern als Wahlmöglichkeit zwischen zwei innerhalb des Mitgliedsstaats geltenden Vertragsrechtsregelungen. Der Entwurf der Kommission spricht sich für eine Vorschaltlösung aus. Das Internationale Privatrecht soll dem CESL vorgeschaltet und von diesem nicht berührt werden. Neben einem erhöhten Verbraucherschutz sollen insbesondere die für kleine und mittlere Unternehmen hohen Transaktionskosten vermieden werden, wenn diese bei internationalen Geschäften zukünftig das CESL anwenden können. Die europäische Kommission hat dabei die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung von Transaktionen digitaler Inhalte erkannt. Der Verordnungsvorschlag erfasst daher ausdrücklich Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte.
In der Arbeit beschäftigt sich der Autor mit dieser neuen Vertragsart und untersucht die Auswirkungen des CESL auf IT-Verträge. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, auf welche Art und Weise digitale Inhalte zur Verfügung gestellt werden müssen, damit die zugrunde liegenden Verträge als Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte zu qualifizieren sind. Zudem werden einige Probleme erörtert, die bei der Anwendung des derzeitigen Vorschlags eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts auf Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte entstehen würden. Ein Augenmerk wird dabei auf den Besonderheiten bei der Rückabwicklung gelegt.
Inhaltsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, den Vertrag über die Bereitstellung von digitalen Inhalten nach dem CESL zu analysieren.
- Regulierung von Verträgen über digitale Inhalte im CESL
- Anwendbarkeit des CESL auf digitale Inhalte
- Schnittstellen zwischen CESL und Cloud Computing
- Europäische Harmonisierung des Vertragsrechts
- Aktuelle Entwicklungen im digitalen Vertragsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt die grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen für Verträge über digitale Inhalte, wobei ein Schwerpunkt auf dem CESL liegt.
Der zweite Teil widmet sich der Frage, inwieweit das CESL für die Regulierung von Verträgen über digitale Inhalte geeignet ist.
Der dritte Teil beleuchtet die Schnittstellen zwischen dem CESL und dem Cloud Computing.
Der vierte Teil diskutiert die Notwendigkeit und die Folgen einer europäischen Harmonisierung des Vertragsrechts.
Schlüsselwörter
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den Themen Vertragsrecht, Digitalisierung, CESL, Cloud Computing, Europäisches Recht, Harmonisierung, Vertragsfreiheit, Verbraucherschutz und digitale Inhalte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Gemeinsame Europäische Kaufrecht (CESL)?
Das CESL (Common European Sales Law) ist ein Vorschlag für ein optionales, EU-weites Kaufrecht, das Vertragsparteien als Alternative zum nationalen Recht wählen können („Opt-in“).
Gilt das CESL auch für digitale Inhalte?
Ja, der Verordnungsvorschlag erfasst ausdrücklich Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte, um der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung dieser Transaktionen gerecht zu werden.
Welche Vorteile bietet das CESL für kleine Unternehmen?
Es soll vor allem hohe Transaktionskosten bei grenzüberschreitenden Geschäften vermeiden und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz gewährleisten.
Wie wirkt sich das CESL auf Cloud Computing aus?
Die Arbeit untersucht die Schnittstellen zwischen CESL und Cloud-Diensten, insbesondere wie digitale Inhalte im Rahmen von IT-Verträgen qualifiziert werden.
Welche Probleme gibt es bei der Rückabwicklung digitaler Verträge?
Die Untersuchung beleuchtet Schwierigkeiten bei der Rückabwicklung im CESL, da digitale Inhalte im Gegensatz zu physischen Waren oft nicht einfach „zurückgegeben“ werden können.
- Arbeit zitieren
- Jonas Kaiser (Autor:in), 2013, Zum Verordnungsvorschlag über ein gemeinsames europäisches Kaufrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272081