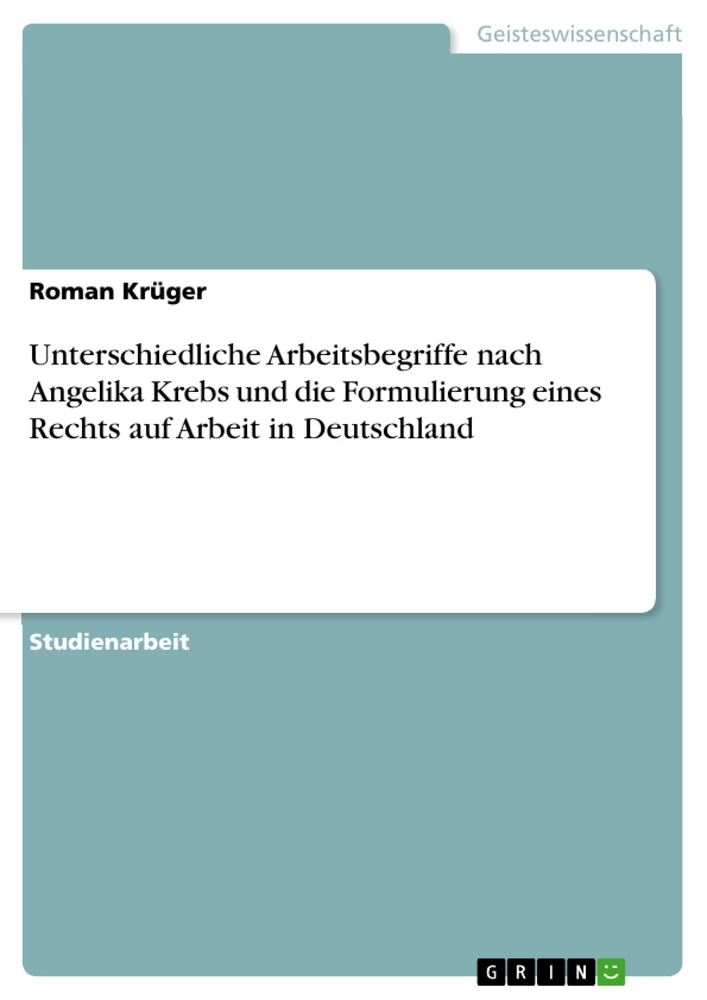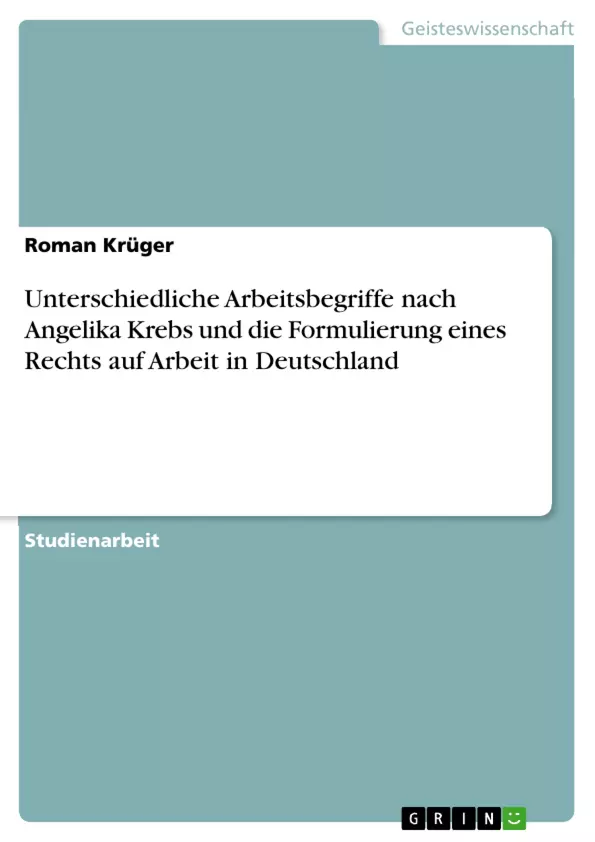Der Arbeitsbegriff unterliegt einem inflationären Gebrauch (Beziehungsarbeit, Trauerarbeit, Familienarbeit, Hausarbeit, etc.), sodass unterschiedliche Tätigkeiten unter dem Begriff 'Arbeit' zusammengefasst werden. Der Begriff 'Arbeit' ist auf diesem Wege selbst unklar geworden. Dies erkennend bemüht sich die gegenwärtige Philosophie um eine Differenzierung des Arbeitsbegriffs, so wie auch im ersten Teil dieser Studienarbeit eine eingehendere Begriffsfindung und Definition des Arbeitsbegriffs stattfinden wird. Hierfür sollen Angelika Krebs' Ausführungen in Arbeit und Liebe (Angelika Krebs: Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit. Suhrkamp Verlag (Frankfurt/M) 2002.) als Vorlage dienen. Weiterhin soll hier die besondere Rolle von Arbeit als grundlegendes Mittel zur Aufrechterhaltung einer gewissen Lebensqualität und zur gesellschaftlichen Integration herausgearbeitet werden. Die besondere Bedeutung von Arbeit soll anschließend als Anstoß für die Herleitung eines Rechts auf Arbeit innerhalb Deutschlands (ausgehend von vorhandenen Rechtsvorschriften) dienen. Hierbei wird auch untersucht, ob dieses hergeleitete Recht auf Arbeit den Aufgaben, die sich aus der besonderen Rolle von Arbeit ergeben, gerecht wird oder ob ergänzende Maßnahmen notwendig sind. In diesem Zusammenhang wird auch ein Model des Grundeinkommens als eine mögliche Alternative zur Arbeit geprüft, die die Notwendigkeit von Arbeit zur Aufrechterhaltung einer gewissen Lebensqualität und zur gesellschaftlichen Integration soweit abschwächen könnte, dass es zumindest zu diesen Zwecken verzichtbar sein könnte zu arbeiten. Abschließend wird dann auf eine Auswahl an Gegenargumenten bzgl. eines Rechts auf Arbeit eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung unterschiedlicher Arbeitsbegriffe nach Angelika Krebs
- a) Arbeit als zweckrationales Handeln
- b) Arbeit als Mühe
- c) Arbeit als entlohnte Tätigkeit
- d) Arbeit als Guterproduktion
- e) Arbeit als Guterproduktion bei der der Produzent durch eine andere Person ersetzbar ist
- f) Arbeit als gesellschaftlich notwendige Tätigkeit
- g) Arbeit als Tätigkeit für andere
- h) Arbeit als Tätigkeit im Rahmen des gesellschaftlichen Leistungsaustauschs — institutioneller Arbeitsbegriff
- Die Bedeutung von Arbeit als grundlegendes Mittel zur Aufrechterhaltung einer gewissen Lebensqualität und zur gesellschaftlichen Integration
- Herleitung eines Rechts auf Arbeit für die Bundesrepublik Deutschland
- Zulänglichkeit der deutschen Umsetzung des europarechtlichen Rechts auf Arbeit
- Grundeinkommen als Alternative zur Arbeit
- Zusammenfassung
- Einwände gegen die Begründung eines Rechts auf Arbeit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Verzeichnis der Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsanweisungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Definition des Arbeitsbegriffs und der Herleitung eines Rechts auf Arbeit in Deutschland, ausgehend von der aktuellen Gesetzgebung. Die Arbeit analysiert verschiedene Arbeitsbegriffe nach Angelika Krebs und untersucht die Bedeutung von Arbeit für die Lebensqualität und gesellschaftliche Integration. Im weiteren Verlauf werden die rechtlichen Grundlagen eines Rechts auf Arbeit in Deutschland beleuchtet und die Zulänglichkeit der aktuellen Umsetzung des europarechtlichen Rechts auf Arbeit diskutiert. Schließlich wird ein arbeitsunabhängiges Grundeinkommen als Alternative zur Arbeit betrachtet, um die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit zu mildern.
- Definition des Arbeitsbegriffs
- Die Bedeutung von Arbeit für die Lebensqualität und gesellschaftliche Integration
- Rechtliche Grundlagen eines Rechts auf Arbeit in Deutschland
- Zulänglichkeit der aktuellen Umsetzung des europarechtlichen Rechts auf Arbeit
- Grundeinkommen als Alternative zur Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung des Arbeitsbegriffs und zeigt die unterschiedlichen Konnotationen von Arbeit in verschiedenen Epochen auf. Sie erläutert die Bedeutung des Arbeitsbegriffs für die heutige Gesellschaft und die Notwendigkeit einer differenzierten Definition von Arbeit.
Das zweite Kapitel stellt verschiedene Arbeitsbegriffe nach Angelika Krebs vor und analysiert deren Vor- und Nachteile. Die Arbeit wird dabei unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, wie z.B. zweckrationales Handeln, Mühe, entlohnte Tätigkeit, Güterproduktion und gesellschaftlich notwendige Tätigkeit.
Kapitel drei untersucht die Bedeutung von Arbeit für die Lebensqualität und gesellschaftliche Integration. Es zeigt auf, wie Arbeitslosigkeit zu sozialer Degradierung, psychischen Problemen und einem Verlust an Status und Anerkennung führen kann.
Kapitel vier befasst sich mit der Herleitung eines Rechts auf Arbeit in Deutschland. Es analysiert die rechtlichen Grundlagen eines solchen Rechts, die in der deutschen Verfassung und in europäischen Richtlinien verankert sind.
Kapitel fünf untersucht die Zulänglichkeit der deutschen Umsetzung des europarechtlichen Rechts auf Arbeit. Es zeigt auf, dass die aktuelle Umsetzung des Rechts auf Arbeit nicht ausreichend ist, um die Folgen von Arbeitslosigkeit zu vermeiden.
Kapitel sechs diskutiert ein arbeitsunabhängiges Grundeinkommen als Alternative zur Arbeit. Es analysiert die Vor- und Nachteile eines solchen Modells und untersucht, ob es geeignet ist, die soziale Funktion von Arbeit zu schwächen und die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit zu mildern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Arbeitsbegriff, das Recht auf Arbeit, die Bedeutung von Arbeit für die Lebensqualität und gesellschaftliche Integration, die Zulänglichkeit der deutschen Umsetzung des europarechtlichen Rechts auf Arbeit und das arbeitsunabhängige Grundeinkommen als Alternative zur Arbeit. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie zur Vermeidung sozialer Degradierung und zur Stärkung der gesellschaftlichen Integration.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Angelika Krebs den Begriff "Arbeit"?
Krebs differenziert Arbeit unter anderem als zweckrationales Handeln, Mühe, entlohnte Tätigkeit oder als gesellschaftlich notwendige Tätigkeit.
Gibt es in Deutschland ein "Recht auf Arbeit"?
Die Arbeit untersucht die Herleitung eines solchen Rechts aus bestehenden nationalen Rechtsvorschriften und europäischen Richtlinien.
Warum ist Arbeit wichtig für die gesellschaftliche Integration?
Arbeit gilt als grundlegendes Mittel zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität und schützt vor sozialer Degradierung und dem Verlust an Anerkennung.
Ist das Grundeinkommen eine Alternative zur Arbeit?
Das Modell des Grundeinkommens wird als Möglichkeit geprüft, die Notwendigkeit von Erwerbsarbeit zur Existenzsicherung abzuschwächen.
Welche Gegenargumente gibt es zum Recht auf Arbeit?
Die Arbeit geht abschließend auf verschiedene philosophische und ökonomische Einwände gegen die Begründung eines einklagbaren Rechts auf Arbeit ein.
- Quote paper
- Roman Krüger (Author), 2013, Unterschiedliche Arbeitsbegriffe nach Angelika Krebs und die Formulierung eines Rechts auf Arbeit in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272192