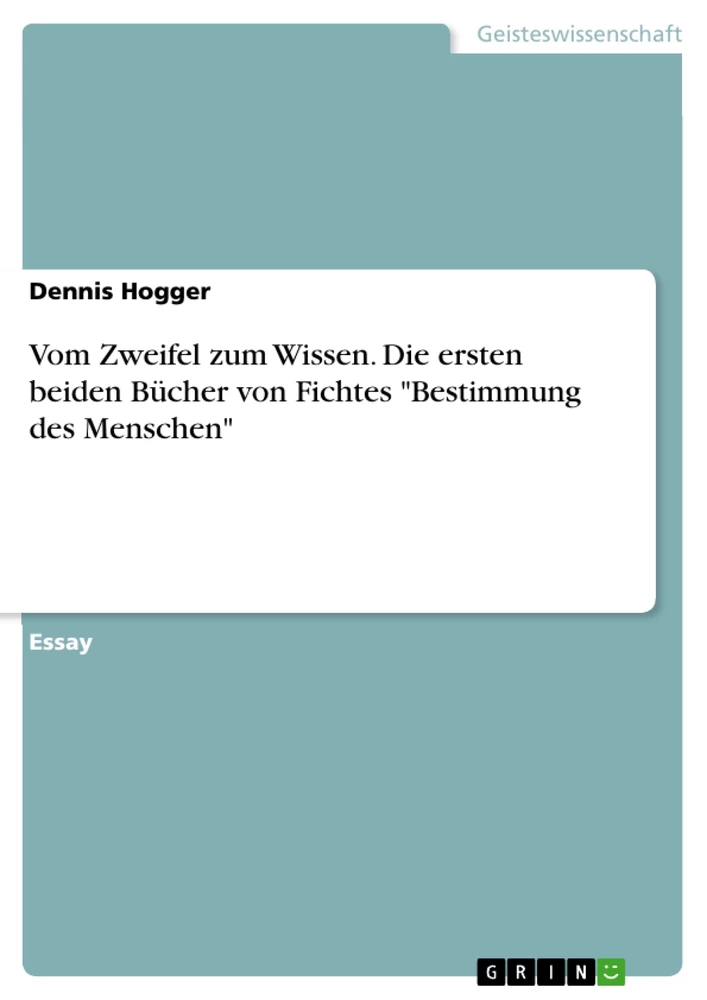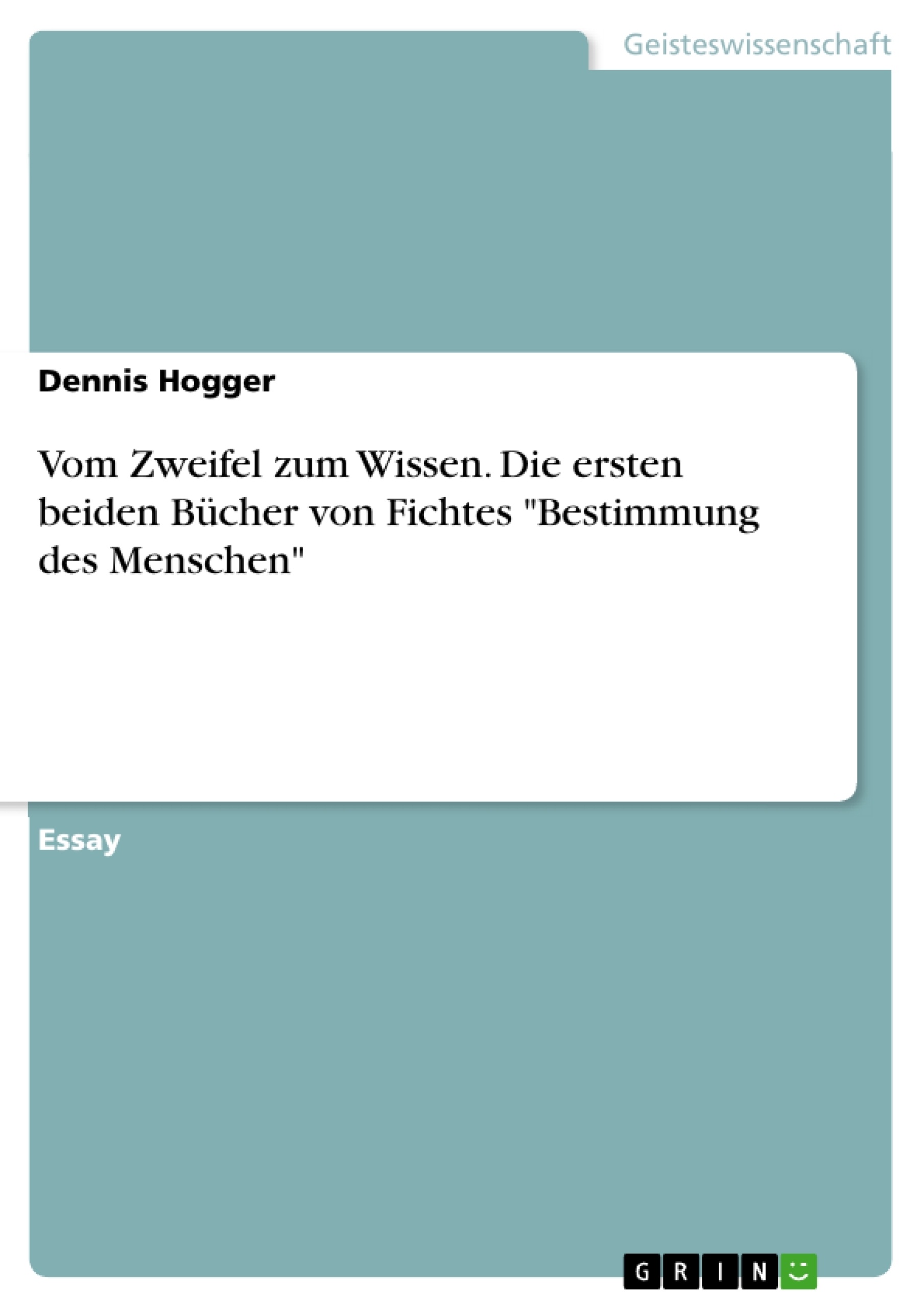Johann Gottlieb Fichtes „Die Bestimmung des Menschen“ von 1800 stellt einen Versuch Fichtes dar, die Grundzüge seiner Transzendentalphilosophie in verständlicher Weise der Öffentlichkeit darzulegen. Das Werk lässt sich damit in die Kategorie der Fichte´schen Populärphilosophie einreihen. In ihm präsentiert Fichte eine spezielle, idealistische Weltanschauung, die vor allem den herausgehobenen Status des Ich im Erkenntnisprozess hervorhebt.
Die „Bestimmung des Menschen“ ist nicht in der Art klassischer philosophischer Texte geschrieben. Das Werk besteht vielmehr größtenteils aus dem Monolog eines Ich-Erzählers, der die philosophischen Thesen quasi vor den Augen des Lesers entwickelt. Was genau Fichte mit dieser Darstellungsart bezweckt, wird später, in Kapitel 4, erklärt.
Die „Bestimmung des Menschen“ wurde vom Autoren in drei Bücher eingeteilt. Im zweiten Buch „Wissen“ konstruiert das Ich im Dialog mit einem anonymen Geist eine idealistische Erkenntnistheorie. Aus den Ergebnissen des Argumentationsverlaufs entsteht das Problem, dass die Realität völlig aufgelöst wird, da es dann nichts Bewusstsein gebe. Dieses Problem wird im dritten Buch „Glaube“ gelöst, indem das Handeln des Menschen als konstitutiv für die Entstehung von Realität bestimmt wird. Dieses befriedigende Ergebnis wird im weiteren Verlauf des dritten Buches noch durch einige weitere Überlegungen ergänzt, die aber nicht mehr in den engeren Kreis der Erkenntnistheorie gehören. Fichtes System ist damit nach dem Stand des Jahres 1800 umfassend auf populäre Weise aufgearbeitet worden.
Was dieses Bild eines kohärenten philosophischen Werkes allerdings trübt, ist das erste Buch der „Bestimmung des Menschen“, das mit „Zweifel“ betitelt ist. Paradoxerweise wird hier ein philosophisches System entworfen, das der Lehre von Fichte diametral entgegengesetzt ist. Es handelt sich um die These einer völlig determinierten Welt, von deren Kräften das Subjekt komplett bestimmt ist. Diese Lehre wird so unvermittelt präsentiert, dass der Leser ohne Kenntnis anderer Werke Fichtes zunächst glauben könnte, hier von der persönlichen Ansicht des Autoren zu lesen.
Der theoretische Widerspruch zwischen den Büchern I und II wird das Thema dieser Arbeit sein. Zunächst werden die Argumentationslinien und die wichtigsten Thesen der beiden Bücher besprochen und verglichen. Im Anschluss wird erörtert, welchen Zweck Fichte damit verfolgte, offensichtlich falsche Theorien im ersten Buch zu vertreten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zweifel - Das erste Buch der „Bestimmung des Menschen"
- Wissen - Das zweite Buch der „Bestimmung des Menschen"
- Die Bedeutung der Emotionen beim Übergang vom ersten zum zweiten Buch
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die ersten beiden Bücher von Johann Gottlieb Fichtes „Die Bestimmung des Menschen" und untersucht den Widerspruch zwischen den darin präsentierten philosophischen Systemen. Ziel ist es, den Zweck Fichtes zu ergründen, im ersten Buch eine deterministische Weltanschauung zu entwerfen, um sie im zweiten Buch durch eine idealistische Erkenntnistheorie zu widerlegen.
- Der Determinismus im ersten Buch
- Die idealistische Erkenntnistheorie im zweiten Buch
- Die Rolle der Emotionen im Erkenntnisprozess
- Der Zusammenhang zwischen den ersten beiden Büchern
- Die Bedeutung von Fichtes „Bestimmung des Menschen" für die Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Werk „Die Bestimmung des Menschen" als Fichtes Versuch dar, seine Transzendentalphilosophie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Buch wird in drei Bücher unterteilt, wobei das erste Buch „Zweifel" einen deterministischen Weltentwurf präsentiert, der im zweiten Buch „Wissen" durch eine idealistische Erkenntnistheorie widerlegt wird. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Analyse des theoretischen Widerspruchs zwischen den ersten beiden Büchern.
Zweifel - Das erste Buch der „Bestimmung des Menschen"
Das erste Buch beginnt mit einem Ich-Erzähler, der eine empiristische Erkenntnistheorie entwickelt. Durch die Analyse der Bestimmung von Gegenständen gelangt er zur These einer deterministischen Kraft, die alle Ereignisse der Welt, einschließlich des menschlichen Denkens und Handelns, bestimmt. Diese These führt zu einer Auflösung aller Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen, was das Ich in eine tiefe emotionale Krise stürzt.
Wissen - Das zweite Buch der „Bestimmung des Menschen"
Das zweite Buch beginnt mit einem Dialog zwischen dem Ich und einem Geist, der die im ersten Buch aufgeworfenen Probleme von einem neuen Ausgangspunkt aus zu lösen versucht. Die zentrale These des zweiten Buches ist der Idealismus: Das Ich nimmt nicht die äußere Realität wahr, sondern lediglich seine eigenen Empfindungen und Vorstellungen. Durch die Reflexion auf das eigene Bewusstsein löst sich die äußere Realität auf, wodurch der Mensch von der deterministischen Kraft befreit wird. Allerdings führt diese Auflösung der Realität zu einem neuen Problem: Die Vorstellungswelt des Ichs erscheint als bloßer Schatten einer wirklichen Realität, was das Ich in eine neue Krise stürzt.
Die Bedeutung der Emotionen beim Übergang vom ersten zum zweiten Buch
Um das Problem der Existenzberechtigung des ersten Buches zu lösen, wird die Vorrede zur „Bestimmung des Menschen" herangezogen. Fichte betont, dass die Thesen des Werkes in der Reihenfolge präsentiert werden, wie sie sich „dem kunstlosen Nachdenken entwickeln" würden. Der Leser soll sich in das Ich hineinversetzen und die emotionalen Reaktionen auf die verschiedenen Thesen nachvollziehen. Die emotionale Verzweiflung des Ichs am Ende des ersten Buches ist ein entscheidender Faktor für den Übergang zum zweiten Buch, da sie den Wunsch nach einer Lösung für das Problem der Freiheit und Selbstbestimmung hervorruft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Bestimmung des Menschen", die Transzendentalphilosophie, den Determinismus, den Idealismus, die Erkenntnistheorie, die Rolle der Emotionen im Erkenntnisprozess und die Freiheit des Menschen. Die Arbeit untersucht den Widerspruch zwischen den ersten beiden Büchern von Fichtes „Die Bestimmung des Menschen" und analysiert die Bedeutung der Emotionen für den Erkenntnisprozess. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Fichte durch die Präsentation von zunächst falschen Thesen den Leser zum Nachdenken und zur Entwicklung einer neuen, umfassenderen Sichtweise auf die Welt anregt.
- Citar trabajo
- Dennis Hogger (Autor), 2014, Vom Zweifel zum Wissen. Die ersten beiden Bücher von Fichtes "Bestimmung des Menschen", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272254