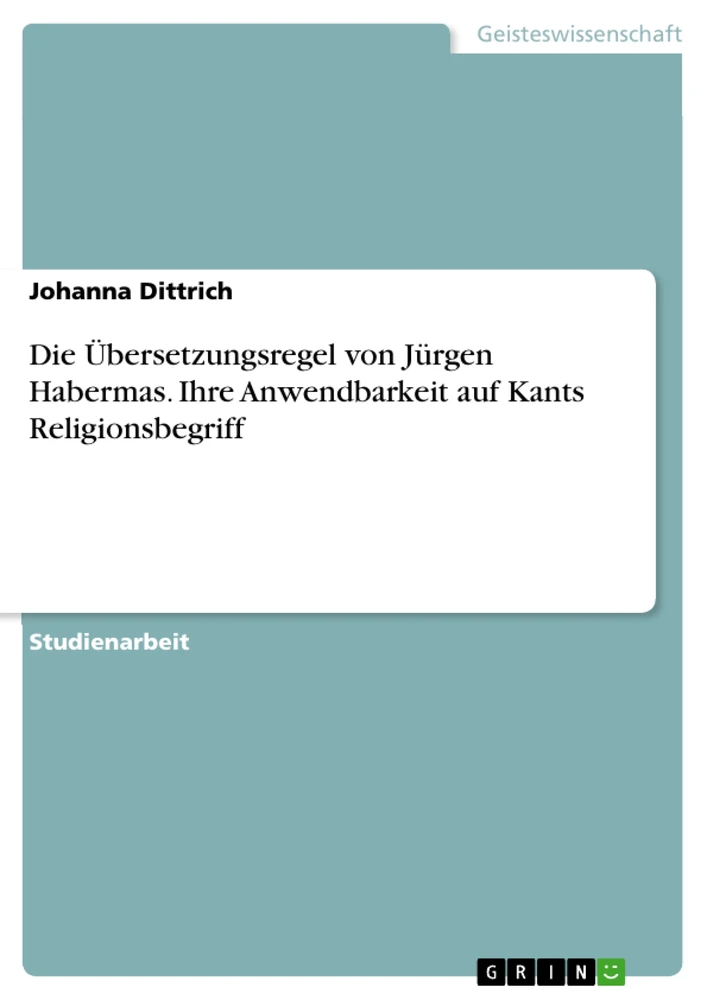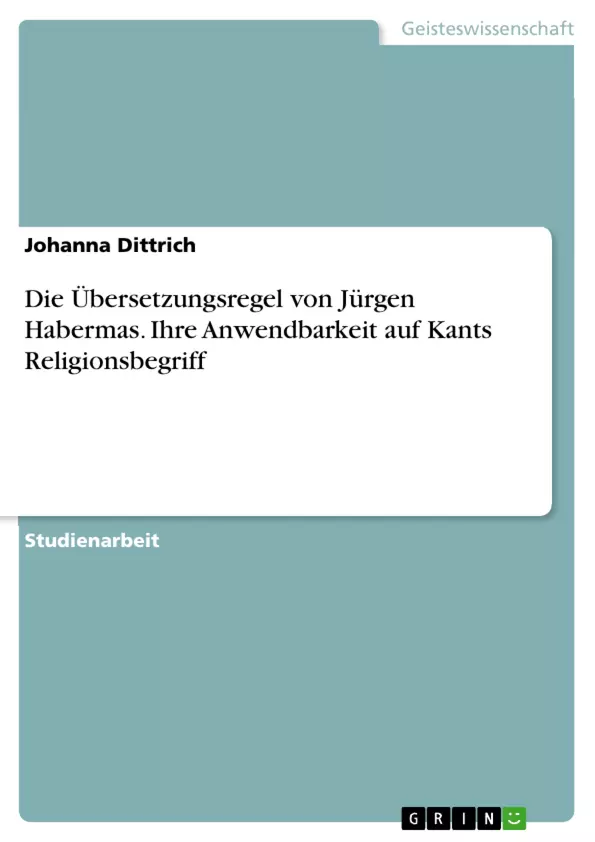In dieser Arbeit werden zwei große Philosophen einander gegenübergestellt. Der eine lebte in aufklärerischen Zeiten, in denen sich die Menschen gerade bewusst werden, dass sie sich von Religion emanzipieren können und wollen. Der andere wirkt in einer säkularisierten Welt, in der der Wunsch nach Antwort über die Fragen „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ und „Warum Männer schlecht zuhören und Frauen schlecht einparken“ hinausgeht. „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ und „Glauben und Wissen“ befassen sich mit religiöser Sprache. War Luther ein Revolutionär, der gegen alle
Widerstände die biblischen Texte ins Deutsche übersetzte, um sie zu demokratisieren; so wagten Kant und Habermas, eine inhaltliche Übertragung des Wort Gottes.
Kant behauptet, dass sich religiöse Begriffe auf eine vernünftige Begründung zurückführen lassen und Habermas nennt profane Themen, die religiöser Artikulationskraft bedürfen.
Fragen, die nicht beantwortet werden:
Wollte Kant den Frommen Vernunft beibringen und Habermas die Religion säkularisieren?
Wollte Habermas die Säkularisierten religiosisieren und Kant die Vernünftigen fromm machen?
Fragen, die beantwortet werden:
Was meint Habermas mit seiner Übersetzungsregel?
Welche Übersetzungsbeispiele nennt er?
Welche Übersetzungen versucht Kant in seiner Religionsschrift?
Diesen Fragen werden die ersten drei Kapitel der Arbeit gewidmet. Unter Zuhilfenahme vielfältiger Literatur und dem Zu-Worte-kommen einiger Kritiker wird sich dem Thema der
Übersetzung biblischer Inhalt genähert. Das Ziel dieser Arbeit ist die Gegenüberstellung der Übersetzungen Habermas’ mit denen Kants. Dazu werden vier zentrale Übersetzungen Kants
erläutert. Denen werden vier Übersetzungen der gleichen Motive jedoch im Sinne Habermas’ gegenübergestellt. Anhand dieses Vergleiches kann veranschaulicht werden, in welchen Punkten Kant im Sinne von Habermas übersetzt. Diese Überlegung kann Anlass sein, das Potential des ganz persönlichen eigenen Ausdrucks zu fassen. Dann heißt es vielleicht bald nicht mehr: Ich sehe was, was du nicht siehst! sondern: ich sage was, das du nicht sagst!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Habermas,,Glauben und Wissen“.
- Habermas' Übersetzungsregel....
- Die Bedeutung der habermasschen Übersetzungsregel.
- Von Habermas genannte Übersetzungsbeispiele
- Reaktionen der Zeitgenossen
- Kant,,Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“.
- Die Übersetzungsfrage.
- Welche Begriffe versucht Kant zu übersetzen?
- Sünde = Das Böse
- Gnade = Selbsterlösung.
- Jesus = Die Idee des Guten
- Reich Gottes = Republik unter Tugendgesetzen
- Zusammenführung
- Eigene Übersetzungen nach der Habermasschen Regel..\li>
- Reich Gottes
- Gnade
- Sünde.
- Jesus
- Wendet Kant die habermassche Übersetzungsregel an?
- Schluss...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Übersetzung religiöser Sprache in der Philosophie von Immanuel Kant und Jürgen Habermas. Sie untersucht, wie beide Denker die Übertragung von religiösen Begriffen in eine säkulare Sprache angehen.
- Habermas' Übersetzungsregel und ihre Bedeutung für die säkulare Gesellschaft
- Kants Versuche, religiöse Begriffe wie Sünde, Gnade, Jesus und Reich Gottes in rationale Kategorien zu übersetzen
- Der Vergleich zwischen den Übersetzungsansätzen von Habermas und Kant
- Die Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft und das Verhältnis von Religion und Vernunft
- Die Bedeutung des eigenen, persönlichen Ausdrucks im Kontext der Übersetzung religiöser Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den historischen und philosophischen Kontext der Arbeit. Es stellt die beiden Denker Kant und Habermas vor und skizziert die Frage der Übersetzung religiöser Sprache im Kontext der Säkularisierung.
Das zweite Kapitel widmet sich Habermas' Übersetzungsregel. Es untersucht die Bedeutung dieser Regel und die von Habermas genannten Übersetzungsbeispiele.
Das dritte Kapitel analysiert Kants Versuche, religiöse Begriffe in seiner Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ zu übersetzen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Übersetzung, Religion, Vernunft, Säkularisierung, Habermas, Kant, Übersetzungsregel, Glaube, Wissen, postsäkulare Gesellschaft, Kontingenz, Sinnstiftung, Diskurs, öffentliche Gründe, Würde.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Jürgen Habermas unter seiner „Übersetzungsregel“?
Die Regel besagt, dass religiöse Gehalte in eine allgemein zugängliche, säkulare Sprache übersetzt werden müssen, um im öffentlichen Diskurs wirksam zu werden.
Wie übersetzt Immanuel Kant religiöse Begriffe?
Kant übersetzt Begriffe wie „Sünde“ als „das Böse“, „Jesus“ als „Idee des Guten“ und das „Reich Gottes“ als „Republik unter Tugendgesetzen“.
Worin unterscheiden sich Kant und Habermas in ihrem Ansatz?
Während Kant religiöse Begriffe rein rational begründen will, sieht Habermas in der Religion eine notwendige Artikulationskraft für profane Themen in einer säkularen Welt.
Welche Bedeutung hat die Säkularisierung für diese Theorien?
Beide Denker reagieren auf die Säkularisierung: Kant im Kontext der Aufklärung, Habermas im Kontext einer postsäkularen Gesellschaft, die nach Sinnstiftung sucht.
Was ist das Ziel der Gegenüberstellung beider Philosophen?
Die Arbeit will zeigen, inwiefern Kants rationale Umdeutungen bereits Vorläufer für Habermas' moderne Übersetzungsregel sein könnten.
- Quote paper
- Johanna Dittrich (Author), 2014, Die Übersetzungsregel von Jürgen Habermas. Ihre Anwendbarkeit auf Kants Religionsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272317