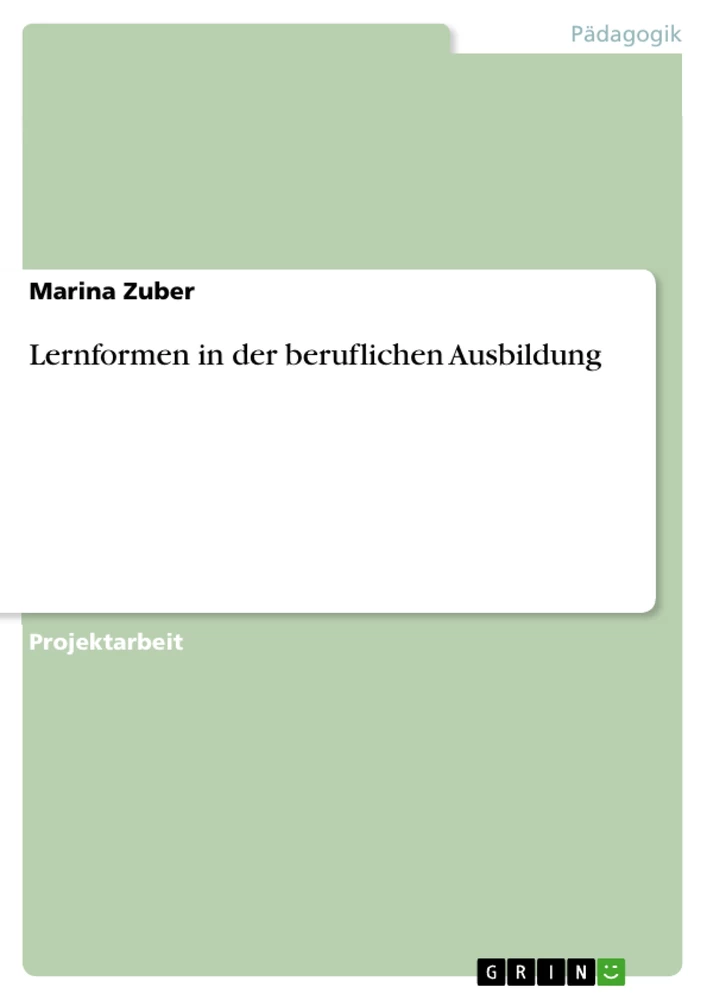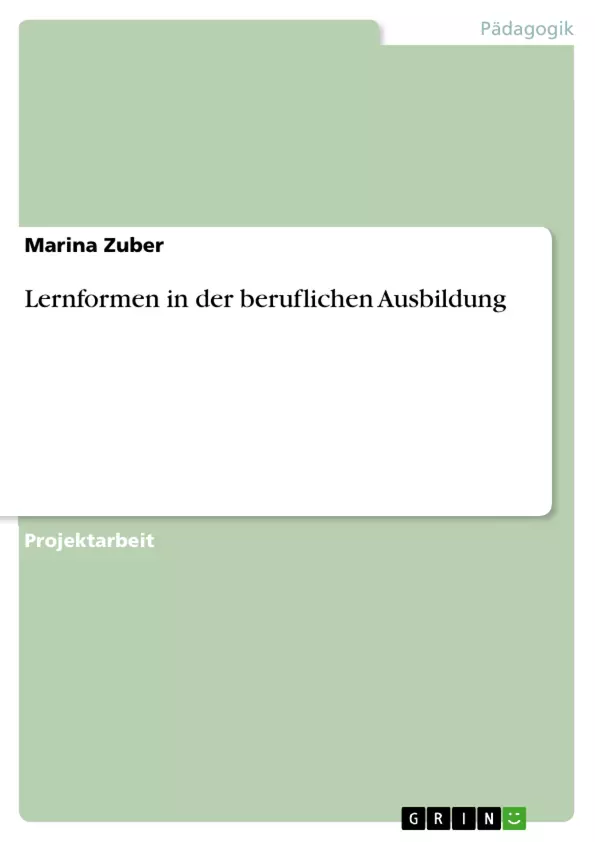Im Zuge dieser Projektarbeit möchte ich auf die verschiedensten Formen des Lernens eingehen. In meiner Tätigkeit als Dozentin und Begleitung von Auszubildenden, vordergründig von Industriekaufleuten während ihrer beruflichen Ausbildung ist es mir ein Anliegen deren Schlüsselqualifikationen auszubauen und zu stärken. Informelles Lernen zu schulen und den Schülern zu zeigen wie man sich stets selbst motiviert.
Die Anforderungen an Auszubildende haben sich in Bezug auf Ihre Handlungskompetenzen im Vergleich von der Industriegesellschaft zur heutigen Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft enorm verändert. Von ihnen wird vor allem mehr Flexibilität und das schnelle Reagieren auf veränderte Situationen verlangt (Euler & Hahn, 2007, S. 267). Somit rücken immer mehr die Kompetenz zum selbstständigen Lernen, sowie die Möglichkeiten dies zu schulen in den Vordergrund.
Im Themenfeld „Lernformen in der beruflichen Ausbildung“ liegt es nahe neue Lernkulturen zu begründen, die den Anforderungen der neuen Welt gerecht werden.
Immer mehr Gewicht werden der Selbstlernkompetenz zu gemessen. Diese ist heute auch in der beruflichen Ausbildung unverzichtbar. Sie zählt zu den Personalkompetenzen und bildet eine solide Basis der Handlungskompetenzen.
Um die Erfüllung der täglichen Arbeitsaufgaben zu bewältigen ist die Medienkompetenz, das heißt der Einsatz von Computern, bestimmten Programmen und dem Internet unerlässlich. Der Umgang mit mediengestützter Hard- bzw. Software fördert die Entwicklungsprozesse von Selbstlernkompetenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Lernen im Wandel der Zeit
- Lernmethoden anhand des Bsp. abH Stützunterricht
- Lern- und Selbstlernkompetenz
- Rollenbezogene Betrachtungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht verschiedene Lernformen in der beruflichen Ausbildung und deren Bedeutung im Wandel der Arbeitswelt. Ziel ist es, die Schlüsselqualifikationen von Auszubildenden zu stärken und die Bedeutung von Selbstlernkompetenz hervorzuheben.
- Entwicklung von Schlüsselqualifikationen in der beruflichen Ausbildung
- Der Wandel von Lernformen im Kontext der modernen Arbeitswelt
- Bedeutung von Selbstlernkompetenz und Medienkompetenz
- Analyse verschiedener Lernmethoden
- Rollenbezogene Betrachtung von Lernprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die auf die verschiedenen Lernformen in der beruflichen Ausbildung eingeht. Es wird der Fokus auf den Ausbau von Schlüsselqualifikationen und die Förderung informellen Lernens gelegt, insbesondere im Kontext des Wandels von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft. Die erhöhte Notwendigkeit von Flexibilität und eigenständigem Lernen wird betont, und es wird die Begründung neuer Lernkulturen als Reaktion auf die veränderten Anforderungen der modernen Arbeitswelt angekündigt.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe, insbesondere den Begriff „Schlüsselqualifikationen“ (auch Soft Skills) und deren Bedeutung im Kontext beruflicher Handlungskompetenzen. Es wird der historische Hintergrund des Begriffs erläutert und die unterschiedlichen, aber verwandten Interpretationen von Schlüsselqualifikationen und Soft Skills abgegrenzt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von übertragbaren Fähigkeiten und ihrer Rolle in der Bewältigung zukünftiger Arbeitsaufgaben. Die Definition nach Prof. Herbert Beck wird vorgestellt, die die Schlüsselqualifikationen als "Schlüssel" zum Erschließen wechselnden Spezialwissens und zur lebenslangen Lernfähigkeit beschreibt.
Schlüsselwörter
Schlüsselqualifikationen, Soft Skills, Selbstlernkompetenz, Lernformen, berufliche Ausbildung, Handlungskompetenz, Medienkompetenz, Lernen im Wandel, Informationsgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit: Lernformen in der beruflichen Ausbildung
Was ist der Gegenstand dieser Projektarbeit?
Diese Projektarbeit analysiert verschiedene Lernformen in der beruflichen Ausbildung und deren Bedeutung angesichts des Wandels der Arbeitswelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung der Schlüsselqualifikationen von Auszubildenden und der Bedeutung von Selbstlernkompetenz.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen, den Wandel von Lernformen im Kontext der modernen Arbeitswelt, die Bedeutung von Selbstlernkompetenz und Medienkompetenz, die Analyse verschiedener Lernmethoden und eine rollenbezogene Betrachtung von Lernprozessen. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und den Kontext des Wandels von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinitionen, Lernen im Wandel der Zeit, Lernmethoden anhand eines Beispiels (abH Stützunterricht), Lern- und Selbstlernkompetenz, Rollenbezogene Betrachtungen und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Wie werden Schlüsselqualifikationen definiert?
Das Kapitel "Begriffsdefinitionen" klärt den Begriff "Schlüsselqualifikationen" (auch Soft Skills) und deren Bedeutung im Kontext beruflicher Handlungskompetenzen. Es werden unterschiedliche Interpretationen abgegrenzt und der Fokus auf übertragbare Fähigkeiten gelegt. Die Definition nach Prof. Herbert Beck, die Schlüsselqualifikationen als "Schlüssel" zum Erschließen wechselnden Spezialwissens und zur lebenslangen Lernfähigkeit beschreibt, wird vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Schlüsselqualifikationen, Soft Skills, Selbstlernkompetenz, Lernformen, berufliche Ausbildung, Handlungskompetenz, Medienkompetenz, Lernen im Wandel und Informationsgesellschaft.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Schlüsselqualifikationen von Auszubildenden zu stärken und die Bedeutung von Selbstlernkompetenz im Kontext des Wandels der Arbeitswelt hervorzuheben. Es geht um die Förderung informellen Lernens und die Anpassung an die Anforderungen der modernen Arbeitswelt.
Welche Lernmethoden werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Lernmethoden, wobei ein Beispiel (abH Stützunterricht) detaillierter behandelt wird. Die Analyse zielt auf die Bewertung der Effektivität verschiedener Ansätze im Kontext der beruflichen Ausbildung ab.
Wie wird der Wandel der Lernformen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt den Wandel der Lernformen im Kontext des Übergangs von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft. Der Fokus liegt auf der erhöhten Notwendigkeit von Flexibilität, eigenständigem Lernen und der Entwicklung neuer Lernkulturen.
- Quote paper
- Marina Zuber (Author), 2014, Lernformen in der beruflichen Ausbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272388