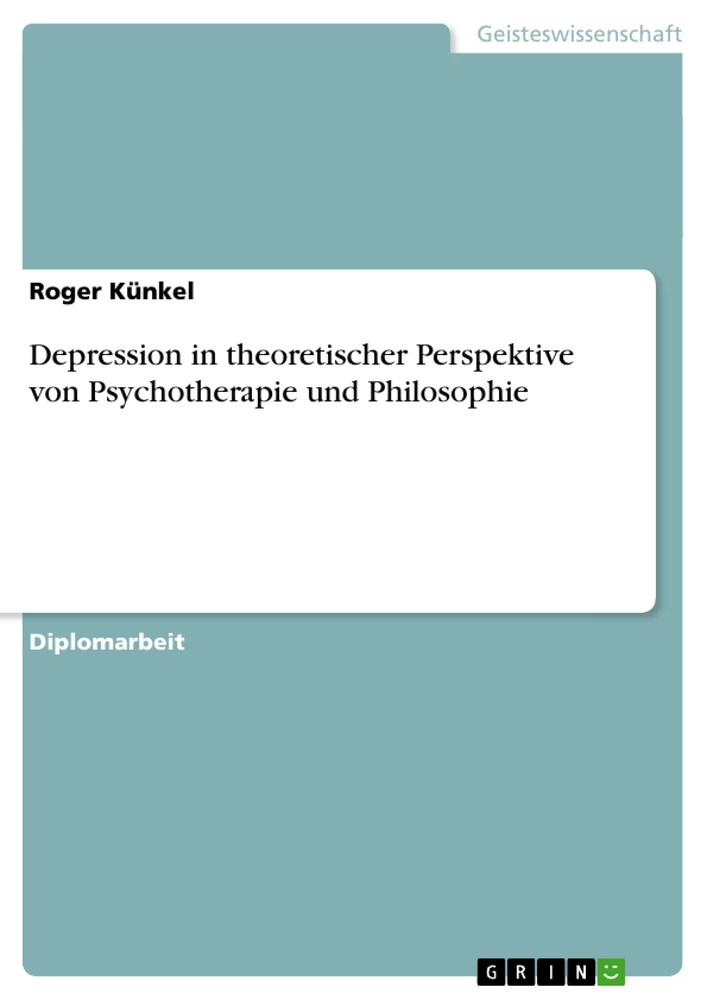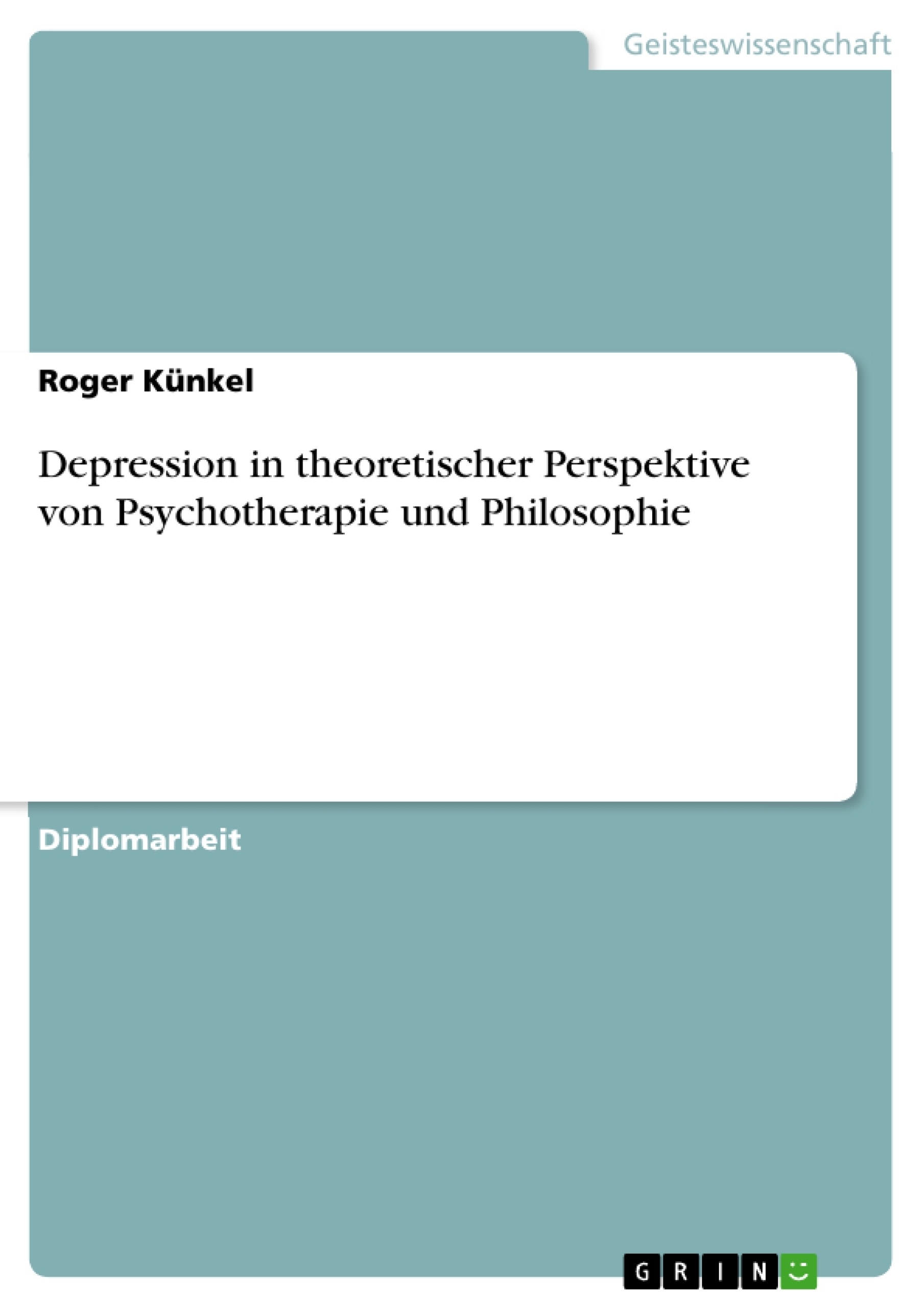Ausgangspunkt und Movens dieser Arbeit war die Datenlage zum Störungsbild der Depression. Die Zahlen gaben zur Verwunderung Anlass. Ein Störungsbild, das so viele Menschen betrifft, und dies in zunehmendem Maß, erfährt, wenn man die gesamten Zahlen zugrunde legt, marginale Abhilfe. Hier tat sich die Fragestellung auf, inwieweit dies störungsbildimmanent bedingt ist oder unter Umständen an den Methoden liegt, die zu dessen Abhilfe herangezogen werden.
Eine Weiterung war das Bedenken, ob vielleicht nicht nur die hier aufgeführten Methoden eine Abhilfe unter Umständen sogar verhindern, sondern ob eine generell verfehlte Betrachtungsweise auf die Depression als solcher wirkliche Hilfeleistungen verstellt, und ob diese Frage dadurch bedingt wird, auf welches Menschenbild die Psychologie bzw. Psychotherapie zurückgreift. Um diese Gedanken zu diskutieren, wird zuerst die oben erwähnte Datenlage herangezogen und diskutiert. Ebenso wird der diagnostische, schulübergreifende Umgang mit Depressionen und ihre Klassifikation im Praxisalltag angesprochen.
Für die weiteren Erwägungen zur Depression im Folgenden ist es erheblich, ebenso eine Begriffsgeschichte zu versuchen und auf das Konzept der Melancholie zu verweisen.
Das Thema der Psychopharmakologie in Bezug auf das Störungsbild der Depression ist insofern relevant, als die philosophisch basierte Kritik hier vehement ansetzt.
Die erste Therapiemethode soll dann die kognitive Verhaltenstherapie sein. Ihre theoretische Grundlage im besonderen Bezug zum Störungsbild der Depression soll dargestellt und expliziert werden. Hier schließt sich eine erste Kritik im Positiven wie im Negativen in Hinblick auf diese Theorie an.
Als zweite Therapiemethode folgt dann die Psychoanalyse in ihrer historischen Entwicklung bzw. Theoriegeschichte in Hinblick auf die Depression und in ihrer praktischen Anwendung. Auch hier schließt sich eine analysierende Kritik in Pro und Contra an.
Das Ende, aber auch das Ziel, stellt der Versuch eines philosophischen Ansatzes zur Depression dar. Dieser Ansatz versucht sich auf Grund einer veränderten Perspektive auf das Subjekt Mensch dem Störungsbild der Depressionen effektiver zu nähern und möchte hiermit auch eine grundsätzliche Kritik am Menschenbild in Psychologie und Psychotherapie vermitteln.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorrede
- 1. Zur Lage der Depression
- Parenthese I: Begriffsgeschichte – Von der Melancholie zur Depression
- Parenthese II: Psychopharmaka
- 2. Depression in der kognitiven Verhaltenstherapie
- 3. Kritik an der Position der kognitiven Verhaltenstherapie
- 4. Depression in der psychoanalytischen Therapie
- 5. Kritik an der Position der psychoanalytischen Therapie
- 6. Ein philosophischer Ansatz
- Parenthese III: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Störungsbild der Depression aus der Perspektive der Psychotherapie und Philosophie. Die Arbeit zielt darauf ab, die bestehenden Behandlungsmethoden zu analysieren und kritisch zu hinterfragen, indem sie die Datenlage zur Häufigkeit und Behandlungserfolg von Depressionen in den Blick nimmt. Sie hinterfragt zudem die zugrundeliegenden Menschenbilder in der Psychologie und Psychotherapie.
- Die Datenlage und der Umgang mit Depressionen in der Praxis
- Die kritische Auseinandersetzung mit kognitiver Verhaltenstherapie und Psychoanalyse
- Ein philosophischer Ansatz zur Depression und Kritik am Menschenbild in der Psychologie
- Begriffsgeschichte der Melancholie und deren Verhältnis zur Depression
- Die Rolle von Psychopharmaka in der Behandlung von Depressionen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorrede: Die Arbeit begründet sich in der überraschend geringen Abhilferate bei Depressionen trotz steigender Fallzahlen. Es wird hinterfragt, ob dies an der Störung selbst oder an den angewendeten Methoden liegt, und ob das zugrundeliegende Menschenbild in Psychologie und Psychotherapie eine Rolle spielt. Die Arbeit analysiert verschiedene Therapieansätze und bietet einen philosophischen Ansatz als alternative Perspektive.
1. Zur Lage der Depression: Dieses Kapitel präsentiert erschreckende Statistiken zur Verbreitung von Depressionen und deren unzureichenden Behandlungserfolgen. Es beschreibt die Heterogenität depressiver Störungen, von leichten Reaktionen bis hin zu psychotischen Melancholien, und benennt diverse Behandlungsmethoden wie Pharmakotherapien, Psychotherapien, EKT und Lichttherapie. Die hohen Kosten und die Suizidgefahr werden hervorgehoben, ebenso wie die Schwierigkeiten bei der Diagnose und die Problematik des ICD-10- und DSM-IV-Systems. Es werden verschiedene Depressionsformen (manische Episoden, depressive Episoden, larvierte Depression, Burn-out-Syndrom, Chronic-Fatigue-Syndrom, postpartale Depression und anaklitische Depression) vorgestellt, deren Symptome und Ursachen diskutiert. Abschließend wird die aktuelle Behandlungspraxis kritisiert, die oft auf Psychopharmaka fokussiert und psychotherapeutische Angebote unzureichend berücksichtigt.
Parenthese I: Begriffsgeschichte – Von der Melancholie zur Depression: Die Parenthese verfolgt die Begriffsgeschichte von Melancholie und Depression. Sie differenziert zwischen dem antiken Verständnis der Melancholie als Störung der Körpersäfte und dem modernen Verständnis der Depression als psychische Erkrankung. Sie beleuchtet die philosophischen Interpretationen der Melancholie, von Hippokrates bis Hegel, und zeigt, wie sich das Verständnis von Melancholie im Laufe der Geschichte gewandelt hat, vom medizinisch-defizitären bis zum philosophisch-kreativen Aspekt. Es wird die Marginalisierung des Begriffs "Melancholie" in der modernen Psychiatrie kritisiert und ein Plädoyer für ein differenzierteres Verständnis der Beziehung zwischen Seele und Körper in Bezug auf Depression und Melancholie gehalten.
Parenthese II: Psychopharmaka: Diese Parenthese befasst sich mit der Geschichte und Wirkungsweise von Psychopharmaka bei der Behandlung von Depressionen. Sie erläutert biologische Modelle, die einen Mangel an Neurotransmittern wie Serotonin und Noradrenalin als Ursache sehen. Die Wirkungsweise von Antidepressiva und die Rolle der Stressachse werden detailliert beschrieben. Es wird auf die verschiedenen Arten von Antidepressiva eingegangen und deren Nebenwirkungen sowie der signifikante Placeboeffekt diskutiert. Der Text kritisiert die starke Einflussnahme der Pharmaindustrie auf die Forschung und die Fokussierung auf schnelle, oft oberflächliche Behandlungen.
2. Depression in der kognitiven Verhaltenstherapie: Dieser Abschnitt beschreibt die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) als verbreitete Therapieform für Depressionen. Er erläutert die grundlegenden Prinzipien der KVT, wie die erlernte Hilflosigkeit, Attributionstheorie und die kognitiven Fehler von depressiven Patienten. Das Therapiemodell von Aaron T. Beck wird vorgestellt und die Behandlungsstrategien der KVT, wie die Veränderung kognitiver Prozesse und der Aufbau befriedigender Aktivitäten, werden detailliert beschrieben. Die KVT wird als eine gegenwarts- und ressourcenorientierte Therapiemethode dargestellt, die im Vergleich zu tiefenpsychologischen Ansätzen weniger zeitintensiv ist.
3. Kritik an der Position der kognitiven Verhaltenstherapie: Dieser Abschnitt kritisiert die reduktionistische Sichtweise der KVT, die die Bedeutung emotionaler Aspekte und individueller Unterschiede vernachlässigt. Es wird bemängelt, dass die KVT auf die Umstrukturierung von Denkinhalten anstatt auf das Denken selbst fokussiert und bestimmte Verhaltensweisen als a priori richtig ansetzt, ohne deren individuelle Wertigkeit zu berücksichtigen. Die Vergabe von "Hausaufgaben" durch den Therapeuten wird als Eingriff in die Selbstbestimmung des Patienten kritisiert, sowie die Unterbewertung emotionaler Aspekte im Vergleich zum Kognitiven.
4. Depression in der psychoanalytischen Therapie: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die psychoanalytische Perspektive auf Depressionen. Er unterscheidet zwischen zwei Formen von Depressionen: Typ I (narzisstischer Modus) und Typ II (Schuldgefühle). Die psychoanalytische Sichtweise auf den depressiven Typus, mögliche Auslöser (Verlust, Kränkung, life events), das Verhältnis von Melancholie und Depression und die Rolle unbewusster Konflikte werden erläutert. Die historischen Modelle der Psychoanalyse (Abraham, Freud, Rado, Adler) und ihre zentralen Konfliktthemen werden dargestellt. Es wird die Behandlung depressiver Störungen aus psychoanalytischer Sicht beschrieben, wobei die Bedeutung der therapeutischen Beziehung und die Bearbeitung unbewusster Konflikte hervorgehoben werden. Abschließend wird die Wirksamkeit von Psychopharmaka in der Akutphase erwähnt.
5. Kritik an der Position der psychoanalytischen Therapie: Dieser Abschnitt kritisiert die starren Entwicklungsmodelle der Psychoanalyse und deren vergangenheitsorientierte Sichtweise. Es wird bemängelt, dass die Psychoanalyse ein statisches Menschenbild annimmt, das der individuellen Flexibilität nicht gerecht wird und oft zu einer Pathologisierung des Individuums führt. Der Text kritisiert den Fokus auf intrapsychische Prozesse und die Vernachlässigung interpersoneller Faktoren.
6. Ein philosophischer Ansatz: Das Kapitel argumentiert für einen philosophischen Ansatz zur Betrachtung von Depressionen. Es betont die Bedeutung philosophischer Denkweisen wie kritischer Reflexion und ethischer Orientierung in der Psychologie und Psychotherapie. Es kritisiert die Naturwissenschaftlichkeit der Psychologie und deren Reduktionismus, der zu einer Vernachlässigung der seelischen Dimension führt. Die Arbeit greift auf die stoische Philosophie und das Werk von Epiktet zurück, um alternative Betrachtungsweisen aufzuzeigen. Der Text argumentiert für ein dreigeteiltes Menschenbild (Körper, Geist, Seele) und sieht in seelischen Verletzungen eine Hauptursache für Depressionen. Die Rolle von Menschenliebe und Mitleid als therapeutische Elemente wird hervorgehoben.
Parenthese III: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Diese Parenthese beschreibt die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers. Sie betont die Bedeutung von Empathie, Akzeptanz und Kongruenz in der therapeutischen Beziehung und das Ziel der Selbstentfaltung des Klienten. Die philosophischen Grundlagen (phänomenologisch-existenzialistisch) und die Indikationskriterien dieser Therapieform werden erklärt.
Schlüsselwörter
Depression, Melancholie, Psychotherapie, Kognitive Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Psychopharmaka, Menschenbild, Philosophie, Ethik, Selbstaktualisierung, Neurotransmitter, Seele, Existenzialismus, Humanismus, Objektivität, Subjektivität, Traumata, Beziehung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Depression aus psychotherapeutischer und philosophischer Perspektive
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht das Störungsbild der Depression aus einer psychotherapeutischen und philosophischen Perspektive. Sie analysiert bestehende Behandlungsmethoden (kognitive Verhaltenstherapie, Psychoanalyse), hinterfragt diese kritisch und bietet einen philosophischen Ansatz als Alternative. Ein zentrales Thema ist die Auseinandersetzung mit dem zugrundeliegenden Menschenbild in der Psychologie und Psychotherapie im Kontext der überraschend niedrigen Abhilferate bei Depressionen trotz steigender Fallzahlen.
Welche Therapieansätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) und die Psychoanalyse ausführlich. Sie beschreibt deren Prinzipien, Behandlungsstrategien und kritisiert deren jeweilige Limitationen. Zusätzlich wird die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers kurz vorgestellt. Ein eigenständiger philosophischer Ansatz, der auf stoischer Philosophie und dem Werk von Epiktet aufbaut, wird als alternative Perspektive präsentiert.
Welche Kritikpunkte werden an der KVT und der Psychoanalyse geübt?
Die KVT wird für ihre reduktionistische Sichtweise kritisiert, die emotionale Aspekte und individuelle Unterschiede vernachlässigt. Der Fokus auf die Umstrukturierung von Denkinhalten anstatt auf das Denken selbst und die Vergabe von "Hausaufgaben" werden als Eingriffe in die Selbstbestimmung des Patienten bemängelt. Die Psychoanalyse wird für ihre starren Entwicklungsmodelle, vergangenheitsorientierte Sichtweise und das statische Menschenbild kritisiert, welches die individuelle Flexibilität nicht berücksichtigt. Der Fokus auf intrapsychische Prozesse und die Vernachlässigung interpersoneller Faktoren werden ebenfalls bemängelt.
Welche Rolle spielen Psychopharmaka in der Arbeit?
Die Arbeit widmet sich der Geschichte und Wirkungsweise von Psychopharmaka bei der Behandlung von Depressionen. Sie erläutert biologische Modelle, die einen Mangel an Neurotransmittern als Ursache sehen, beschreibt die Wirkungsweise von Antidepressiva und deren Nebenwirkungen, und diskutiert den Placeboeffekt. Kritisiert wird der starke Einfluss der Pharmaindustrie auf die Forschung und die Fokussierung auf schnelle, oberflächliche Behandlungen.
Welche philosophischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit argumentiert für einen philosophischen Ansatz, der kritische Reflexion und ethische Orientierung in der Psychologie und Psychotherapie betont. Sie kritisiert die Naturwissenschaftlichkeit der Psychologie und deren Reduktionismus. Sie greift auf die stoische Philosophie und das Werk von Epiktet zurück, um alternative Betrachtungsweisen aufzuzeigen und argumentiert für ein dreigeteiltes Menschenbild (Körper, Geist, Seele), wobei seelische Verletzungen als Hauptursache für Depressionen gesehen werden. Die Rolle von Menschenliebe und Mitleid als therapeutische Elemente wird hervorgehoben.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit plädiert für ein differenzierteres Verständnis von Depressionen, das sowohl biologische, psychologische als auch philosophische Aspekte berücksichtigt. Sie kritisiert die Dominanz naturwissenschaftlicher Ansätze in der Behandlung von Depressionen und schlägt einen ganzheitlicheren Ansatz vor, der die seelische Dimension stärker in den Blick nimmt und die Selbstbestimmung des Patienten respektiert. Die niedrige Abhilferate bei Depressionen wird mit den angewendeten Methoden und dem zugrundeliegenden Menschenbild in Frage gestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Depression, Melancholie, Psychotherapie, Kognitive Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Psychopharmaka, Menschenbild, Philosophie, Ethik, Selbstaktualisierung, Neurotransmitter, Seele, Existenzialismus, Humanismus, Objektivität, Subjektivität, Traumata, Beziehung.
- Citar trabajo
- Roger Künkel (Autor), 2010, Depression in theoretischer Perspektive von Psychotherapie und Philosophie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272486