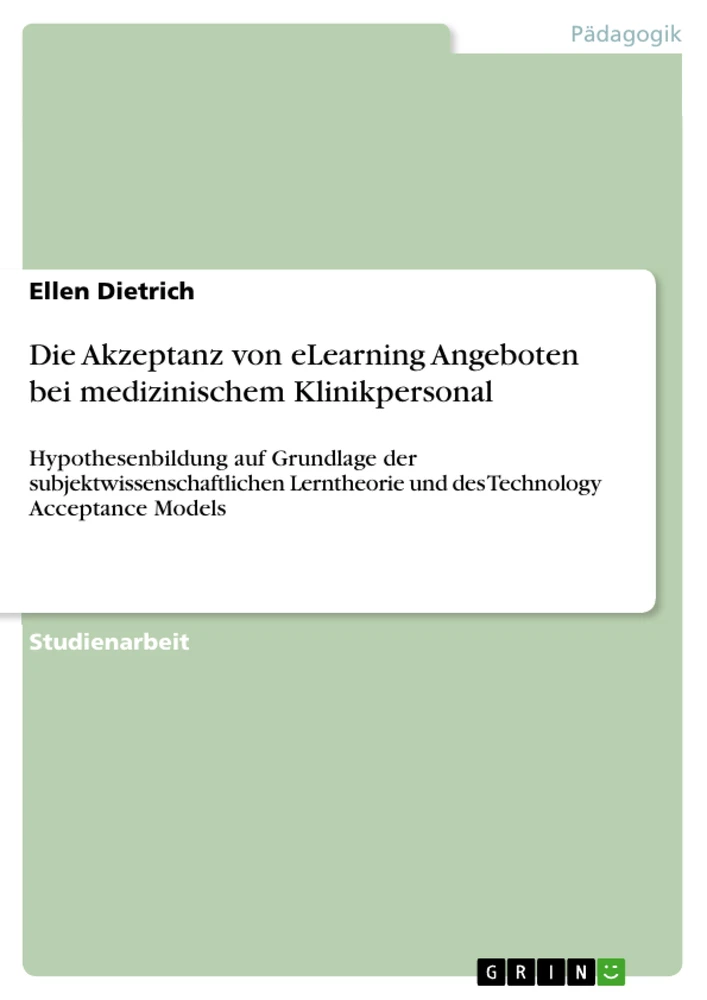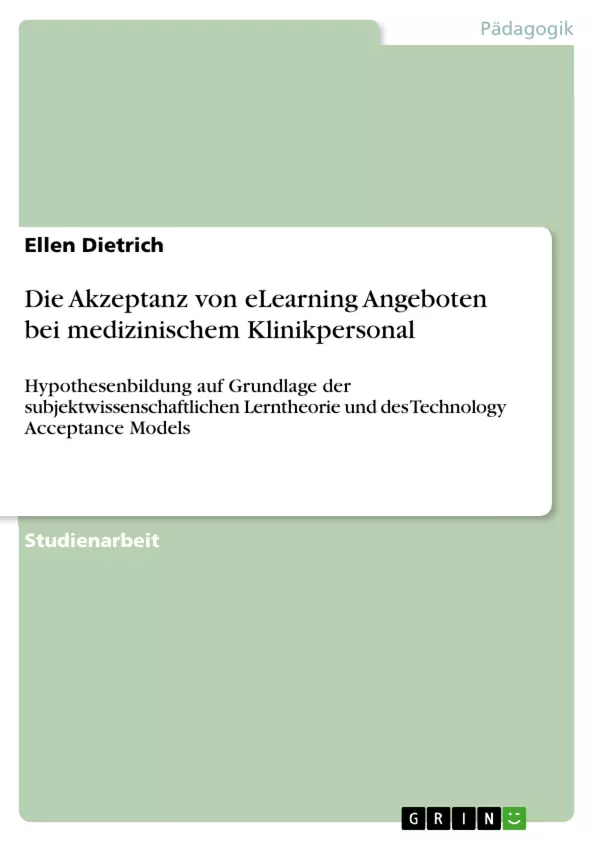Der Fort- und Weiterbildungsbedarf in deutschen Krankenhäusern steht im Zeichen besonderer Herausforderungen der Personalentwicklung und des betrieblichen Bildungsmanagements. Drei Gründe untermauern diese Aussage, die detailliert und statistisch aufbereitet bei Deloitte (2013) und Jung (2009) nachzulesen sind :
Zunächst ist der sehr hohe Bedarf an Fort- und Weiterbildungen selbst zu nennen. Das liegt schlicht an der kurzen Halbwertszeit medizinischen Wissens. Darüber hinaus bringen aber auch neue oder veränderte Versorgungsrichtlinien einen regelmäßigen
Fortbildungsbedarf mit sich.
Als zweiter Grund können gesundheitspolitische Entscheidungen angeführt werden, wie zum Beispiel die Umstellung der Leistungsvergütung auf ein Fallpauschalensystem seit den frühen 2000er Jahren. Sie erhöhen den Kostendruck auf Klinikbetreiber und ziehen zur Steigerung der Kosteneffizienz ein Maßnahmenbündel zur Rationalisierung der Arbeitsprozesse nach sich. Gleichzeitig müssen Kliniken, um im Konkurrenzkampf
der Branche zu bestehen, ein hohes Maß an Behandlungsqualität nachweisen. Für Mitarbeiter bedeutet dies, dass sie ihr Wissen und ihre Handlungskompetenz möglichst effizient zum Einsatz bringen sollten, dass sie sich darüber hinaus im Ablauf der
Arbeitsprozesse auskennen und dabei gleichzeitig eine hohe Expertise entwickeln müssen. Die Notwendigkeit von Fortbildungen ist auch hier offensichtlich.
Eine dritte Herausforderung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs in deutschen Krankenhäusern stellt der zunehmende Fachkräftemangel vor allem im Bereich des Pflegedienstes
und des ärztlichen Dienstes dar. Der notwendige Einsatz angelernter Aushilfen und die Integration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland gehen oft mit erhöhtem Einarbeitungs- und damit Schulungsbedarf einher.
Bei Klinikverantwortlichen ist das Interesse, diesen dauerhaft umfangreichen Bedarf an Fort- und Weiterbildungen möglichst kostenschonend zu decken, verständlicherweise groß. Der Einsatz von zeitflexiblen, ortsunabhängigen und damit im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen kostengünstigeren eLearning Kursen scheint in diesem Zusammenhang große Vorteile mit sich zu bringen (vgl. Management & Krankenhaus 2012, Succi & Cantoni 2008, S. 39). [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Erläuterung zentraler Begriffe
- 2.1 eLearning
- 2.2 Akzeptanz
- III. Die subjektwissenschaftliche Lerntheorie (SLT) nach Holzkamp
- 3.1 Ausgewählte Aspekte der SLT
- 3.1.1 Begründetes Lernen
- 3.1.2 Operative und thematische Lernaspekte
- 3.1.3 Bewusstes Lernhandeln
- 3.1.4 Handlungsspielräume im Spannungsfeld lebensweltlicher Bedingungen
- 3.1.5 Expansives und defensives Lernen
- 3.1 Ausgewählte Aspekte der SLT
- IV. Das Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis
- 4.1 Kernaussagen des TAM
- 4.2 Komponenten des TAM
- V. Integration von subjektiven Variablen in das TAM
- 5.1 Lerngründe
- 5.2 Intendiertes Lernen
- 5.3 Handlungsspielräume
- 5.4 Expansive und defensive Akzeptanz
- VI. Fazit
- VII. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Akzeptanz von eLearning-Angeboten bei medizinischem Klinikpersonal. Ziel ist es, die subjektwissenschaftliche Lerntheorie nach Holzkamp (1995) auf die Akzeptanz von eLearning anzuwenden und anhand des Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis (1986) Hypothesen zu entwickeln, die den Einfluss subjektiver Variablen auf die Akzeptanz von eLearning beleuchten.
- Subjektwissenschaftliche Lerntheorie
- Technology Acceptance Model (TAM)
- Akzeptanz von eLearning
- Begründetes Lernen
- Handlungsspielräume
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Fort- und Weiterbildungsbedarf in deutschen Krankenhäusern dar und beleuchtet die Herausforderungen der Personalentwicklung und des betrieblichen Bildungsmanagements. Sie erläutert die Relevanz von eLearning-Angeboten im Kontext des hohen Weiterbildungsbedarfs und der Kosteneffizienz in der Kliniklandschaft. Abschließend wird die zentrale Forschungsfrage nach der Relevanz der Mitarbeiterakzeptanz für den Erfolg von eLearning-Angeboten eingeführt.
- Kapitel II. Erläuterung zentraler Begriffe: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe eLearning und Akzeptanz im Kontext der vorliegenden Arbeit. Es werden verschiedene Merkmale von eLearning sowie die unterschiedlichen Perspektiven auf Akzeptanz im Bereich von Lernprozessen beleuchtet.
- Kapitel III. Die subjektwissenschaftliche Lerntheorie (SLT) nach Holzkamp: Dieses Kapitel stellt die subjektwissenschaftliche Lerntheorie (SLT) von Klaus Holzkamp vor und beleuchtet relevante Aspekte für die Untersuchung der Akzeptanz von eLearning. Es werden Konzepte wie begründetes Lernen, operative und thematische Lernaspekte, bewusstes Lernhandeln, Handlungsspielräume und expansives sowie defensives Lernen erläutert.
- Kapitel IV. Das Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis: Dieses Kapitel stellt das Technology Acceptance Model (TAM) von Fred Davis vor und erläutert dessen Kernaussagen und Komponenten. Das TAM dient als theoretischer Rahmen für die Analyse der Akzeptanz von eLearning.
- Kapitel V. Integration von subjektiven Variablen in das TAM: In diesem Kapitel werden die in Kapitel III vorgestellten Aspekte der SLT in das TAM integriert. Die Integration dient dazu, Hypothesen zu entwickeln, die die Bedeutung subjektiver Variablen für die Akzeptanz von eLearning-Angeboten erklären.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Akzeptanz von eLearning-Angeboten bei medizinischem Klinikpersonal. Schlüsselbegriffe sind subjektwissenschaftliche Lerntheorie, Technology Acceptance Model, begründetes Lernen, Handlungsspielräume, expansives und defensives Lernen, sowie die Integration subjektiver Variablen in das TAM.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist eLearning für Kliniken so attraktiv?
Es ist zeitflexibel, ortsunabhängig und kostengünstiger als Präsenzveranstaltungen, was bei hohem Kostendruck und Fachkräftemangel vorteilhaft ist.
Was ist die subjektwissenschaftliche Lerntheorie (SLT)?
Eine Theorie von Klaus Holzkamp, die Lernen als begründetes Handeln aus der Perspektive des Subjekts betrachtet.
Was besagt das Technology Acceptance Model (TAM)?
Das TAM von Fred Davis erklärt die Akzeptanz von Technologien primär durch die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit.
Was ist der Unterschied zwischen expansivem und defensivem Lernen?
Expansives Lernen zielt auf die Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten ab, während defensives Lernen eher der Vermeidung von Nachteilen dient.
Wie werden SLT und TAM in dieser Arbeit verknüpft?
Die Arbeit integriert subjektive Variablen wie Lerngründe und Handlungsspielräume in das TAM, um die Akzeptanz bei Klinikpersonal besser zu erklären.
- Quote paper
- Ellen Dietrich (Author), 2014, Die Akzeptanz von eLearning Angeboten bei medizinischem Klinikpersonal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272535