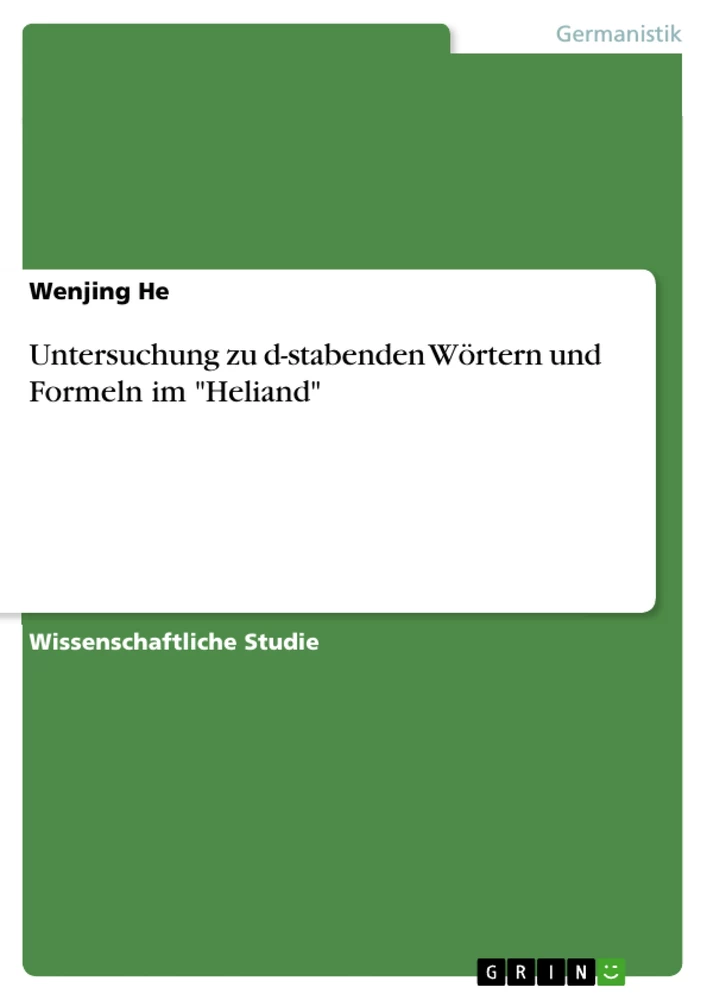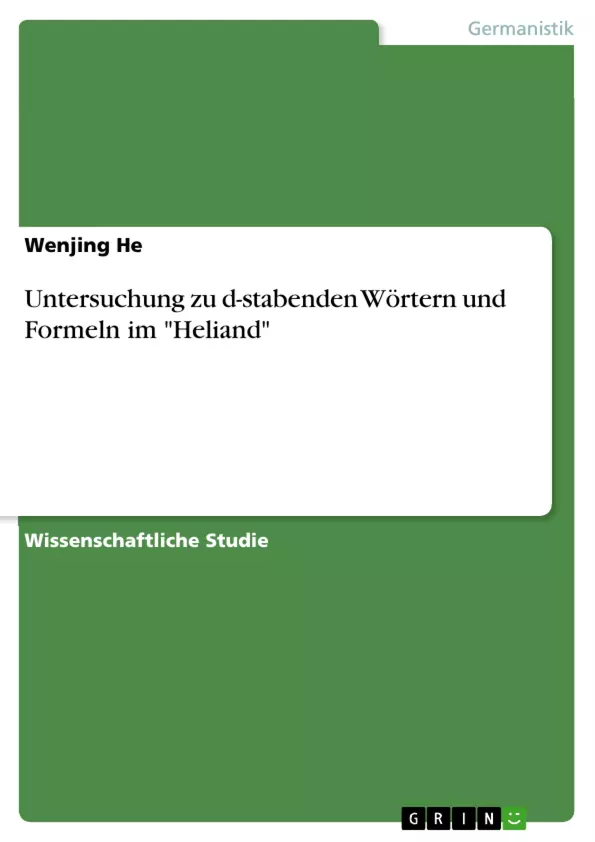In dieser Arbeit werden ausschließlich d-stabende Wörter des ganzen Heliand untersucht und die Formeln für die stabenden und mitstabenden Wörter des Stabreimverses verzeichnet.
INHALTSVERZEICHIS
1. Einleitung
2. Untersuchung zu den d -stabenden Wörtern und Formeln im Heliand
2.1 Begriffserklärungen
2.2 Überblick zu den d -Stäben im Heliand
2.3 Analyse zu den einzelnen Wortstämmen in den d -stabenden Versen
3. Zusammenfassung
1. Einleitung
„27 drohtin diurie | eftho derb=i thing“(Sievers 1878: S. 8)
„53 uuið dernero duualm. | Than habda thuo drohtin god“(Sievers 1878: S. 9)
„83 diuridon ûsan drohtin: | ni uueldun derb=eas uuiht“(Sievers 1878: S. 10)
„116 hiet that hie im ni andriede: | `thîna dâdi sind,' quathie“ (Sievers 1878: S. 12) „140 drohtines engil, | endi im thero dâdeo bigan“ (Sievers 1878: S. 14)
Die fünf Belege wurden aus der altgermanischen Bibeldichtung „Heliand“ zitiert. Auffällig ist, dass die fünf Beispiele Stabreimverse sind, und zwar haben sie die d - anlautenden Wörter miteinander gestabt. Hoffmann hat in seinem Aufsatz „Stabstellung, Hakenstil und Verstypenwahl in den Langzeilen des Heliand“ geschrieben, dass der Stabreim als das wichtigste Merkmal des altgermanischen Verses bekannt sei und zwei Kurzverse durch den gleichen Anlaut stark betonter Silben zur Langzeile verbinde.1
Der Germanist Ernst Hellgardt hat in seinem Aufsatz „Stab und Formel im Heliand. Sehr vorläufige Bemerkungen zu den Möglichkeiten eines Stabreimverzeichnisses“ (2009) den bisherigen Forschungsstand zum Thema Heliand zusammengefasst; und zwar wurde für die Taktrhythmik auf die „messende“ Metrik von Andreas Heusler verwiesen. Die Typenlehre der „Altgermenischen Metrik“ von Eduard Sievers zeigt die Konstitution der elementaren Grundlagen jeder Verskunst. Es geht fast ausschließlich um die rhythmische Struktur des Verses in der „Versstruktur des Heliand“ nach Dietrich Hoffmann.2 Aber Hellgardt hat selbst einige Hinweise zu den s -Stäben und Formeln von s -stabenden Wörtern gegeben, insbesondere wurde die Formel der sp -Stäbe im Heliand untersucht.
In dieser Arbeit werden ausschließlich d -stabende Wörter des ganzen Heliand untersucht und die Formeln für die stabenden und mitstabenden Wörter des Stabreimverses verzeichnet. Die zentralen Fragen sind, wie die d -anlautenden Stabwörter und Mitstabwörter miteinander gestabt werden, warum die Wörter miteinander staben und wie sich ein Verzeichnis der d - stabenden und mitstabenden Wörter für den Heliand im Besonderen gestalten lässt. Um diese Fragen beantworten zu können, müssen Verse mit d anlautenden Stabwörtern systematisch mit der poetischen Technik analysiert werden. Dabei muss man einerseits mit sehr vielen statistischen, andererseits mit syntatktisch-semantischen Techniken arbeiten.
Ausgangspunkt war das Vollständige(s) Wörterbuch zum Heliand und zur altsächsischen Genesis (1966) von Sehrt. Als Grundlagen für die Untersuchung zu den d -stabenden Wörtern und Formeln im Heliand werden als allererstes Heliand (1878) von Eduard Sievers und Die Syntax des Heliand (1897) von Otto Behaghel, sowie Die deutsche Versgeschichte (1925, Bd.1) von Andreas Heusler genannt.
2. Untersuchung zu den d -stabenden Wörtern und Formeln im Heliand
2.1 Begriffserklärungen
Der Stabreimvers war primär das Versmaß der mündlichen Dichtung im germanischen Sprachbereich.3 Stabreimvers bedeutet, dass die sinn- und hebungstragenden Wörter miteinander staben, „wenn der Anlaut ihrer Wurzelsilbe, in den germanischen Sprachen in der Regel die Anfangssilbe, derselbe Konsonant oder ein beliebiger Vokal gleicher Quantität ist“.4 Ein „Stabreim ergibt sich bei gleichem konsonantischem Anlaut von zwei oder drei Haupttonsilben in der Langzeile, dagegen auch bei ungleichem vokalischem Anlaut, da alle Vokale miteinander staben können“.5 „Von anlautenden Konsonant als Stab zu fungieren, ausgenommen die Verbindungen sp, st, sk, die nur jede für sich Stabreim bilden“.6 Die alliterierenden Anlaute des Verses werden als Stäbe bezeichnet. „Auf die beiden Halbverse verteilen sie sich entweder nach dem Schema 1:1 oder 2:1.“7 Der Stab des zweiten Halbverses heißt Hauptstab. Es gibt drei Formen des Stabreimverses, nämlich ax/ax, xa/ax und aa/ax. Der Stabreimvers wurde in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts mit der altsächsische Bibeldichtung (Heliand und Genesis) in größerem Ausmaß literarisch.8
2.2 Überblick zu dend -Stäben im Heliand
Nun versuche ich die vollständige Sammlung von Heliandversen mit d -stabenden Wörtern zu betrachten. Die Verse mit entsprechendem gleichem Stab werden nun nach der Folge ihres Vorkommens im Heliandtext aufgelistet. Wegen Platzmangel befindet sich die Liste im Anhang.
Zunächst werden die d -Stäbe mit einem Blick erfasst. Es finden sich 45 mit d- anlautenden Stabwörtern in 206 Versen. Die Wörter, die die gleichen Stämme haben, werden nur einmal gezählt. Anschließend werden die Stabwörter alphabetisch geordnet. Beigefügt ist jedem Stabwort eine Zahl, welche die Häufigkeit angibt, mit der es im Stab gebraucht wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus der Tabelle kann man auf den ersten Blick ersehen, dass drohtin (120), diurian, diuri, diurida, diurða, diurlik, diurliko (47), d â d (46), dôd, d ôð (44), dag, dagauuerk, dagathing (39), (gi-) dôn, duôn, duan, dôan, andôn, farduan (29) mit höherer Frequenz im Stab gebraucht wurden.
Besondere Aufmerksamkeit verdient das Wort drohtin, das mit 120 Belegen der absolute Spitzenreiter auf der Frequenzskala ist und im Stabreimverzeichnis mit seinem Artikel einen Umfang von über 6 Seiten einnimmt. In seinen 120 stabenden Belegen schöpft drohtin reimend den hier aufgelisteten Vorrat an 45 d -Stäben zum größten Teil aus. Es ist nicht erstaunlich, dass das Wort drohtin am häufigsten im Stab vorkommt, weil es mehr als die Hälfte der rd. 680 autonomistischen Christuskennzeichnungen im Heliand gibt und rd. 360 die Herrscherwürde Christi betonen, wie sie in den Wörtern drohtin, hêrro, hebencunig, uualdand o.ä. zum Ausdruck kommt.9 Die Verwendung des Wortes drohtin hat also die Machtfülle und Weisungsgewalt des Heilandes hervorgehoben. Das Wort diurian sowie die Varianten diuri, diurida, diurða, diurlik, diurliko, die eine physische oder geistige Annäherung des Subjekts an das Objekt oder das Gegenteil davon bezeichnen (auch ein häufiges Thema des Heliand), stehen auch häufig im Stab.
2.3 Analyse zu den einzelnen Wortstämmen in dend -stabenden Versen
Die Kombination der verschiedenen Stäbe veranschaulicht die Tabelle auf der folgenden Seite. Aber wegen des Platzmangels kann die ausführliche Tabelle nur im Anhang im großen Format erstellt werden.
Aus der Tabelle kann man entnehmen, dass die am häufigsten belegten d -Wörter drohtin (120) auch am häufigsten miteinander staben, und zwar drohtin mit diurian sowie die Varianten von diurian 31 Mal. Außerdem stabt drohtin fast mit allen d- anlautenden Stabwörtern, außer mit solchen Wörtern wie bidelban, disk, dol, adôgian, driopan, driosan, druht, duncar, durð, (gi)durran, Forduuelan, die auch ganz selten im Stab vorgekommen sind. Doch zeigt drohtin auch die größte Anziehungskraft für den zweithäufigsten Partner d â d; sie haben 20 Mal untereinander gestabt. Auf dem dritten Häufigkeitsrang ist dôd, d ôð , das zeigt wiederum die Anziehungskraft von drohtin, nämlich 18 Bindungen. Danach steht (gi-) dôn / duôn / duan / dôan / andôn / farduan im vierten Rang, es hat 17 Bindungen mit drohtin. Außerdem staben einige Wörter, die ganz selten im Stab gebraucht werden, auch wenig untereinander, sondern haben meistens entweder mit drohtin oder dag oder diurian gestabt. Deshalb wird angenommen, dass je häufiger stabende Wörter auftreten, desto häufiger gehen sie auch untereinander eine Bindung ein, und je weniger stabende Wörter vorkommen, desto weniger staben sie miteinander.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Verteilung der Stabstellung auf die d - stabenden Wörter. Aber aus Platzgründen wird hier auch nur eine verkleinerte Darstellung der Tabelle gezeigt. Die Original- Tabelle befindet sich wieder im Anhang.
Die Tabelle zeigt die Verteilung der Stabposition auf die d - Stäbe. Aus ihr wird ersichtlich, dass das Wort drohtin, das am häufigsten stabt, auch am häufigsten im Hauptstab steht. Ebenso verhält es sich mit dem dreihäufigsten, vierhäufigesten und fünfhäufigsten Wort d â d, dôd/d ôð, dag/dagauuerk/dagathing. Aber dagegen befindet sich das zweithäufigste Wort diurian/diuri/diurida/diurða/diurlik/diurliko in den meisten Fällen nicht im Hauptstab, sondern in der ersten oder zweiten Hebung. Die Wörter, die nur ein Mal im Heliand- Text belegt sind, stehen meistens entweder im Hauptstab (disk, dol, duncar, dur ð) oder in der ersten Hebung (adôgian, driopan, driosan, drokno, gidrôg, druknian). Es gibt viele Möglichkeiten, dass sich häufige Wörter auf der Stabstellung begegnen. Man kann nicht einfach den Schluss ziehen , dass eine hohe Belegfrequenz eines stabenden Wortes seiner Qualifikation für den Hauptstab entspricht. Eine weitere Untersuchung ist hier notwendig.
Nun werden die Verse, in denen die einzelnen Wortstämme vorkommen, wiederum nach der Reihenfolge ihres Auftretens in vollem Wortlaut zusammengestellt.
dag, dagauuerk, dagathing
451 dago endi nahto. | Thô scoldun sie thar êna dâd frummean,
485 dago liob=osto, | that ic mînan drohtin gisah,
515 ac siu thar ira drohtine [uuel] | dages endi nahtes,
954 He dôpte sie dago gihuuilikes | endi im iro dâdi lôg,
978 dôpte allan dag | druhtfolc mikil,
1218 allaro dago [gehuuilikes,] | thar ûsa drohtin uuas
1253 allaro dago gehuuilikes, | drohtin uuelda
1592 diurlîc dôperi, | dago gehuuilicas
1607 Gef ûs dago gehuuilikes râd, | drohtin the gôdo,
1670 thoh gib=id im drohtin god | dago gehuuilikes
1917 {page 74}thea uuilliad alloro dago gehuilikes | te drohtine hnîgan,
2084 drôm drohtines | endi dagskîmon,
2169 alloro dago gehuilikes, | drohtin the gôdo,
2218 dages lioht sehan, | thena the [êr] dôð fornam,
2284 {page 86}{fitt 28}Sô deda the drohtines sunu | dago gehuilikes
2347 {page 88}allaro dago gehuilikes, | is dâdi scauuon,
2480 dages endi nahtes, | endi [gangid] imu [diub=al] fer,
3333 allaro dago gehuilikes: | habde imu diurlîc lîf,
3336 lag imu dago gehuilikes | at them durun foren,
3466 thes daguuerkes forduolon; | sô duot doloro filo,
3498 thea dâdi, thea he sô derb=ea gefrumide, | ac he slehit allaro dago gehuilikes
3584 diurdun [ûsan drohtin,] | thes sie dages liohtes
3628 ac he dago gehuilikes | duod [ôðerhueðer],
3781 allaro dago gehuilikes, | drohtin manno,
3913 `sô ganga imu herod drincan te mi,' quað he, | `dago gehuilikes
4049 an themu [dômes] daga, | than uuerðad fan dôðe quica
4185 that dagthingi garo. | Thô giuuêt imu ûse drohtin forð 4328 driosat endi dôiat | [endi] iro dag endiad,
4360 {page 156}darno mid is dâdiun, | sô kumid the dag mannun,
4698 dôian diurlîco, | [than] ne uuurði gio thie dag cuman,
4909 diurlic [dages lioht,] | than ni uueldun gi mi dôan eouuiht
5067 adêlien te dôðe. | Sie ni mahtun an themu dage finden
5140 an [themu dage derb=ies uuiht | adêlian ne gihôrdin,]
5255 dômos adêldi. | He uuas ôk an themu dage selb=o
5451 thuru thes dernien [dâd] | an dages liohte,
5628 Uuarð] allaro dago druob=ost, | duncar suîðo 5715 an them druob=en dage, | thuo geng im ûses drohtines thegan reduziert
451 dago | dâd,
485 dago | drohtin,
515 drohtine| dages,
954 dago | dâdi,
978 dag | druhtfolc,
1218 dago | drohtin
1253 dago | drohtin
1592 diurlîc dôperi, | dago
1607 dago | drohtin,
[...]
1 Hofmann, Dietrich: Stabstellung, Hakenstil und Verstypenwahl in den Langzeilen des Heliand. Eine metrisch- statistische Studie. In: Niederdeutsches Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Band 117 (1994), S. 7.
2 Ernst Hellgardt (2009), Stab und Formel im Heliand. Sehr vorläufige Bemerkungen zu den Möglichkeiten eines Stabreimverzeichnisses. In: Analecta Septentrionalia. (65), S. 186.
3 Werner Kohlschmidt und Wolfgang Stammler, Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Band 4. 2 Aufl. Walter de Gruyter: Berlin, New York. 1984. S. 183.
4 Jan-Dirk Müller, Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Band 3. Walter de Gruyter: Berlin, New York. 2007. S. 489.
5 Werner Kohlschmidt und Wolfgang Stammler, Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Band 4. 2 Aufl. Walter de Gruyter: Berlin, New York. 1984. S. 188.
6 ibid. S. 188.
7 Eduard Sievers, Altgermanische Metrik. Helle: Max Niemeyer. 1893. S. 37.
8 Werner Kohlschmidt und Wolfgang Stammler, Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Band 4. 2 Aufl. Walter de Gruyter: Berlin, New York. 1984. S. 185.
9 Sowinski, Darstellungsstil und Sprachstil im Heliand. In: Kölner Germanistische Studien. Bd. 21. 1985, S. 273. 4
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Stabreimvers?
Ein Stabreimvers verbindet zwei Kurzverse zu einer Langzeile durch den gleichen Anlaut (Alliteration) der stark betonten Silben. Dies war das primäre Versmaß altgermanischer Dichtung.
Welche Rolle spielen d-stabende Wörter im „Heliand“?
Die Arbeit analysiert systematisch alle Verse, in denen Wörter mit dem Anlaut „d“ (wie drohtin, dâd, dôd) miteinander staben, um die poetische Technik der Bibeldichtung zu verstehen.
Welches Wort kommt am häufigsten im d-Stab vor?
Das Wort „drohtin“ (Herr/Gott) ist mit 120 Belegen der absolute Spitzenreiter, da es in der Christuskennzeichnung des Heliand eine zentrale Rolle spielt.
Was versteht man unter dem „Hauptstab“?
Der Hauptstab ist der erste Stab des zweiten Halbverses. Er gibt den Anlaut vor, mit dem die Stäbe des ersten Halbverses übereinstimmen müssen.
Gibt es feste Formeln für d-Stäbe?
Ja, bestimmte Kombinationen wie „drohtin“ und „diurian“ oder „drohtin“ und „dâd“ treten gehäuft auf und bilden formelhafte Wendungen in der altsächsischen Metrik.
- Quote paper
- Wenjing He (Author), 2010, Untersuchung zu d-stabenden Wörtern und Formeln im "Heliand", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272537