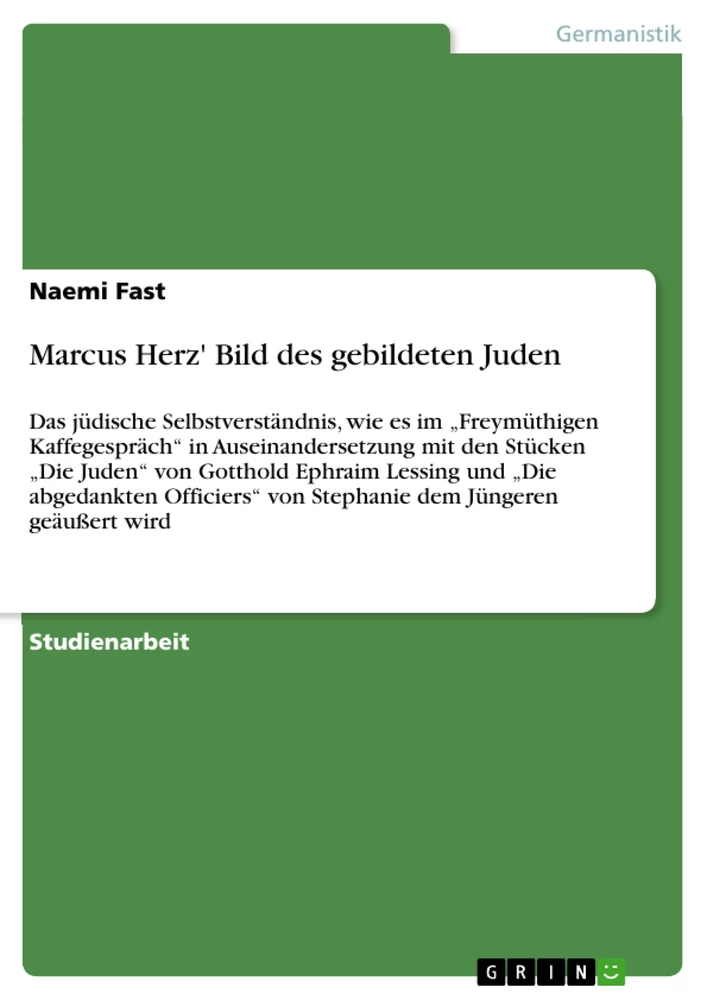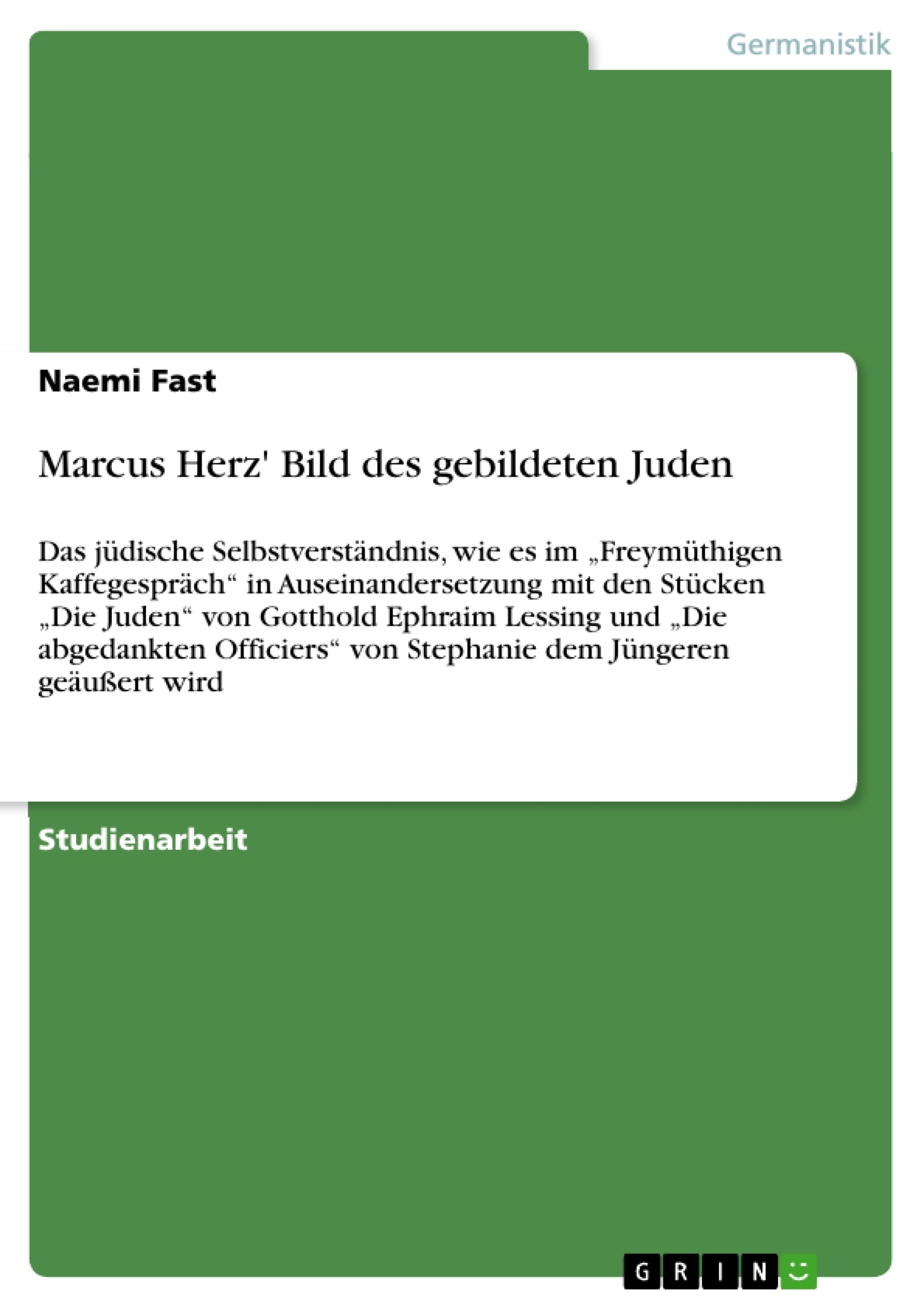Der Jude – ein Typus, der sich durch die Weltanschauung und das Weltverständnis der
Jahrhunderte zieht: der ewig Fremde, der Gehasste, Vertriebene, Hinterlistige, Hässliche,
Habgierige, Betrüger, das Schreckbild in Kunst und Realität. Dieser Vorstellung vom
Juden bediente man sich auch in der Literatur. Spätestens seit der Barockzeit war „Jude“
geradezu gleichzusetzen mit dem habgierigen Wucherer, man brauchte ihn nicht extra
charakterisieren, denn seine Zugehörigkeit zum Judentum erklärte schon seine
Eigenschaften. Man findet derart negativ besetzte Judenfiguren in der gesamten
Weltliteratur, bis hin zu den antisemitischen Werken des 20. Jahrhunderts.1 Eine
Ausnahme bilden die in literarischen Stoffen verarbeiteten biblischen Figur en, deren
Judentum meistens für den Inhalt keine Bedeutung hat und nicht thematisiert wird, sowie
die zu bekehrenden Juden in den kirchlichen Spielen des Mittelalters und der Barockzeit.2
Der Beginn eines Umdenkens zeichnete sich im 18. Jahrhundert ab, als die Vordenker
der Aufklärung den allgemein verbreiteten und nicht sonderlich angefochtenen
Antisemitismus zu hinterfragen begannen. Auf dem Gebiet der deutschen Literatur werden
Ch. F. Gellert und G. E. Lessing allgemein als die beiden großen Schriftsteller betrachtet,
die als Erste positive Judenfiguren zeichneten. In Gellerts „Leben der schwedischen Gräfin
von G***“ (1746) taucht ein Jude auf, dem ein christlicher Graf das Leben rettet und der
dieses auf edle Weise belohnt. Lessing schuf zwei weise und edle Judengestalten, den
Nathan und den namenlosen Reisenden, um den es in folgender Arbeit unter anderem
gehen soll. Der „edle Jude“ wurde zum Objekt öffentlicher Diskussion.
Von jüdischer Seite aus entwickelte sich im 18. Jahrhundert ebenfalls eine
Aufklärungsbewegung, die sogenannte „Haskala“ mit Moses Mendelssohn an der Spitze.
[...]
1 Zu Judenfiguren auf der deutschen Bühne bis zur Aufklärung siehe Jenzsch, Helmut: Die literarische Tradition der
Judenfigur bis zur frühen Aufklärung. In: ders.: Jüdische Figuren in deutschen Bühnentexten des 18. Jahrhunderts. eine
systematische Darstellung auf dem Hintergrund der Bestrebungen zur bürgerlichen Gleichstellung der Juden, nebst einer
Bibliographie nachgewiesener Bühnentexte mit Judenfiguren der Aufklärung. Diss. Hamburg 1971. S. 67-87.
2 Siehe Jenzsch.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen in „Die Juden“ von Gotthold Ephraim Lessing
- 1.1 Inhalt
- 1.2 Aussagen der „deutschen“ Figuren über Juden allgemein
- 1.3 Verhältnis der „deutschen“ Figuren zu dem reisenden Juden
- 1.4 Verhältnis des Juden zu den Deutschen und seine Reaktion auf die geäußerten Vorurteile
- 2. Das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen in „Die abgedankten Officiers“ von Stephanie dem Jüngeren
- 2.1 Die Judenfigur in „Die abgedankten Officiers“
- 2.2 Verhältnis der „deutschen“ Figuren zum Juden
- 3. Das Leitbild des gebildeten Juden im „Freymüthigen Kaffegespräch“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Juden und das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen in zwei Theaterstücken des 18. Jahrhunderts: Lessings „Die Juden“ und Stephanies „Die abgedankten Officiers“. Im Fokus steht die Analyse des gebildeten Juden als Leitbild im „Freymüthigen Kaffegespräch“ von Marcus Herz. Die Arbeit beleuchtet die damaligen antisemitischen Vorurteile und deren Widerlegung durch die literarischen Figuren.
- Darstellung von Juden in der Literatur des 18. Jahrhunderts
- Antisemitische Vorurteile und deren literarische Reflexion
- Das Bild des gebildeten Juden als Gegenentwurf zu antisemitischen Stereotypen
- Der Einfluss der Aufklärung auf die Darstellung von Juden in der Literatur
- Vergleichende Analyse der Judenfiguren in den ausgewählten Stücken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das historische Bild des Juden in der Literatur – als ewig Fremden, Gehasstem etc. – und hebt Lessings und Gellerts positive Darstellung von Juden als Ausnahme hervor. Sie führt den Kontext der jüdischen Aufklärung (Haskala) und Marcus Herz' Rolle als Kritiker ein, der die gängigen negativen Judenbilder hinterfragen wollte.
1. Das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen in „Die Juden“ von Gotthold Ephraim Lessing: Lessings „Die Juden“ präsentiert einen Juden, der den gängigen antisemitischen Stereotypen widerspricht. Der anonyme Reisende rettet einen Baron und lehnt dessen Belohnungsangebote ab. Die Enthüllung seiner jüdischen Identität am Ende unterstreicht Lessings Anliegen, Vorurteile gegenüber Juden zu bekämpfen. Der Baron, obwohl beeindruckt von der Tugend des Juden, ändert sein Urteil über das jüdische Volk nicht grundlegend. Das Stück löste eine öffentliche Debatte über die Glaubwürdigkeit einer solchen positiven Judenfigur aus.
2. Das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen in „Die abgedankten Officiers“ von Stephanie dem Jüngeren: Dieses Kapitel analysiert die Judenfigur in Stephanies Komödie und deren Interaktion mit den christlichen Figuren. Im Mittelpunkt steht die Bewertung dieser Figur durch die „deutschen“ Charaktere und die Frage, ob sie dem gewünschten Bild des jüdischen Volkes entspricht. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den Stereotypen, die in dem Stück präsentiert werden, und deren Auswirkungen auf das Verständnis von Juden in der damaligen Gesellschaft.
3. Das Leitbild des gebildeten Juden im „Freymüthigen Kaffegespräch“: Dieser Abschnitt untersucht das Idealbild des gebildeten Juden, wie es in Herz' Theaterkritik zum Ausdruck kommt. Die Analyse konzentriert sich auf die Diskussion der jüdischen Frauen über die verschiedenen Bühnenstücke und wie sie Lessings positive Darstellung des Juden mit der weniger vorteilhaften Darstellung in Stephanies Stück vergleichen. Die Arbeit beleuchtet, wie Herz versucht, ein positives und aufgeklärtes Bild des Judentums zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Marcus Herz, Gotthold Ephraim Lessing, Gottlieb Stephanie, „Die Juden“, „Die abgedankten Officiers“, „Freymüthiges Kaffegespräch“, Judenbild, Antisemitismus, Aufklärung, Haskala, gebildeter Jude, Assimilation, Vorurteile, literarische Darstellung, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Darstellung von Juden im 18. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Darstellung von Juden und das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen in zwei Theaterstücken des 18. Jahrhunderts: Lessings „Die Juden“ und Stephanies „Die abgedankten Officiers“. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse des gebildeten Juden als Leitbild im „Freymüthigen Kaffegespräch“ von Marcus Herz. Die Arbeit untersucht antisemitische Vorurteile und deren literarische Widerlegung.
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Gotthold Ephraim Lessings „Die Juden“, Gottlieb Stephanies „Die abgedankten Officiers“ und Marcus Herz' „Freymüthiges Kaffegespräch“ (insbesondere die darin enthaltene Theaterkritik).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Juden in der Literatur des 18. Jahrhunderts, antisemitische Vorurteile und deren literarische Reflexion, das Bild des gebildeten Juden als Gegenentwurf zu antisemitischen Stereotypen, den Einfluss der Aufklärung auf die Darstellung von Juden und einen vergleichenden Analyse der Judenfiguren in den ausgewählten Stücken.
Wie wird das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie die Beziehungen zwischen jüdischen und deutschen Figuren in den ausgewählten Stücken dargestellt werden, und analysiert die in diesen Stücken präsenten antisemitischen Vorurteile und deren Auswirkungen auf die Figuren und deren Interaktionen.
Welche Rolle spielt das „Freymüthige Kaffegespräch“?
Das „Freymüthige Kaffegespräch“ dient als Quelle zur Analyse des Leitbilds des gebildeten Juden. Die Diskussionen der jüdischen Frauen über die verschiedenen Bühnenstücke ermöglichen einen Vergleich der positiven Darstellung Lessings mit der weniger vorteilhaften Darstellung in Stephanies Stück und zeigen Herz’ Versuch, ein positives und aufgeklärtes Bild des Judentums zu vermitteln.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die verschiedenen literarischen Darstellungen von Juden im 18. Jahrhundert, die vorherrschenden antisemitischen Stereotypen und die Bemühungen, diese durch aufgeklärte Gegenentwürfe zu widerlegen. Sie beleuchtet den Einfluss der Haskala und der Aufklärung auf diese literarischen Darstellungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Marcus Herz, Gotthold Ephraim Lessing, Gottlieb Stephanie, „Die Juden“, „Die abgedankten Officiers“, „Freymüthiges Kaffegespräch“, Judenbild, Antisemitismus, Aufklärung, Haskala, gebildeter Jude, Assimilation, Vorurteile, literarische Darstellung, 18. Jahrhundert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in eine Einleitung, drei Hauptkapitel (je eines zu Lessing's „Die Juden“, Stephanie's „Die abgedankten Officiers“ und Herz' „Freymüthiges Kaffegespräch“) und einen Schluss gegliedert. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung und Analyse des jeweiligen Textes im Kontext der Forschungsfrage.
- Quote paper
- Naemi Fast (Author), 2003, Marcus Herz' Bild des gebildeten Juden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27263