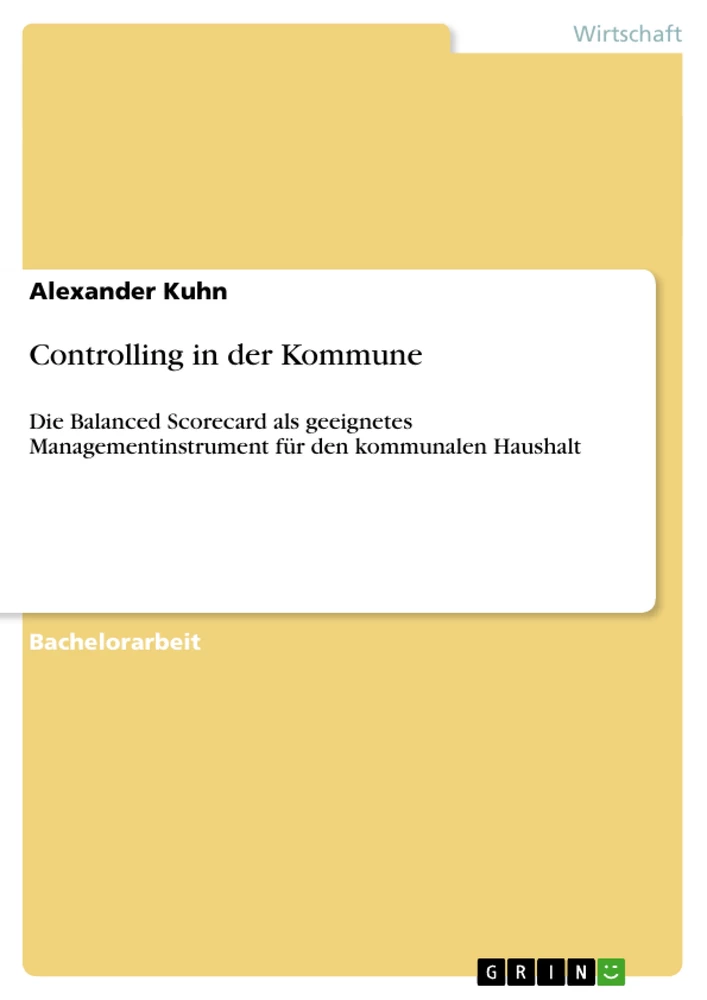Aufbauend auf einer neuen Gemeindehaushaltsordnung, beschloss die Innenministerkonferenz im November 2003 eine grundlegende Reformierung des Haushaltswesens. Das Resultat dieser Reformierung war eine Neuordnung des kommunalen Haushaltsrechts.
Auf Basis des modernen, doppischen Finanzmanagements wurde die Kameralistik abgelöst. Diese umfassende Veränderung der Gesamtstrukturen führte parallel zu einer Verschiebung der Anforderungen an die Planung, Durchführung und Kontrolle der kommunalen Haushalte.
Geplante Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der Effektivität sowie eine stärkere Transparenz. Um diese Vorgaben umsetzen zu können, gehört neben der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen auch eine eigenverantwortliche und aufgabenbezogene Gestaltung der kommunalen Wirtschaftstätigkeiten.
Der Begriff des Controllings tritt in dem Zusammenhang der strategischen Ausrichtung bei dem Aufbau von Kennzahlensystemen in den Vordergrund (5. Handreichung der Kommunen - §12 Gemeindeordnung). Aufgrund grundlegender Neuerungen im Rahmen des Verwaltungsmanagements, richtet sich das Augenmerk auf die verbrauchsorientierte und periodengerechte Bewertung der kommunalen Ressourcen.
Um entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen eine solide und stetige Verwaltungsorganisation gestalten zu können, ist die strategische Ausrichtung des kommunalen Wesens von entscheidender Bedeutung.
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem konzeptionellen Ansatz des strategischen Controllings auf kommunaler Ebene. Nach einer grundlegenden und umfassenden Einführung in das Neue Steuerungsmodell Nordrhein–Westfalens und den Änderungen und Neuerungen der kommunalen Rechnungslegung, wird der Aspekt des Controllings im Verwaltungsmanagement aufgezeigt. Das Instrumentarium der Balanced Scorecard wird als geeignetes Managementinstrument am Beispiel der Stadt Lemgo dargelegt, um die grundlegende Bedeutung von Controlling-Instrumentarien für das kommunale Management zu verdeutlichen. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse und eine Stellungnahme und Einschätzung des Autors bezüglich der Einsatzmöglichkeiten der Balanced Scorecard als mögliches kommunales Steuerungsinstrument...
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement
2.1. Grundgedanke der Reformierung
2.2. Das Neue Steuerungsmodell
2.3. Das Drei-Komponenten-System des Haushaltswesens
2.4. Der Jahresabschluss
2.5. Das Haushaltssicherungskonzept
3. Controlling
3.1. Definition des Controllings und Bedeutung
3.2. Controlling in der Kommune
3.3. Controlling-Instrumente auf kommunaler Ebene
3.3.1. Die SWOT-Analyse
3.3.2. Die BOSTON-Matrix
3.3.3. Kommunale Nutzwertanalyse
4. Die Balanced Scorecard
4.1. Konzeption der Balanced Scorecard
4.2. Die vier klassischen Perspektiven
4.3. Ursachen-Wirkungsbeziehungen
4.4. Strategische Ziele
4.5. Ausgewogenheit
4.6. Messgrößen
4.7. Zielwerte und Maßnahmen
5. Anwendungsbeispiel: StadtLemgo
5.1. Konzept einer Balanced Scorecard für die Kommune
5.2. Organisatorischen Rahmen schaffen
5.3. Strategische Ausrichtung
5.4. Zielvorgaben
5.4. Kommunales Ursachen-Wirkungskonzept
5.5. Messgrößen zu den strategischen Zielen innerhalb der Kommune
5.6. Maßnahmenergreifung
5.7. Kennzahlen
5.8. Berichtswesen
5.9. Der kontinuierliche Einsatz der Balanced Scorecard
6. Zusammenfassung und Perspektive
Anhangsverzeichnis
Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Drei-Komponenten-System
Abbildung 2: Haushaltssituation der Kommunen aus Nordrhein-Westfalen
Abbildung 3: Haushaltss. der Kommunen aus Nordrhein-Westfalen - Karte
Abbildung 4: Wirkungsorientierte Steuerung
Abbildung 5: Darstellung der SWOT-Matrix
Abbildung 6: Darstellung der BOSTON-Matrix
Abbildung 7: Produkt im Zentrum der Planung
Abbildung 8: Aufbau einer Balanced Scorecard
Abbildung 9: Das generische Wertkettenmodell
Abbildung 10: Ursachen-Wirkungskette in der Balanced Scorecard
Abbildung 11: Ursachen-Wirkungskette - Praxisbeispiel
Abbildung 12: Abänderung der BSC für denöffentlichen Bereich
Abbildung 13: SWOT-Matrix für die Stadt Lemgo
Abbildung 14: Zieldefinition
Abbildung 15: Zielfeldermodell für die Stadt Lemgo
Abbildung 16: Finanzperspektive - Praxisbeispiel
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 - Produktbereiche Haushalt
1. Einleitung
Aufbauend auf einer neuen Gemeindehaushaltsordnung, beschloss die Innenministerkonferenz im November 2003[1] [2] eine grundlegende Reformierung des Haushaltswesens. Das Resultat dieser Reformierung war eine Neuordnung des kommunalen Haushaltsrechts.
Auf Basis des modernen, doppischen Finanzmanagements wurde die Kameralistik abgelöst. Diese umfassende Veränderung der Gesamtstrukturen führte parallel zu einer Verschiebung der Anforderungen an die Planung, Durchführung und Kontrolle der kommunalen Haushalte.
Geplante Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der Effektivität sowie eine stärkere Transparenz[3].
Um diese Vorgaben umsetzen zu können, gehört neben der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen auch eine eigenverantwortliche und aufgabenbezogene Gestaltung der kommunalen Wirtschaftstätigkeiten.
Der Begriff des Controllings tritt in dem Zusammenhang der strategischen Ausrichtung bei dem Aufbau von Kennzahlensystemen in den Vordergrund (5. Handreichung der Kommunen - §12 Gemeindeordnung).
Aufgrund grundlegender Neuerungen im Rahmen des Verwaltungsmanagements, richtet sich das Augenmerk auf die verbrauchsorientierte und periodengerechte Bewertung der kommunalen Ressourcen.
Um entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen eine solide und stetige Verwaltungsorganisation gestalten zu können, ist die strategische Ausrichtung des kommunalen Wesens von entscheidender Bedeutung.
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem konzeptionellen Ansatz des strategischen Controllings auf kommunaler Ebene.
Nach einer grundlegenden und umfassenden Einführung in das Neue Steuerungsmodell Nordrhein-Westfalens und den Änderungen und Neuerungen der kommunalen Rechnungslegung, wird der Aspekt des Controllings im Verwaltungsmanagement aufgezeigt.
Das Instrumentarium der Balanced Scorecard wird als geeignetes Managementinstrument am Beispiel der Stadt Lemgo dargelegt, um die grundlegende Bedeutung von Controlling-Instrumentarien für das kommunale Management zu verdeutlichen.
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse und eine Stellungnahme und Einschätzung des Autors bezüglich der Einsatzmöglichkeiten der Balanced Scorecard als mögliches kommunales Steuerungsinstrument.
2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement
2.1. Grundgedanke der Reformierung
Bereits seit Anfang der neunziger Jahre befasst sich die Innenministerkonferenz intensiv mit den Ursachen der strukturellen Probleme der Kommunen: Strukturveränderungen in der Gesellschaft, geringes Wirtschaftswachstum, anhaltende Arbeitslosigkeit, steigende Kosten der Sozialhilfe und zusätzliche Belastungen, geben der Verwaltungsebene einen nur engen, finanziellen Spielraum bei der Haushaltsgestaltung.
Häufig sind Kreditaufnahmen oder auch der Vermögensabbau durch Verkäufe und Steuererhöhungen die Folge, um eine drohende Haushaltskrise zu überwinden. Dies stellt dennoch keine generelle oder langfristige Problemlösung dar.
Eine grundlegende Reformierung des kommunalen Rechnungswesens, die aus dem KGSt[4] -Bericht über das Tilburger Modell 1991 initiiert wurde, erwies sich in diesem Zusammenhang als unausweichlich.[5]
Mit Hilfe der bisherigen Finanzrechnung, der Kameralistik, einer reinen Betrachtung von Einnahmen und Ausgaben, ist es nicht möglich gewesen, eine verbrauchsbezogene, effiziente Kosten-Leistungsstruktur zu entwickeln und somit eine transparente und periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbauches zu ermöglichen.
2.2. Das Neue Steuerungsmodell
Ziel des Neuen Steuerungsmodells (NSM[6] ) ist die Reformierung der Binnenorgnisation der Verwaltung. Neben einer dezentralen Ressourcenverantwortung, der Dienstleistungsorientierung, der Implementierung einer flachen, hierarchischen Struktur und der Erarbeitung von Leitbildern, sind die Einführung einer Kosten-Leistungsrechnung, des Berichtswesen, des Controllings und einem ergebnis- und wirkungsorientierten Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Schwerpunkte derNeuorganisation auf kommunaler Ebene.[7] [8]
Als geeignetes Betriebssystem für die Umstellung des kommunalen Managements, orientiert sich das Neue Steuerungsmodell, aufgrund der Kompatibilität, an dem kaufmännischen Rechnungswesen, der doppelten Buchführung (Doppik).
Zwar wäre eine Erweiterung der Kameralistik für die neu geforderten Ansprüche an die kommunale Rechnungslegung denkbar gewesen, jedoch bringt das Rechnungssystem der Doppik die globale Integrationsfähigkeit, Flexibilität und auch Zukunftssicherheit mit sich und ist bereits ein komplettes und erprobtes Rechnungssystem.
Ebenso ist die Darlegung von Vermögen, Schulden, Erträgen, Aufwendungen und Zahlungsströmen ohne erweiterte Nebenrechnungen möglich und erleichtert im Vergleich zur expandierten Kameralistik das Berichtswesen. Dies führt parallel zu der Möglichkeit des geschlossenen Jahresabschlusses. War es in den neunziger Jahren nicht möglich, ausgelagerte Eigenbetriebe mit im Jahresabschluss zu erfassen, ist durch die Doppik ein konsolidierter Abschluss des Gesamtkonzerns Kommune trotz unterschiedlicher Rechtsrahmen möglich; Vorreiter dieses Reformprojektes sind in Deutschland Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.
Im Jahr 2004 wurde der Entwurf für das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NordrheinWestfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz Nordrhein-Westfalen - NKFG NRW)“ entworfen und im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein- WestfalenNr. 41, Seite 644ffbeschlossen.
Die rechtliche Neukonzeption enthält drei wesentliche Teile:
-Einführungsgesetz (NKFEG; Übergangsregelung zur Doppik)
-Änderung der Gemeindeverordnung (GO)
-Doppische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Seit dem 01. Januar 2009 sind Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen.[9] Im Mittelpunkt des Buchungsvorganges steht immer das Produkt beziehungsweise eine Leistung oder ein Bündel von Leistungen (Produktbereich und Produktgruppe) mit einem steuerungsrelevanten und messbaren Ergebnis, das von Stellen außerhalb der Organisation (extern oder intern) nachgefragt wird.[10]
Hierbei sieht die Haushaltsgliederung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement folgende Mindestgliederung bei der Gestaltung der Produktbereiche vor:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1 - Produktbereiche Haushalt (Vgl. Dresach, Muster zur GO und GemHVO, Seite 71)
Der Kommune ist es in diesem Zusammenhang selbst überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine Mindestgliederung in Form von Produktbereichen ausweist, eine weitere Gliederungsebene durch Produktgruppen11 anstrebt oder eine tiefe Untergliederung in Produkten vornimmt; hier am Beispiel des Produktbereiches 04 - Kultur und Wissenschaft:
Unterteilt und zugeordnete Produktgruppen:
-Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
-Theater
-Musikpflege, Musikschulen
-Heimatpflege
-Sonstige Kulturpflege
-Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen
Für die Haushaltsplanung sind gemäß §4 Absatz 1 GemHVO sowohl für die Finanz- als auch für die Ergebnisplanung, produktbezogene Teilpläne aufzustellen, die in Form von Zieldefinitionen und, soweit möglich, anhand von Kennzahlen beschrieben werden sollen.
2.3. Das Drei-Komponenten-System des Haushaltswesens
Durch die Kameralistik ist in der Rechnungslegung eine einseitige Betrachtung des Vermögens nach dem Geldverbrauchsprinzip erfolgt: Ein- und Ausgaben wurden gegenübergestellt.
Durch die Implementierung der doppischen Verarbeitung von Geschäftsvorfällen, wird nach kaufmännischem Verständnis der Gesichtspunkt des Verbrauches berücksichtigt, dessen Ergebnis mit in die Bilanz einfließt.
Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erfolgt auf dieser Basis eine zusätzliche Erweiterung durch die Finanzrechnung, um neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch den Aspekt der Mittelverwendung zu berücksichtigen.
So werden beispielsweise bei einem Investitionsgut, das 10 Jahre genutzt wird, die Anschaffungskosten (50.000,00 €) im Januar im Finanzplan erfasst, die Abschreibungen (bei linearer Abschreibung 5.000,00 €) im Ergebnisplan und am Ende des Jahres in der Bilanz (45.000,00 € Anlagevermögen) dargestellt.
Hieraus resultiert ein Drei-Komponenten-System, in dem sich die Verwaltungstätigkeit in drei wesentliche Haushaltsphasen differenzieren lässt: Diese sind die Planung, Bewirtschaftung beziehungsweise Durchführung im laufenden Jahr sowie die Rechenschaft durch den Jahresabschluss, die in der folgenden Abbildung dargestellt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.4. Der Jahresabschluss
Entsprechend der Gemeindeordnung (GO) ist die Gemeinde dazu verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Abschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres auszuweisen ist.
Unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung , sind die tatsächlichen Verhältnisse von Vermögen, Schulden, Ertrags-, und Finanzlage der Gemeinde nachzuweisen und zu erläutern. Somit sind Bestandteile des Jahresabschlusses neben der Bilanz, die Ergebnisrechnung (zuzüglich Teilrechnungen), die Finanzrechnung (zuzüglich Teilrechnungen) und der Anhang mit entsprechendem Lagebericht.[11] [12]
Inhalt des Lageberichtes ist in diesem Zusammenhang neben einer Analyse der Haushaltswirtschaft auch eine ausführliche Betrachtung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die gemäß §12 der GemHVO seitens der Gemeinde festzulegen sind.[13]
2.5. Das Haushaltssicherungskonzept
Grundlegendes Ziel des kommunalen Managements ist gemäß §76 Absatz 1 GO die Sicherung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune. Gelingt es der Gemeinde nicht, einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen, ist unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen ist, an dem der Haushalt ausgeglichen sein wird. Die Prüfung der Haushaltssicherung erfolgt durch die zuständige Aufsichtsbehörde und soll nur genehmigt werden, wenn die Haushaltssicherung beziehungsweise der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht wird.[14]
Gemäß §1 der Gemeindeordnung ist das Wesen des kommunalen Haushaltes durch
1. die Förderung des Wohlergehens der Einwohner und
2. verantwortliche Handeln für zukünftige Generationen bestimmt.
Diesbezüglich ist es im Verständnis des kommunalen Wirtschaftens eine solide Haushaltspolitik zu führen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.
Das Ministerium für Inneres und Kommunales führt regelmäßig Abfragen bei den Kommunalaufsichtsbehörden durch, um einen aktuellen Überblick über den Haushaltsstatus der Gemeinden (GV) zu bekommen.
Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Haushaltssituation der Kommunen aus Nordrhein-Westfalen (Stand: 2012):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 - Haushaltssituation der Kommunen aus Nordrhein-Westfalen (Autorendarstellung, Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen) www.mik.nrw.de
Hiernach erreichen 26 der 427 Kommunen einen echten Haushaltsausgleich (Ergebnisrechnung >= 0); das ist ein Anteil von 6,09% aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklagen oder zusätzliche Verringerung der allgemeinen Rücklage erreichen weitere 52,93% einen „fiktiven“ Haushaltsausgleich.
Das in Kapitel 2.5. bereits thematisierte Haushaltssicherungskonzept müssen zirka 41% in Anspruch nehmen, von denen im Jahr 2012 29 nicht genehmigt werden konnten und sich drei Kommunen mit einer drohenden Überschuldung konfrontiert sehen.
Daher sind insbesondere in deröffentlichen Verwaltung ressourcenoptimierte und kapazitätsschonende, strategische Ausrichtungen unumgänglich, um dem eingangs genannten Wesen der Gemeinde gerecht zu werden.
genehmigtes HSK und HSP genehmigte Verringerung der allg. Rücklage nicht genehmigtes HSP und HSK fiktiver Haushaltsausgleich "echter" Haushaltsausgleich davon: ohne Überschuldung
3. Controlling
3.1. Definition des Controllings und Bedeutung
Nach Horváth ist Controlling ein variables Subsystem der Führung, das Planung, Kontrolle und Informationsversorgung in einem System bildet, intern koppelt und durch Koordination und Adaption die Organisation unterstützt17.
Controlling ist in diesem Zusammenhang ein dynamischer Prozess, der eine kontinuierliche Abstimmung und Synchronisation der genannten Subsysteme vorsieht.
Die Basis bilden Informationen, die aus den Größen des internen Rechnungswesens generiert werden.
Daher sind insbesondere eine Kosten-Leistungsrechnung und ein ausgearbeitetes Kennzahlensystem und Berichtswesen unumgänglich, um eine sinnvolle Unterstützung der Führungsebene bei der Erreichung der definierten strategischen Ziele gewährleisten zu können, wie es im Neuen Steuerungsmodell vorgesehen ist (Kapitel 2.2.).
3.2. Controlling in der Kommune
Auf kommunaler Ebene ist die Definition strategischer Ziele unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Perspektiven abweichend zu konstruieren.
Die Erarbeitung der Strategie richtet sich nach einer Vielzahl von Faktoren und besitzt keine eindimensionale Form. Endgültige Instanz bei der Festlegung und Bestimmung von strategischen Zielen auf kommunaler Ebene, liegt nach §41 Absatz 1 Buchstabe t der Gemeindeordnung bei dem Rat einer Gemeinde.
Die Kommune ist durch ihre Monopolstellung zwar keinem existenziellen Wettbewerb ausgesetzt und muss nicht um die Marktanteile und ihre Kunden kämpfen, ist dennoch von ihrem Umfeld abhängig.
Die langfristige Ausrichtung beziehungsweise Planung meint die Festlegung entsprechender Rahmenbedingungen, die durch die operative Ebene in konkrete Aktionen überführt wird.
Bezogen auf das kommunale Management steht als Ziel immer eine Wirkung im Vordergrund der Orientierung (Outcome).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 - Wirkungsorientierte Steuerung (Autorendarstellung, in Anlehnung an Heinz, 2000, S. 20)
Neben der eigentlichen Zieldefinition dienen Kennzahlen als wichtige Kontrollinstanz und sollen die notwendige Transparenz liefern. Gemäß §12 GemHVO sind für die Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der eingesetzten Ressourcen, Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen, die zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.
Bevor eine konkrete Zielvorgabe oder Vision definiert werden kann, bedarf es einer differenzierten Ermittlung des Bestandszustandes, bevor im Anschluss Aussagen über mögliche, zukünftig zu erwartende Zustände gemacht werden können.
Das kommunale Controlling nutzt bei der strategischen Analyse Instrumente, die aus auch der Betriebswirtschaftslehre bekannt sind.
3.3. Controlling-Instrumente auf kommunaler Ebene 3.3.1. Die SWOT-Analyse
Das Wort SWOT setzen sich als Akronym aus den ersten Buchstaben der vier in der Matrix vorherrschenden Teile zusammen:
-S - Strengths (Stärke)
-W - Weakness (Schwäche)
-O - Opportunities (Chancen)
-T - Threats (Risiken)
Diese Analyse dient als Werkzeug bei der Planung und Strategieentwicklung.
In der sich anschließenden Grafik werden die verschiedenen Teile der Matrix visualisiert, die sich einerseits aus den vier bereits erwähnten Grundbausteinen, andererseits aus so genannten Umwelt- und Unternehmensanalysen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 - Darstellung der SWOT-Matrix (Autorendarstellung)
Doch nicht nur aufgrund von betriebswirtschaftlichen Beweggründen eignet sich dieses Instrumentarium als Basis für eine weitere Strategieverfolgung.
Als Basis bedeutet in diesem Zusammenhang, dass untersuchte Bereiche lediglich als Ganzes dargestellt werden. Ziel der SWOT-Analyse ist jedoch keine bestimmte Strategie ermittelt sondern vielmehr mögliche Strategieausrichtungen aufgezeigt.
Auch auf kommunaler Ebene ist eine Statusermittlung des Umfeldes beziehungsweise der Organisation als Unternehmens im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung und globalen strategischen Ausrichtung sinnvoll, um im weiteren Verlauf Teilstrategien für entsprechende Handlungsfelder zu erarbeiten.
3.3.2. Die BOSTON-Matrix
Wie aus Kapitel 2.3. zu entnehmen, beinhaltet das Neue Kommunale Finanzmanagement wesentliche Aspekte der produktorientierten Betrachtung bei der verwaltungstechnischen Ausrichtung.
Sowohl in der Betriebswirtschaft als auch in der Verwaltung, tragen die organisationsbezogenen Produkte zur Zielerreichung bei. So ist es auf Unternehmensebene üblich, dass Produkte, die im Rahmen des Produktlebenszyklusses[15] [16], nur noch einen geringen Marktanteil und ein sinkendes Marktwachstum aufweisen, die so genannten Poor Dogs, vom Markt genommen werden, weil diese kein positives Outcome auf die Unternehmensziele haben und langfristig defizitär für das Unternehmen sind.
Die besondere Rolle des Produktes in der kommunalen Verwaltung kommt auch bei der Steuerung und Beurteilung der Produkte zum Tragen, um strategische Ziele durch ressourcenoptimierte Ausrichtung erreichen zukönnen. Dennoch ist eine strikte Produktsondierung und Konsolidierung auf kommunaler Ebene nicht durchzuführen. Dies wird gemäß § 37 der Gemeindeordnung Absatz 1 in dem die Aufgaben der Bezirksvertretungen dargelegt. Unter Buchstabe a heißt es unter anderem: „Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen undöffentlichen Einrichtungen, wie Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen“.
Aus diesem Grund ist es für die Verwaltung nicht möglich, dauerhaft defizitäre Produkte, die einen geringen Wirkungsgrad und parallel einem hohen Zuschuss bedürfen, kurzfristig „vom Markt“ zu nehmen.
Allerdings gibt die Boston-Matrix in diesem Zusammenhang einen entsprechenden Produktüberblick, der im Rahmen der strategischen Zielausrichtung oder Haushaltskonsolidierung nicht an Bedeutung gewinnt und im folgenden Kapitel thematisiert wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 - Darstellung der BOSTON-Matrix (Autorendarstellung)
[...]
[1] Vgl. http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale- finanzen/kommunale-haushalte/haushaltsrechtnkf.html (Stand: 26.11.2013)
[2] Auf den Begriff der Kameralistik wird in Kapitel 2.1. näher eingegangen
[3] Vgl. Grundsätze der Haushaltsführung: GO §§ 1, 48, 75
[4] KGSt: Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (www.kgst.de; Stand: 25.11.2013)
[5] Vgl. KGSt (Hrsg.); Bericht 19/1992: Wege zum Dienstleistungsunternehmen Kommunalverwaltung - Fallstudie Tilburg
[6] NSM, auch bekannt als „New Public Management“ (NPM)
[7] Vgl. Busch, 2004, S.lll
[8] Vgl. Lüder; Konzeptionelle Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (SpeyererVerfahren), Heft 6, 2.Auflage, Stuttgart 1999
[9] Vgl. §1 Abs. 1 NKFEGNordrhein-Westfalen
[10] Vgl. www.olev.de; Verwaltungslexikon (Stand: 26.11.2013, Stichwort: „Produkt“)
[11] Vgl. GO §§91, 92, 93, 95, 101 und GemHVO §§11, 27, 28, 29, 32, 37, 53
[12] Vgl. GO §95 , Absatz 1 sowie §49 GemHVO
[13] Vgl. GemHVO §48: Lagebericht sowie §12
[14] GO §76 Absatz 2: Haushaltssicherungskonzept
[15] Hopp/Göbel, 2000, S.71
[16] Gabler, Stichwort Produktlebenszyklus: zyklische Abfolge der Absatzmengen- Deckungsbeitrags-Entwicklung, die üblicherweise in die Phasen Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung und Degeneration eingeteilt wird
- Quote paper
- Alexander Kuhn (Author), 2014, Controlling in der Kommune, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272657