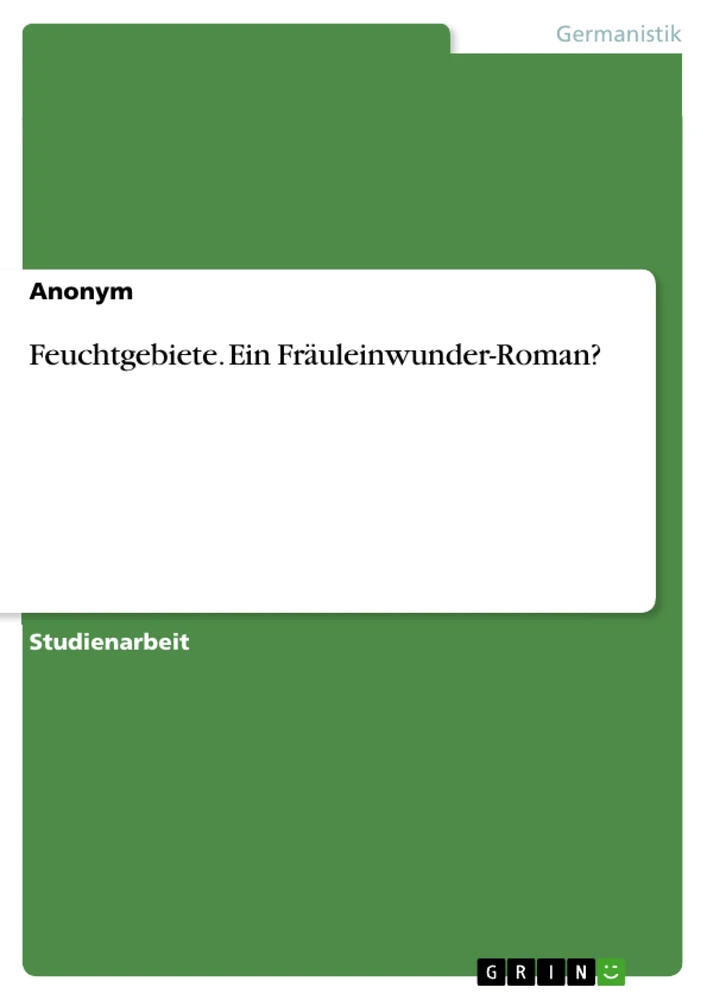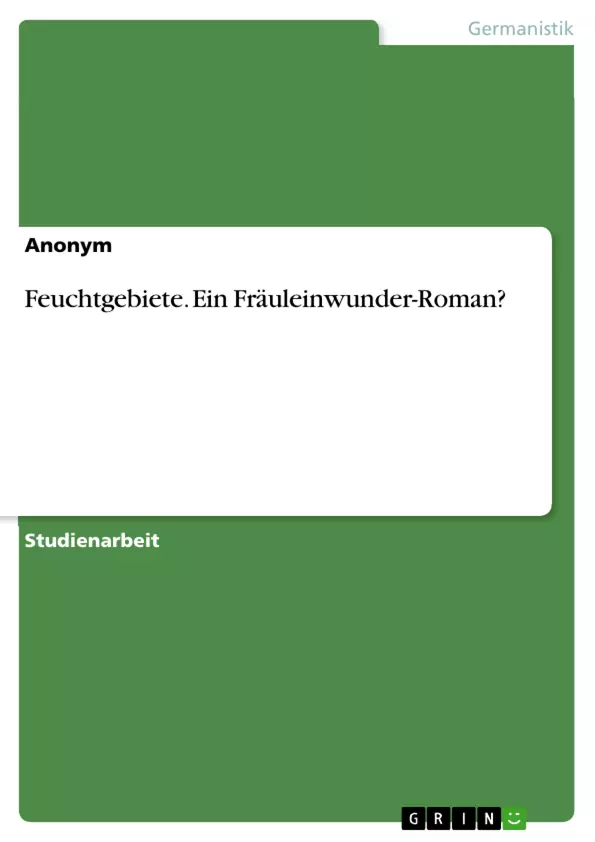„Das Fräuleinwunder ist tot – es lebe das Fräuleinwunder“, so die Heroldsformel und gleichsam Titel von Annette Mingels Artikel, der kritisch die Auferstehung und den Fall des Fräuleinwunders thematisiert. Doch welche Farbe färbte noch vor diesem rosaroten Phänomen die Literatur in den Bücherregalen der Deutschen? Befragte man Hans Magnus Enzensberger oder Marcel Reich-Ranicki noch vor ein paar Jahren zu diesem Thema, antworteten diese vermutlich „grau“. Sie rieten in den 90er Jahren noch „,dringend zum Vergleich mit den Literaturen anderer Länder‘“ , denn gerade dort – im Ausland – galt die deutsche Belletristik lange als „besonders schwierig, unsinnlich und weltfern“ . Man warf den AutorInnen oft vor, die deutsche Literatur „primär als Austragungsort ästhetischer und politischer Metadiskurse [zu benutzen] und jeglichen Forderungen nach Lesbarkeit und Unterhaltsamkeit a priori mit Skepsis“ zu begegnen. Fast zwingend unterschied man damals zwischen minderwertiger Trivialliteratur, die zwar den Leser gut unterhielt, jedoch jeglichen intellektuellen Normen widersprach und jener Literatur, die zwar geistig hochanspruchsvoll daherkam, allerdings einschläfernd auf den Leser wirkte.
Gerade auch wegen dieser festgefahrenen Vorstellung von Literatur in den Köpfen der SchriftstellerInnen appellierte Uwe Wittstock in seinem Essay „Leselust“ an deutsche AutorInnen, sie sollten sich „von althergebrachten Dogmen lösen und die Nische nicht länger als einzigen ehrenwerten Aufenthaltsort begreifen, sondern der sogenannten ernsten Literatur mit ‚Intelligenz und Witz, mit Geschick und Geschmack, Fingerspitzengefühl und Phantasie‘ jenen Unterhaltungswert verschaffen, der sie lesenswert mache“ . Die Rufe entlang den Reihen der Kritiker wurden zuletzt so laut, dass die Forderungen nach einem Umschwung in der deutschen Literatur und damit einhergehend neuen Parametern und auch frischen AutorInnen nicht mehr zu überhören waren.
Auf die anfängliche „Politisierung der Literatur in den 70er und 80er Jahren und die Ost-West-Thematik erfolgte in den 90ern ein Kurswechsel, der die wiedervereinigte Hauptstadt Deutschlands zum Schauplatz vieler lebhafter Erzählungen machte – der „Berlin-Roman“ feierte aufgrund vieler neuer AutorInnen sein Debüt. An erster Stelle sei hier Judith Hermann zu erwähnen, die sich im Weiteren als Grundstein des Fräuleinwunders herausstellen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung - Das Fräuleinwunder
- 1.1 Volker Hage prägt den Begriff „Fräuleinwunder“
- 1.2 Merkmale eines Fräuleinwunder-Romans
- 2. Skandalroman: Feuchtgebiete
- 2.1 Charlotte Roche - eine Fräuleinwunder-Autorin?
- 2.2 Fräuleinwunder – Merkmale des Skandalromans
- 3. Fazit Feuchtgebiete ein Fräuleinwunder-Roman?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des „Fräuleinwunders“ in der deutschen Literatur. Die Zielsetzung ist es, den Begriff zu definieren, seine Entstehung zu beleuchten und seine Bedeutung für die Entwicklung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern der Roman „Feuchtgebiete“ als Beispiel für einen „Fräuleinwunder“-Roman betrachtet werden kann.
- Entstehung und Definition des Begriffs „Fräuleinwunder“
- Charakteristische Merkmale von „Fräuleinwunder“-Romanen
- Analyse von „Feuchtgebiete“ im Kontext des „Fräuleinwunders“
- Der Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung des „Fräuleinwunders“
- Die aktuelle Relevanz des „Fräuleinwunders“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung - Das Fräuleinwunder: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext des „Fräuleinwunders“, beginnend mit der Kritik an der deutschen Literatur der 90er Jahre als „grau“, „schwierig“ und „weltfern“. Sie beschreibt den Wunsch nach mehr Lesbarkeit und Unterhaltungswert und den damit verbundenen Aufruf an Autorinnen und Autoren, sich von althergebrachten Dogmen zu lösen. Die Entstehung des „Fräuleinwunder“-Begriffs wird mit dem Aufkommen des „Berlin-Romans“ in Verbindung gebracht, der einen Kurswechsel in der deutschen Literatur markierte und neue Autorinnen wie Judith Hermann in den Vordergrund rückte. Der Abschnitt bereitet den Leser auf die Analyse des Phänomens vor und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung und den Merkmalen des „Fräuleinwunders“.
2. Skandalroman: Feuchtgebiete: Dieses Kapitel analysiert den Roman „Feuchtgebiete“ von Charlotte Roche im Kontext des „Fräuleinwunders“. Es untersucht, ob die Merkmale des Romans mit den typischen Eigenschaften eines „Fräuleinwunder“-Textes übereinstimmen und inwieweit Roche als „Fräuleinwunder“-Autorin klassifiziert werden kann. Die Analyse betrachtet den Roman unter dem Aspekt seiner kontroversen Themen und seines Stils, um zu beurteilen, ob er dem Bild entspricht, das mit dem „Fräuleinwunder“ verbunden wird. Es werden stilistische Mittel und thematische Schwerpunkte des Romans im Kontext des Phänomens beleuchtet.
Schlüsselwörter
Fräuleinwunder, deutsche Gegenwartsliteratur, Berlin-Roman, Judith Hermann, Charlotte Roche, Skandalroman, Medieninszenierung, weibliche Autorinnen, Lesbarkeit, Unterhaltungswert.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des "Fräuleinwunders" am Beispiel von "Feuchtgebiete"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des „Fräuleinwunders“ in der deutschen Literatur, insbesondere anhand des Romans „Feuchtgebiete“ von Charlotte Roche. Sie beleuchtet die Entstehung und Definition des Begriffs, analysiert die Merkmale von „Fräuleinwunder“-Romanen und untersucht, inwiefern „Feuchtgebiete“ als Beispiel dafür gilt.
Was ist das "Fräuleinwunder"?
Der Begriff „Fräuleinwunder“, geprägt von Volker Hage, beschreibt einen Wandel in der deutschen Literatur der 1990er Jahre. Er kennzeichnet eine Abkehr von der als „grau“, „schwierig“ und „weltfremd“ empfundenen Literatur der vorherigen Jahre hin zu mehr Lesbarkeit und Unterhaltungswert. Es ist verbunden mit dem Aufkommen des „Berlin-Romans“ und neuen Autorinnen wie Judith Hermann.
Welche Merkmale zeichnen einen "Fräuleinwunder"-Roman aus?
Die Arbeit definiert die charakteristischen Merkmale von „Fräuleinwunder“-Romanen. Diese Merkmale werden im Kontext der Analyse von „Feuchtgebiete“ untersucht und umfassen Aspekte wie Lesbarkeit, Stil, thematische Schwerpunkte und die Rolle der Medien in der Rezeption.
Wie wird "Feuchtgebiete" im Kontext des "Fräuleinwunders" analysiert?
Das Kapitel zu „Feuchtgebiete“ analysiert den Roman hinsichtlich seiner kontroversen Themen und seines Stils. Es untersucht, ob die Merkmale des Romans mit den typischen Eigenschaften eines „Fräuleinwunder“-Textes übereinstimmen und ob Charlotte Roche als „Fräuleinwunder“-Autorin klassifiziert werden kann. Stilistische Mittel und thematische Schwerpunkte des Romans werden im Kontext des Phänomens beleuchtet.
Welche Rolle spielen die Medien im Kontext des "Fräuleinwunders"?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung und Rezeption des „Fräuleinwunders“. Die Medieninszenierung und die damit verbundene öffentliche Diskussion werden als wichtiger Aspekt des Phänomens betrachtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fräuleinwunder, deutsche Gegenwartsliteratur, Berlin-Roman, Judith Hermann, Charlotte Roche, Skandalroman, Medieninszenierung, weibliche Autorinnen, Lesbarkeit, Unterhaltungswert.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung zum „Fräuleinwunder“, ein Kapitel zur Analyse von „Feuchtgebiete“ im Kontext des „Fräuleinwunders“ und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext und die Entstehung des Begriffs „Fräuleinwunder“.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, den Begriff „Fräuleinwunder“ zu definieren, seine Entstehung zu beleuchten und seine Bedeutung für die Entwicklung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern der Roman „Feuchtgebiete“ als Beispiel für einen „Fräuleinwunder“-Roman betrachtet werden kann.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Feuchtgebiete. Ein Fräuleinwunder-Roman?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273007