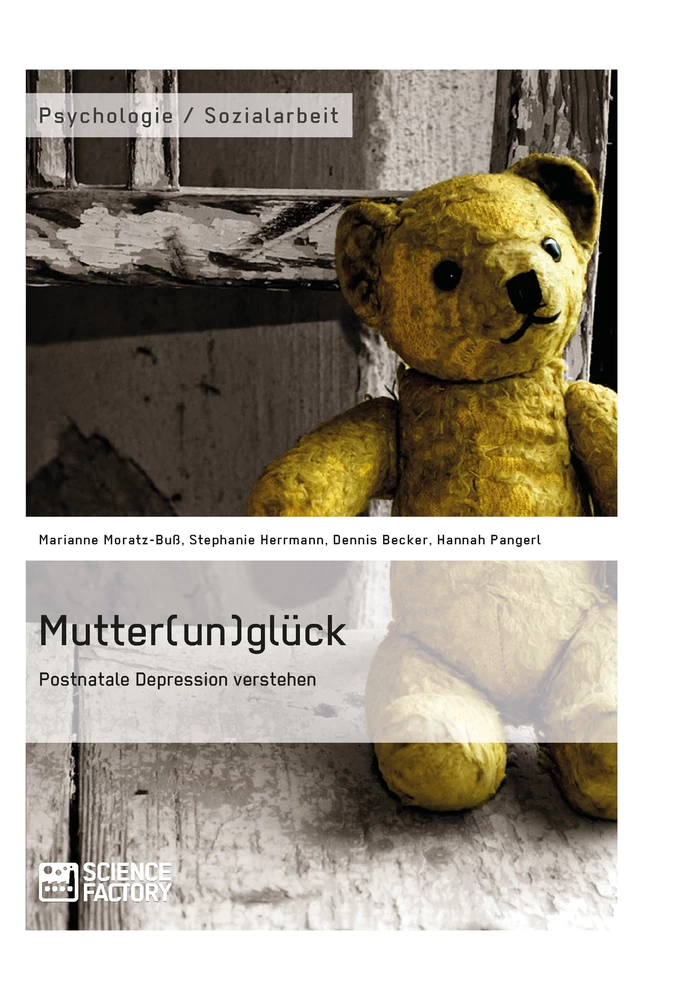Anfängliche Freude über ein Baby, die rasch in Angst, Verzweiflung und Depression umschlägt: Dieses Krankheitsbild nach der Entbindung wird bei jeder zehnten Frau diagnostiziert und aus Scham und Schuldgefühlen oft nicht angesprochen.
Dieses Buch will bei Betroffenen und ihrem Umfeld für dieses Phänomen sensibilisieren, erklärt die Ursachen und Wurzeln dieser Krankheit und zeigt Möglichkeiten der Intervention auf.
Aus dem Inhalt:
Körperliche und psychische Ursachen
Risikofaktoren und Krankheitsverlauf
Bindungstheorie
Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung
Soziale Faktoren
Wege aus der Krise
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Depression
- Definition der Begriffe „Depression" und „postpartale Depression" in Abgrenzung zum sog. „Baby-Blues"
- Der medizinische Begriff „Depression"
- Depression mit postpartalem Beginn
- Der Baby-Blues
- Ursachen einer postpartalen Depression
- Körperliche Ursachen
- Psychische und soziale Ursachen
- Auswirkungen einer Depression
- Auswirkungen auf den emotionalen Zustand der Mutter
- Auswirkungen auf die innerfamiliäre Alltagsgestaltung mit einem Säugling
- Auswirkungen auf die Entwicklung des Säuglings
- Stil-Face Paradigma und emotionale Unterstimulierung
- Oberstimulierung
- Geistige Entwicklung und Sprachentwicklung
- Körperliche Unversehrtheit und Infantizidrisiko
- Gedanken zur Bindungstheorie
- Bindung und Bindungsforschung
- Sicher gebundene Kinder
- Unsicher-vermeidend gebundene Kinder
- Unsicher-ambivalent gebundene Kinder
- Desorganisiert gebundene Kinder
- Nicht klassifizierbare Kinder
- Auswirkungen sicherer bzw. unsicherer Bindung
- Wann gelingt Bindung?
- Elterliche Feinfühligkeit
- Innere Haltung gegenüber dem Kind
- Liebevoller Umgang, Zärtlichkeit und Körperkontakt
- Eltern-Kind-Interaktion und Depression
- Bedeutung der Mutter-Kind-Interaktion
- Die Sonderstellung der Väter
- Protektive Faktoren und Risikofaktoren
- Protektive Faktoren
- Sichere Bindung
- Unterstützung in der Partnerschaft
- Engmaschiges soziales Netzwerk
- Hohes Ausbildungsniveau
- Allgemeine Lebenszufriedenheit
- Risikofaktoren
- Unsichere Bindung
- Risikofaktor „alleinerziehend"
- Frühe Trennung und Verlusterlebnisse
- Soziale Benachteiligung
- Armut
- Mehrere Geburten in rascher Folge
- Psychische Erkrankungen in der Vorgeschichte
- Mangelnde Krankheitseinsicht
- Protektive Faktoren
- Interventionsmöglichkeiten
- Praxisgebiete, in denen dieses Thema relevant ist
- Möglichkeiten der Hilfe
- Präventive Hilfsangebote
- Geburtsvorbereitungskurse
- Risikoerfassung während der Schwangerschaft
- Eltern-Feinfühligkeitstraining
- Hausbesuche
- STEEP
- Ehrenamtliches Engagement fördern
- Wenn die Krise da ist...
- Haushaltshilfe und Sonderurlaub
- Unterstützung durch Hausbesuche
- Gemeinsame Behandlung von Mutter und Kind
- Eltern-Säuglings-Beratungsstellen
- Medikamentöse Hilfe
- Präventive Hilfsangebote
- Schlussbemerkung
- Persönliche Bemerkung zum Abschluss
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit dem Thema postnatale Depressionen auseinander und untersucht deren Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung. Im Fokus steht die Frage, inwieweit sich die Auswirkungen einer postpartalen psychischen Erkrankung von Depressionen unterscheiden, die zu anderen Zeitpunkten auftreten. Darüber hinaus werden die Folgen für die Mutter-Kind-Beziehung aus einer zeitlich befristeten Erkrankung im Wochenbett sowie mögliche Interventionen beleuchtet.
- Postnatale Depressionen und ihre Ursachen
- Die Bedeutung der Bindungstheorie für die Mutter-Kind-Beziehung
- Die frühkindliche Interaktion zwischen Mutter und Kind
- Die Folgen postnataler Depressionen für die Entwicklung des Kindes
- Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten für betroffene Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Begriffsbestimmung von Depressionen und erläutert die Bedeutung der Begriffe „pränatal" und „postpartal". Anschließend werden die biologischen und psychosozialen Veränderungsprozesse im Übergang zur Mutterschaft beschrieben. Dabei werden die körperlichen Veränderungen, hormonellen Umstellungen, die Neufindung in die Rolle als Mutter, die Partnerschaft und soziale Unterstützung sowie die Beziehung zur eigenen Mutter beleuchtet. Im Anschluss werden die verschiedenen Erkrankungsbilder der Postpartalzeit, die postpartale Dysphorie (Baby-Blues), die postpartale Depression und die postpartale Psychose, vorgestellt. Die Arbeit widmet sich anschließend der Bindungstheorie und erläutert die Entwicklung von Bindung, das Konzept der Feinfühligkeit sowie die verschiedenen Bindungsstile. Es wird auch auf die Auswirkungen sicherer bzw. unsicherer Bindung sowie das Adult-Attachment-Interview (AAI) eingegangen. Im nächsten Kapitel wird die frühkindliche Interaktion zwischen Mutter und Kind näher betrachtet, wobei die Bedeutung der affektiven Spiegelung und die Konzepte von Holding und Containing betont werden. Die Arbeit untersucht dann die Folgen postnataler Depressionen für die Kinder und beschreibt die Lebenssituation betroffener Kinder, die Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, Regulationsstörungen und die Störung der Mutter-Kind-Interaktion. Es wird auch auf die Still-face-Situation und Deprivationsverhalten eingegangen sowie auf Schutzfaktoren für die psychische Entwicklung. Im letzten Kapitel werden Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten, die im Fall einer postpartalen Erkrankung angestrebt werden können, vorgestellt. Dabei werden präventive Hilfsangebote wie Geburtsvorbereitungskurse und Feinfühligkeitstrainings sowie Interventionsangebote für Mütter und ihre Kinder wie Schreibaby-Ambulanzen, Patenschaften und Säuglings-Mutter-Psychotherapie erläutert. Die Arbeit schließt mit einem Resümee, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und die Bedeutung einer interdisziplinären Zusammenarbeit sowie präventiver Maßnahmen betont.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen postnatale Depression, Wochenbettdepression, Baby-Blues, Wochenbettpsychose, Bindungstheorie, Mutter-Kind-Beziehung, frühkindliche Entwicklung, Interaktion, Regulationsstörung, Schreibaby-Syndrom, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Interventionsmöglichkeiten, präventive Maßnahmen, Mutter-Kind-Therapie, Schreibaby-Ambulanz, Patenschaften, Säuglings-Mutter-Psychotherapie, interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet den "Baby-Blues" von einer postnatalen Depression?
Der Baby-Blues tritt kurz nach der Geburt auf und verschwindet meist nach wenigen Tagen. Eine postnatale Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, die Wochen oder Monate anhalten kann.
Welche Auswirkungen hat die Depression auf die Mutter-Kind-Bindung?
Die Erkrankung kann die mütterliche Feinfühligkeit einschränken, was zu unsicheren Bindungsstilen beim Kind und Verzögerungen in dessen emotionaler Entwicklung führen kann.
Was sind körperliche Ursachen für postpartale Depressionen?
Hormonelle Umstellungen nach der Entbindung, Schlafmangel und körperliche Erschöpfung spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung.
Welche Hilfsangebote gibt es für betroffene Mütter?
Es gibt spezialisierte Psychotherapie, Mutter-Kind-Einrichtungen, Schreibaby-Ambulanzen und in schweren Fällen medikamentöse Unterstützung.
Können auch Väter betroffen sein?
Ja, auch Väter können nach der Geburt eines Kindes depressive Episoden entwickeln, oft bedingt durch die neue Belastungssituation und Rollenveränderung.
- Quote paper
- Marianne Moratz-Buß (Author), Stephanie Herrmann (Author), Dennis Becker (Author), Hannah Pangerl (Author), 2014, Mutter(un)glück. Postnatale Depression verstehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273075