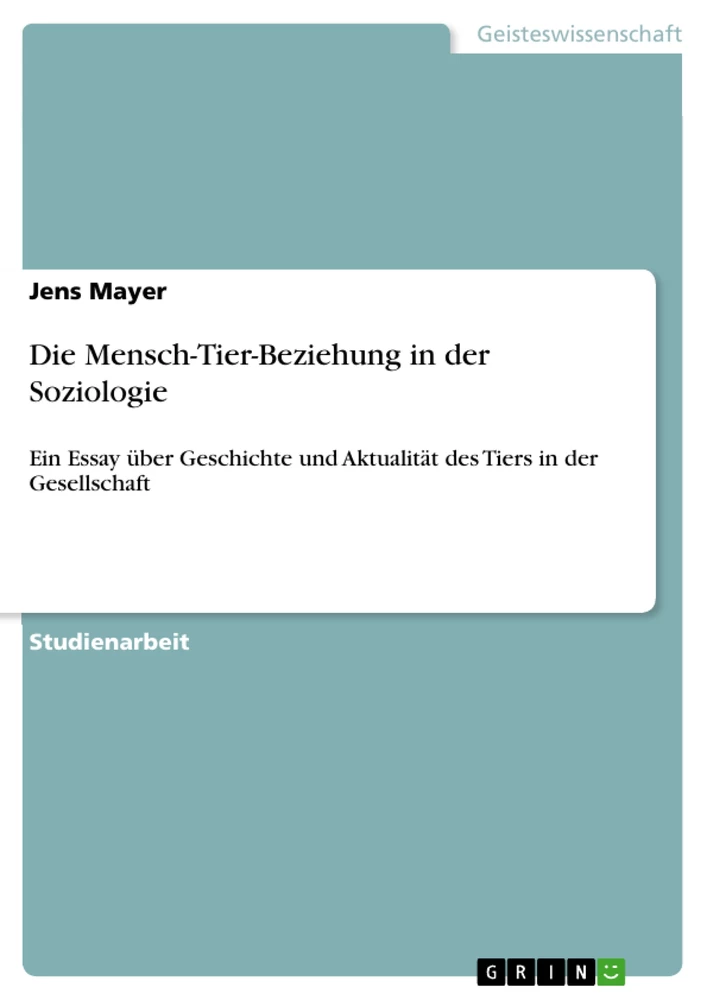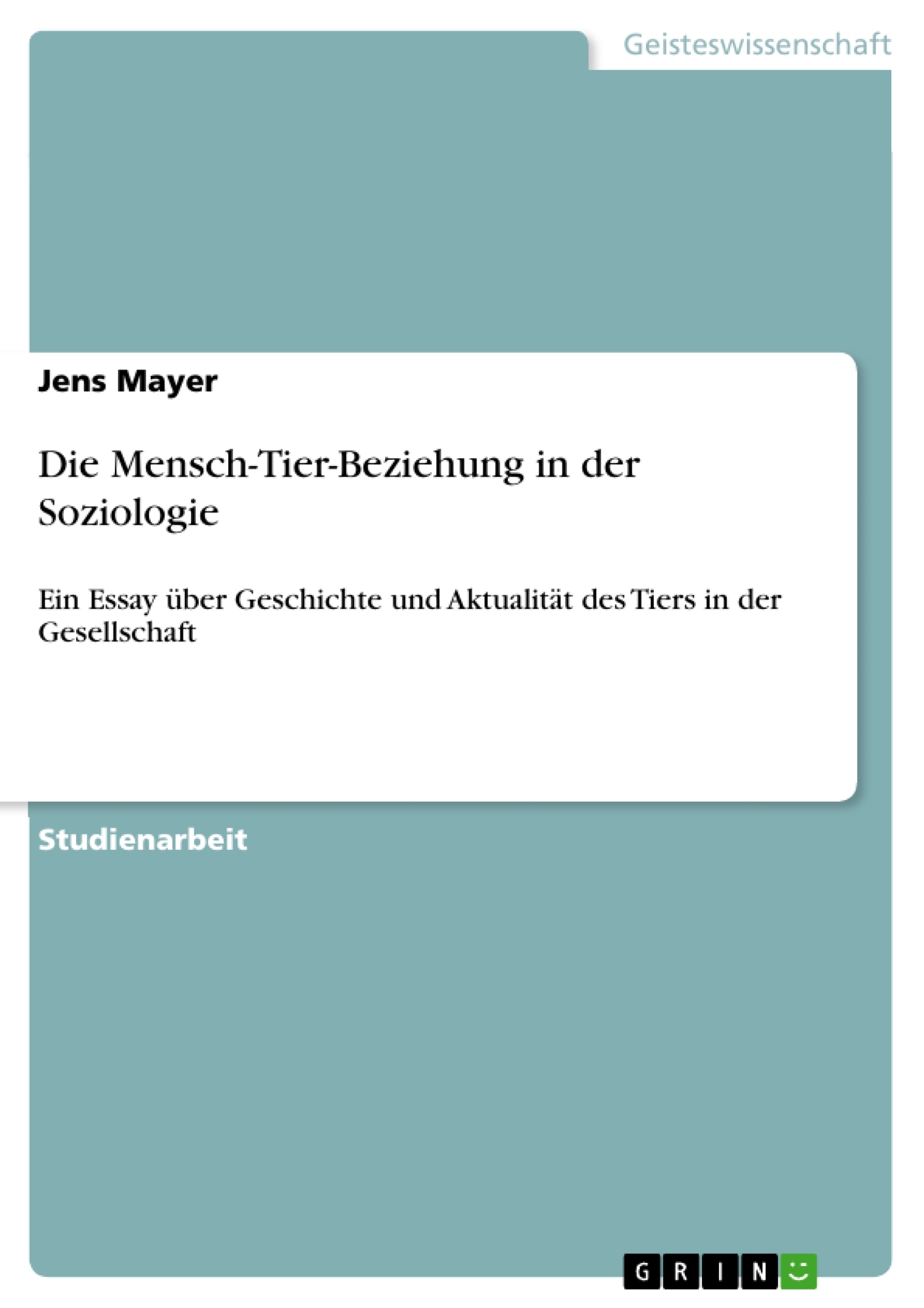In den letzten Jahren hat sich ein neuer interdisziplinärer Forschungszweig entwickelt, der sowohl die Natur- als auch die Geisteswissenschaften umfasst. Die Human Animal Studies beschäftigen sich mit den Verhältnis zwischen Mensch und Tier. In der Soziologie wurden lange Zeit Tierstudien vernachlässigt, was an der anthropozentrischen Ausrichtung dieser Wissenschaft zu tun hat. In den letzten Jahren hat sich die Zahl an soziologischen Studien und Arbeiten zum Thema Mensch-Tier-Beziehungen allerdings stark vergrößert. Die Soziologin und Tierrechtlerin Birgit Mütherich hat mit ihrem Werk „Die Problematik der Mensch-Tier-Beziehung in der Soziologie“ soziologische Pionierarbeit geleistet zum Bereich der Tier-Studien. In dieser Arbeit soll zunächst die Mensch-Tier-Beziehung in einem historischen Lichte betrachtet werden. Anschließend sollen kurz theologische und philosophische Überlegungen zum ethischen Umgang mit Tieren dargestellt werden, um dann zu soziologischen und insbesondere körpersoziologischen Überlegungen überzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Mensch-Tier-Beziehung im historischen Kontext
- Geschichtliche Entwicklung
- Beginn der Menschheit
- Beginn der Landwirtschaft
- Zeitalter der Antike
- Franz von Assisi und Thomas von Aquin - 13. Jahrhundert
- Zeitalter der Renaissance
- Aufklärung - 17. Und 18. Jahrhundert
- Zeitalter der Industrialisierung
- Die Mensch-Tier-Beziehung in der weiteren philosophischen Überlieferung
- Geschichtliche Entwicklung
- Die Mensch-Tier-Beziehung in der Soziologie
- Birgit Mütherich: Tier-Begriff und Mensch-Tier-Dualismus
- Max Weber und sein Zugang zum Tier
- Körpersoziologie und ihr Zugang zum Tier
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Mensch-Tier-Beziehung im Kontext der Körpersoziologie. Ziel ist es, die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier aufzuzeigen, philosophische und theologische Überlegungen zum ethischen Umgang mit Tieren darzustellen und die Mensch-Tier-Beziehung aus soziologischer Perspektive, insbesondere aus der Perspektive der Körpersoziologie, zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung des Mensch-Tier-Verhältnisses
- Philosophische und theologische Überlegungen zum ethischen Umgang mit Tieren
- Der Tierbegriff und der Mensch-Tier-Dualismus in der Soziologie
- Die Rolle der Körpersoziologie bei der Analyse der Mensch-Tier-Beziehung
- Die Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung in der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Mensch-Tier-Beziehung ein und stellt die Bedeutung der Human Animal Studies sowie die Rolle der Soziologie in diesem Bereich dar.
Das zweite Kapitel betrachtet die Mensch-Tier-Beziehung im historischen Kontext. Es untersucht die geschichtliche Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier von den Anfängen der Menschheit bis zur Industrialisierung. Dabei werden verschiedene Epochen und wichtige Denker wie Pythagoras, Aristoteles, Franz von Assisi und Thomas von Aquin beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die Mensch-Tier-Beziehung aus soziologischer Perspektive. Es stellt die Kritik von Birgit Mütherich am Wertfreiheitspostulat der Soziologie dar und beleuchtet den Tierbegriff sowie den Mensch-Tier-Dualismus in der westlichen Tradition.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rolle der Körpersoziologie bei der Analyse der Mensch-Tier-Beziehung. Es zeigt, wie die Körpersoziologie den cartesianischen Gedanken der Trennung zwischen Geist und Körper umwunden hat und somit prädestiniert ist, die gesellschaftliche Grenze zwischen Mensch und Tier zu überwinden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Mensch-Tier-Beziehung, die Körpersoziologie, der Tierbegriff, der Mensch-Tier-Dualismus, die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier, die ethische Behandlung von Tieren, die Soziologie und die philosophische Überlieferung zum Umgang mit Tieren. Der Text beleuchtet die Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung in der modernen Gesellschaft und die Rolle der Körpersoziologie bei der Analyse dieses komplexen Themas.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde das Thema Tierstudien in der Soziologie lange vernachlässigt?
Dies liegt an der stark anthropozentrischen Ausrichtung der Soziologie, die den Menschen als einzig relevantes soziales Wesen betrachtete.
Was sind „Human Animal Studies“?
Ein interdisziplinärer Forschungszweig, der das komplexe Verhältnis und die Interaktionen zwischen Menschen und Tieren untersucht.
Welche Rolle spielt die Körpersoziologie in der Mensch-Tier-Beziehung?
Die Körpersoziologie hilft, die strikte Trennung zwischen Geist (Mensch) und Körper (Tier) zu überwinden und die physische Interaktion in den Fokus zu rücken.
Wie hat sich das Mensch-Tier-Verhältnis historisch gewandelt?
Die Arbeit zeichnet den Weg von der frühen Koexistenz über die Nutztierhaltung bis hin zur Instrumentalisierung in der Industrialisierung nach.
Wer war Birgit Mütherich?
Eine Pionierin der soziologischen Tierstudien, die den Mensch-Tier-Dualismus kritisch analysierte und für Tierrechte eintrat.
Was ist der Mensch-Tier-Dualismus?
Die in der westlichen Tradition tief verwurzelte Vorstellung einer klaren qualitativen Grenze zwischen Mensch und Tier, die oft zur Abwertung der Tiere führt.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Jens Mayer (Author), 2014, Die Mensch-Tier-Beziehung in der Soziologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273158