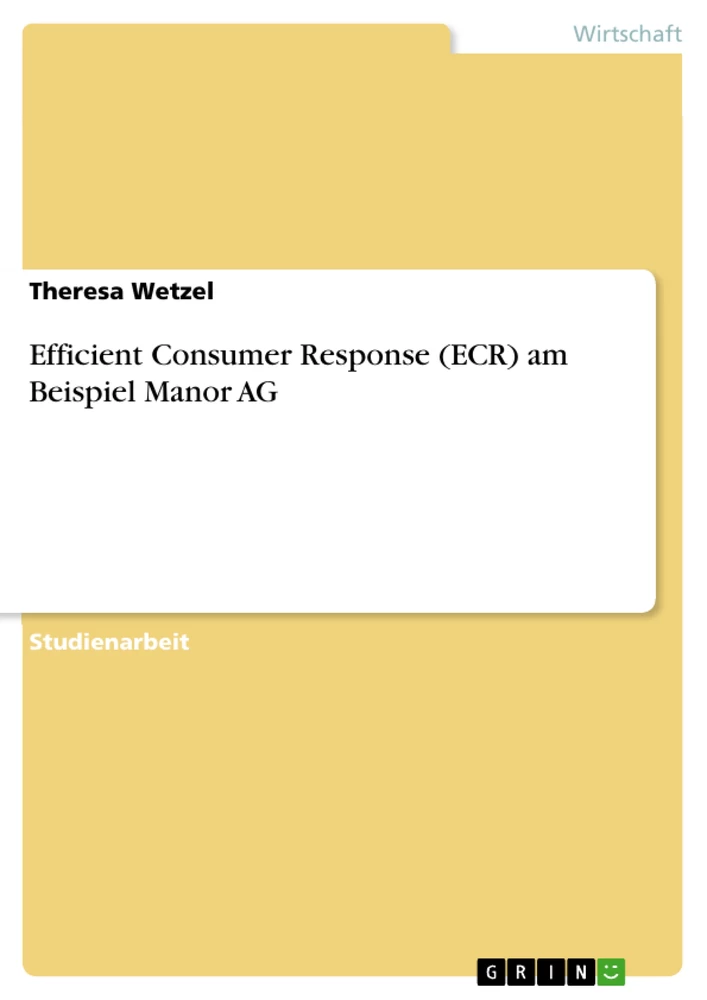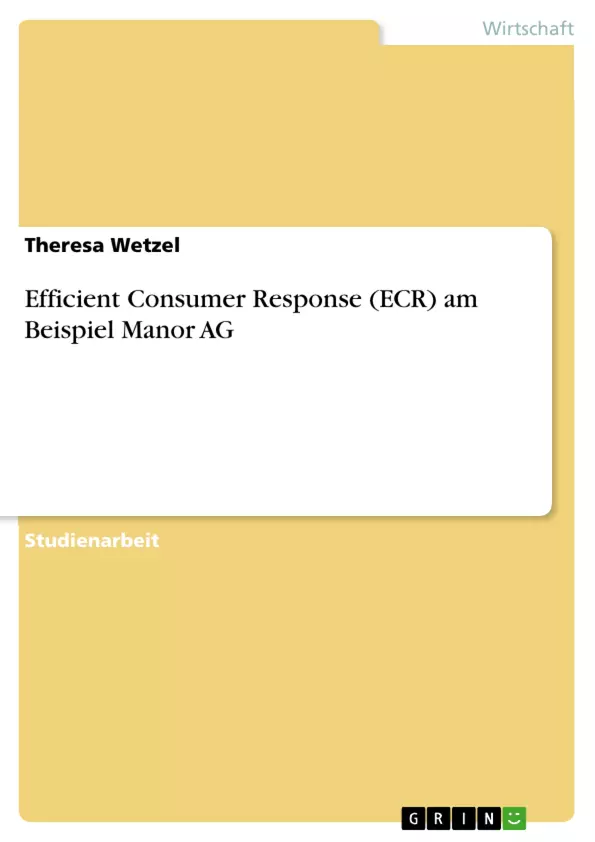Die Konsumgüterindustrie hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt und trägt mit ihren Veränderungen zur Entwicklung der Hersteller-Handel-Kunden-Beziehung bei. Dies bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.
Der Konsument und sein Verbrauch stellen die wahrscheinlich größten Entwicklungsfaktoren dar. So bezeichnet Seifert (2006, S. 29) „den Wunsch nach Individualität, zunehmendem Informationsniveau und Informationsanspruch als prägnante Bedarfs- und Verhaltensmuster des Konsumenten“ und zeigt den gestiegenen Anspruch des Konsumenten auf. Zudem sorgt ein nicht zu unterschätzender Wertewandel von „der Befriedigung der Grundbedürfnisse“ hin zur „Überflussgesellschaft“ (vgl. Lammers, 2012) für die Erkenntnis, dass Kunden immer weniger auf den eigentlichen Erwerb der Waren aus sind, als auf das Erlebnis beim Kauf.
Des Weiteren wirkt sich die Position des Handels auf die Entwicklung der Industrie aus. Lammers (2006, S. 41) sieht in dem zunehmenden Vordringen von Discountern auf den Markt und die steigende Bedeutung von Handelsmarken einen Grund für Verschiebungen. Handelsmarken, definiert als „Eigenmarken der Einzelhandelsunternehmen“ (vgl. Nielsen, 2013) bieten eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber hochpreisigen Herstellern und ermöglichen dem „Handel so zunehmend die Rolle des Marktgestalters“ (Seifert, 2006, S. 41).
Die entstandene Konsummentalität des Verbrauchers und die verschobenen Positionen von Hersteller und Handel sorgen für eine Weiterentwicklung der Industrie und zwingen zu einer Reaktion um den „Einklang“ zu wahren. Da die Reaktionsmöglichkeiten zur eigenen Optimierung nahezu ausgeschöpft sind, zielt der Fokus auf die Kooperation zwischen den Wertschöpfungspartnern ab.
So ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, dem Leser in den folgenden vier Kapiteln einen Einblick in das Konzept „Efficient Consumer Response“ (ECR), als mögliches Lösungskonzept, zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. ECR-Konzept
- 2.1 Definition, Ziele und Strategiewandel
- 2.2 Basisstrategien ECR
- 2.2.1 Enabling Technologies
- 2.2.2 Supply Side (logistikorientiert)
- 2.2.3 Demand Side (marketingorientiert)
- 3. ECR Implementierung am Beispiel Manor AG
- 3.1 Unternehmen und Unternehmensstruktur
- 3.2 Die ersten Schritte auf dem Weg zur Implementierung
- 3.2.1 Electronic Data Interchange
- 3.2.2 Logistikmodernisierung
- 3.3 Implementierung auf der Supply Side
- 3.3.1 Die Einführung von Efficient Unit Loads
- 3.3.2 Die Einführung von Cross Docking
- 3.3.3 Die Einführung von Vendor Managed Inventory
- 3.4 Implementierung auf der Demand Side
- 3.4.1 Die Einführung von Category Management
- 3.4.2 Entwicklung weiterer Projekte
- 4. Diskussion
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Efficient Consumer Response (ECR) und dessen Implementierung bei der Manor AG. Ziel ist es, das ECR-Konzept zu erläutern und anhand eines Praxisbeispiels zu veranschaulichen, wie die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Handel optimiert werden kann.
- Definition und Ziele von ECR
- Basisstrategien von ECR (Supply und Demand Side)
- Implementierung von ECR bei der Manor AG
- Analyse der Auswirkungen der ECR-Implementierung
- Diskussion der Vor- und Nachteile von ECR
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der Konsumgüterindustrie und die sich verändernde Beziehung zwischen Herstellern, Handel und Konsumenten. Der Fokus liegt auf dem gestiegenen Anspruch des Konsumenten an Individualität und Information sowie dem Einfluss von Discountern und Handelsmarken auf die Marktpositionierung. Die Arbeit wird als Untersuchung des ECR-Konzepts als mögliches Lösungsmodell für die Herausforderungen der Branche vorgestellt.
2. ECR-Konzept: Dieses Kapitel definiert Efficient Consumer Response (ECR) als umfassendes Managementkonzept zur Optimierung von Waren- und Informationsflüssen. Es werden die Ziele von ECR erläutert, die sowohl auf die Bedürfnisse des Verbrauchers als auch auf eine effiziente Reaktion des gesamten Wertschöpfungsprozesses abzielen. Das Kapitel beschreibt den notwendigen Strategiewandel und erarbeitet die Basisstrategien des ECR-Modells, die sich in die Supply Side (logistikorientiert) und die Demand Side (marketingorientiert) unterteilen lassen.
3. ECR Implementierung am Beispiel Manor AG: Dieses Kapitel analysiert die praktische Umsetzung von ECR bei der Manor AG. Es beschreibt zunächst das Unternehmen und seine Struktur, bevor die schrittweise Implementierung von ECR-Maßnahmen erläutert wird. Hierbei werden sowohl die Supply-Side-Maßnahmen wie die Einführung von Efficient Unit Loads, Cross Docking und Vendor Managed Inventory, als auch die Demand-Side-Maßnahmen wie Category Management detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung der theoretischen Konzepte mit der praktischen Umsetzung bei Manor.
Schlüsselwörter
Efficient Consumer Response (ECR), Supply Chain Management (SCM), Manor AG, Konsumgüterindustrie, Warenflussoptimierung, Informationsfluss, Handelsmarken, Logistik, Marketing, Category Management, Vendor Managed Inventory, Cross Docking, Efficient Unit Loads, Strategiewandel, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: Implementierung von Efficient Consumer Response (ECR) bei der Manor AG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Efficient Consumer Response (ECR) und dessen Implementierung bei der Manor AG. Sie erläutert das ECR-Konzept und veranschaulicht anhand eines Praxisbeispiels, wie die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Handel optimiert werden kann.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Ziele von ECR, Basisstrategien von ECR (Supply und Demand Side), Implementierung von ECR bei der Manor AG, Analyse der Auswirkungen der ECR-Implementierung und Diskussion der Vor- und Nachteile von ECR.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, ECR-Konzept, ECR Implementierung am Beispiel Manor AG, Diskussion und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des ECR-Konzepts und seiner Implementierung.
Was wird im Kapitel "ECR-Konzept" behandelt?
Dieses Kapitel definiert Efficient Consumer Response (ECR) als umfassendes Managementkonzept zur Optimierung von Waren- und Informationsflüssen. Es erläutert die Ziele von ECR, den notwendigen Strategiewandel und die Basisstrategien des ECR-Modells (Supply Side und Demand Side).
Was wird im Kapitel "ECR Implementierung am Beispiel Manor AG" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die praktische Umsetzung von ECR bei der Manor AG. Es beschreibt das Unternehmen und seine Struktur sowie die schrittweise Implementierung von ECR-Maßnahmen. Es werden sowohl Supply-Side-Maßnahmen (Efficient Unit Loads, Cross Docking, Vendor Managed Inventory) als auch Demand-Side-Maßnahmen (Category Management) detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Efficient Consumer Response (ECR), Supply Chain Management (SCM), Manor AG, Konsumgüterindustrie, Warenflussoptimierung, Informationsfluss, Handelsmarken, Logistik, Marketing, Category Management, Vendor Managed Inventory, Cross Docking, Efficient Unit Loads, Strategiewandel und Kooperation.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, das ECR-Konzept zu erläutern und anhand des Praxisbeispiels Manor AG zu veranschaulichen, wie die Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Handel optimiert werden kann. Sie analysiert die Auswirkungen der ECR-Implementierung und diskutiert Vor- und Nachteile des Konzepts.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Einleitung, ECR-Konzept (mit Unterpunkten zu Definition, Zielen, Strategien und Basisstrategien auf Supply und Demand Side), ECR Implementierung am Beispiel Manor AG (mit detaillierten Unterpunkten zur Unternehmensstruktur und den einzelnen Implementierungsschritten auf Supply und Demand Side), Diskussion und Fazit.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz und prägnant beschreiben. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt und die Ergebnisse jedes Kapitels.
- Citar trabajo
- Theresa Wetzel (Autor), 2013, Efficient Consumer Response (ECR) am Beispiel Manor AG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273202