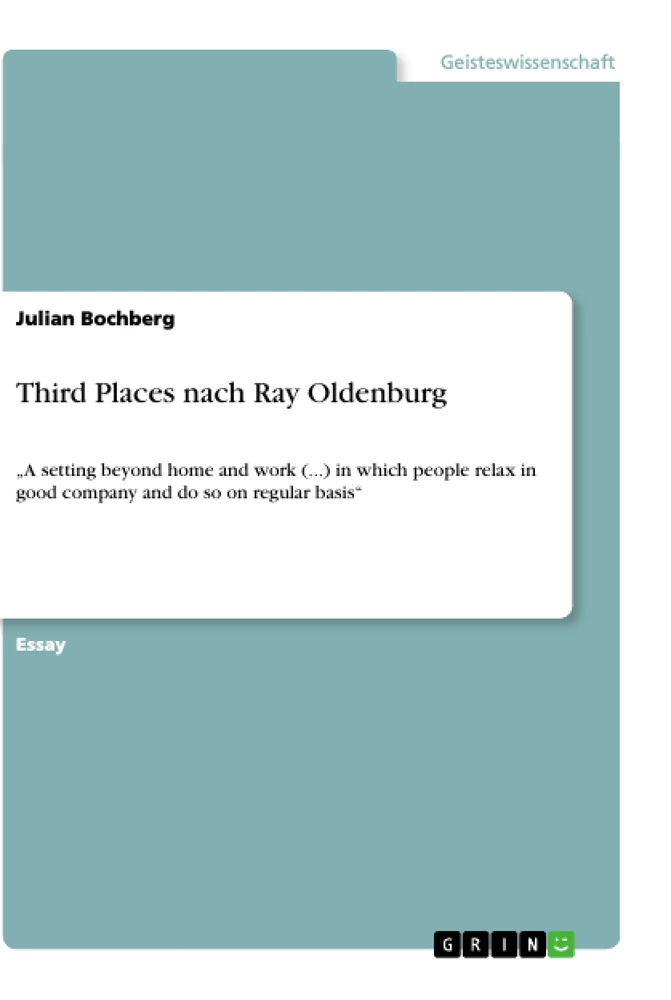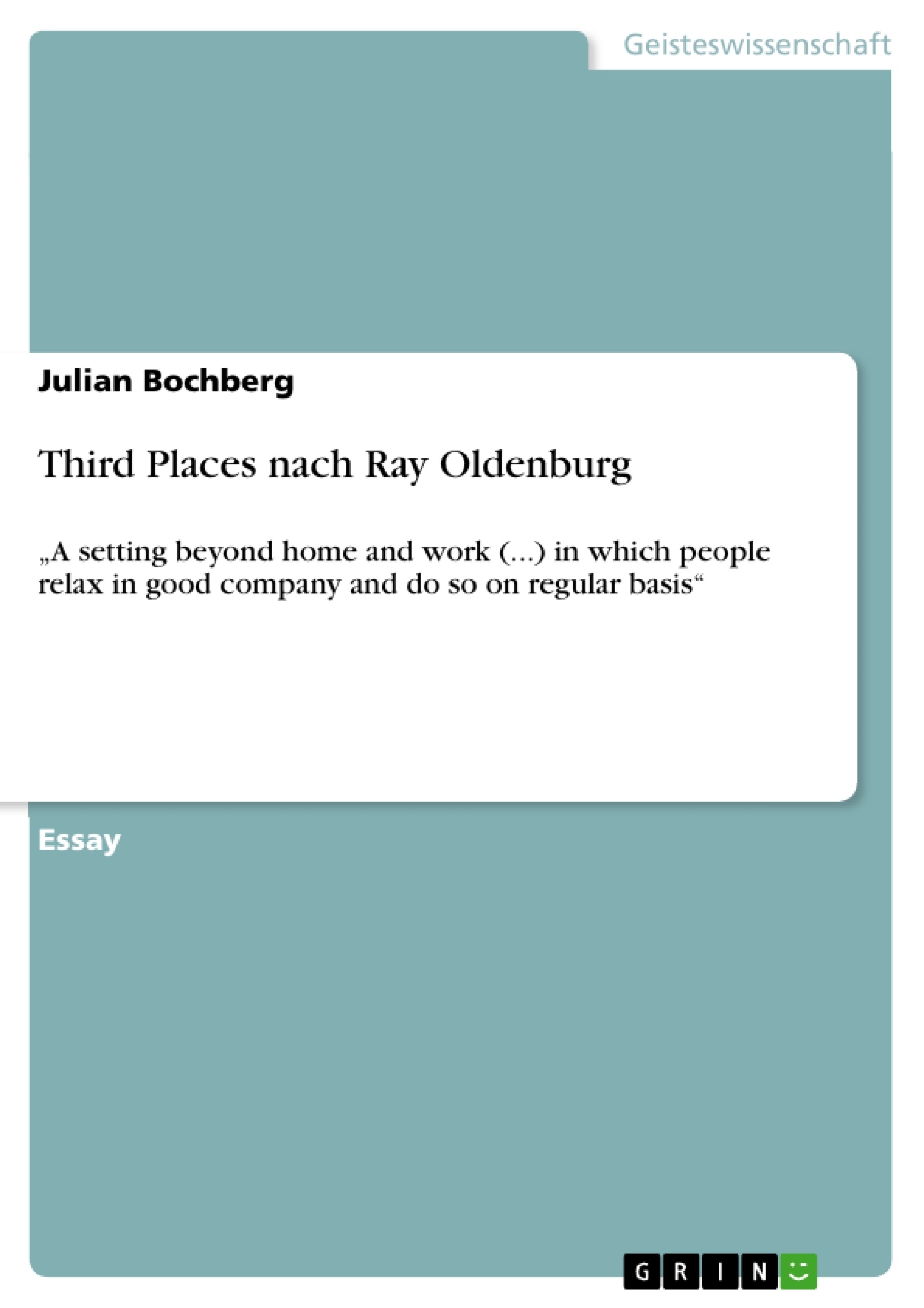Der dritte Raum stellt einen kollektiven Treffpunkt dar, an dem Menschen miteinander in Interaktionen treten, ein Einzelner unter Leuten ist und an dem das Wohlfühlen, der Abstand von Zweifeln und Gedanken, im Vordergrund steht.
Im Gegensatz zu den sogenannten ‚First and Second Places’ ist der dritte Raum für den Besucher ein spontan aufsuchbarer, kommunikativer und geselliger öffentlicher Raum, der zum Abschalten und Entspannen dient. Ray Oldenburg , ein amerikanischer Soziologe, prägte den Begriff des ‚Third Place’ und betitelt diesen als „the core settings of informal public life {...} that host the regular, voluntary, informal, and happily anticipated gatherings of individuals beyond the realms of home and work.“ Dabei ist es wichtig, dass dieser Raum einen neutralen Boden für die aufsuchenden Personen darstellt, die demnach frei in ihren Entscheidungen sind. Beispielweise ist es den jeweiligen Personen überlassen, wie lange sie sich in diesem Raum aufhalten und mit wem sie in Interaktionen treten.
Inhaltsverzeichnis
- 1.4 Ringvorlesung Koblenzer Forschungsfelder
- Der dritte Raum
- Merkmale eines dritten Raumes
- Universitäre Beispiele: Stubbi und Mensa
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Existenz und Charakteristika von „dritten Räumen“ im Sinne Ray Oldenburgs an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz. Die Zielsetzung besteht darin, anhand von Beispielen wie dem universitären Bistro und der Mensa zu analysieren, inwieweit diese Orte die Kriterien eines informellen, öffentlichen Treffpunkts erfüllen, der als Ausgleich zu Wohn- und Arbeitsumfeld dient.
- Definition und Konzept des „dritten Raumes“ nach Oldenburg
- Charakteristika eines „dritten Raumes“: Atmosphäre, Interaktion, Zugänglichkeit
- Analyse universitärer Orte auf ihre Eignung als „dritte Räume“
- Bedeutung von „dritten Räumen“ für das studentische Umfeld
- Abweichungen vom Oldenburger Konzept im universitären Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1.4 Ringvorlesung Koblenzer Forschungsfelder: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt den Begriff des „dritten Raumes“ als kollektiven Treffpunkt, der im Gegensatz zu Wohn- und Arbeitsumfeld Entspannung und soziale Interaktion bietet. Der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg und seine Definition des „Third Place“ werden vorgestellt.
Der dritte Raum: Dieses Kapitel vertieft die Konzeption des „dritten Raumes“ und vergleicht ihn mit dem „First Place“ (Zuhause) und dem „Second Place“ (Arbeitsplatz). Es hebt die Bedeutung der Neutralität, Spontaneität und des Wohlfühlfaktors hervor. Beispiele für Orte, die oft fälschlicherweise als „dritte Räume“ beworben werden, werden angeführt und kritisch beleuchtet. Der Fokus wird auf die Anwendung des Konzepts auf den universitären Kontext gelegt, mit der Einschränkung, dass die Betrachtung aus studentischer Perspektive erfolgt und somit von einer abgewandelten Definition ausgegangen werden muss.
Merkmale eines dritten Raumes: Hier werden die zentralen Merkmale eines „dritten Raumes“ nach Oldenburg detailliert dargestellt. Gemütlichkeit, Neutralität, fehlende Gastgeberrolle, Gleichheit der Teilnehmer und die zentrale Bedeutung der Konversation werden erläutert. Die Bedeutung der Atmosphäre, der spielerischen Stimmung und der Rolle von Stammgästen wird hervorgehoben. Die Bedeutung der Zugänglichkeit und die Notwendigkeit, dass der „dritte Raum“ einen angemessenen Abstand zu Wohn- und Arbeitsumfeld aufweist, wird betont. Es wird klargestellt, dass nicht alle Merkmale zwingend erfüllt sein müssen.
Schlüsselwörter
Dritter Raum, Third Place, Ray Oldenburg, Universität, Campus Koblenz-Landau, informeller öffentlicher Raum, soziale Interaktion, studentische Perspektive, Atmosphäre, Kommunikation, Wohlfühlfaktor, Mensa, Bistro, Stammgäste.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse von "Dritten Räumen" an der Universität Koblenz-Landau
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Existenz und Charakteristika von „Dritten Räumen“ im Sinne Ray Oldenburgs an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz. Konkret werden anhand von Beispielen wie dem universitären Bistro und der Mensa die Kriterien eines informellen, öffentlichen Treffpunkts analysiert, der als Ausgleich zu Wohn- und Arbeitsumfeld dient.
Was sind die zentralen Themen und Ziele?
Die Arbeit definiert und beschreibt das Konzept des „Dritten Raumes“ nach Oldenburg. Sie analysiert die Merkmale eines solchen Raumes (Atmosphäre, Interaktion, Zugänglichkeit) und untersucht, inwieweit universitäre Orte diese Kriterien erfüllen. Weiterhin wird die Bedeutung von „Dritten Räumen“ für das studentische Umfeld beleuchtet und auf Abweichungen vom Oldenburger Konzept im universitären Kontext eingegangen.
Wer ist Ray Oldenburg und welche Rolle spielt er?
Ray Oldenburg ist ein amerikanischer Soziologe, der das Konzept des „Third Place“ (Dritter Raum) geprägt hat. Seine Definition und die von ihm beschriebenen Merkmale bilden die Grundlage dieser Analyse. Die Arbeit untersucht, inwieweit Oldenburgs Konzept auf den universitären Kontext übertragbar ist und gegebenenfalls angepasst werden muss.
Welche Orte werden konkret untersucht?
Die Arbeit analysiert das universitäre Bistro und die Mensa an der Universität Koblenz-Landau als mögliche „Dritte Räume“. Es wird untersucht, ob diese Orte die Kriterien eines informellen, öffentlichen Treffpunkts erfüllen, der als Ausgleich zu Wohn- und Arbeitsumfeld dient.
Welche Merkmale kennzeichnen einen „Dritten Raum“ nach Oldenburg?
Wichtige Merkmale eines „Dritten Raumes“ sind Gemütlichkeit, Neutralität, fehlende Gastgeberrolle, Gleichheit der Teilnehmer, die zentrale Bedeutung der Konversation, eine spielerische Stimmung, die Rolle von Stammgästen, sowie eine angemessene Distanz zu Wohn- und Arbeitsumfeld. Die Arbeit betont, dass nicht alle Merkmale zwingend erfüllt sein müssen.
Welche Einschränkungen gibt es bei der Anwendung des Konzepts im universitären Kontext?
Die Arbeit betrachtet das Konzept des „Dritten Raumes“ aus einer studentischen Perspektive. Daher wird von einer abgewandelten Definition ausgegangen und die spezifischen Gegebenheiten des universitären Kontextes berücksichtigt. Es werden auch Beispiele für Orte kritisch beleuchtet, die oft fälschlicherweise als „Dritte Räume“ bezeichnet werden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Dritter Raum, Third Place, Ray Oldenburg, Universität, Campus Koblenz-Landau, informeller öffentlicher Raum, soziale Interaktion, studentische Perspektive, Atmosphäre, Kommunikation, Wohlfühlfaktor, Mensa, Bistro, Stammgäste.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und abschließende Schlüsselwörter. Die Kapitel befassen sich mit der Ringvorlesung Koblenzer Forschungsfelder, der Konzeption des „Dritten Raumes“, den Merkmalen eines solchen Raumes und der Anwendung des Konzepts auf den universitären Kontext.
- Citation du texte
- Bachelor of Science // Bachelor of Arts Julian Bochberg (Auteur), 2013, Third Places nach Ray Oldenburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273216