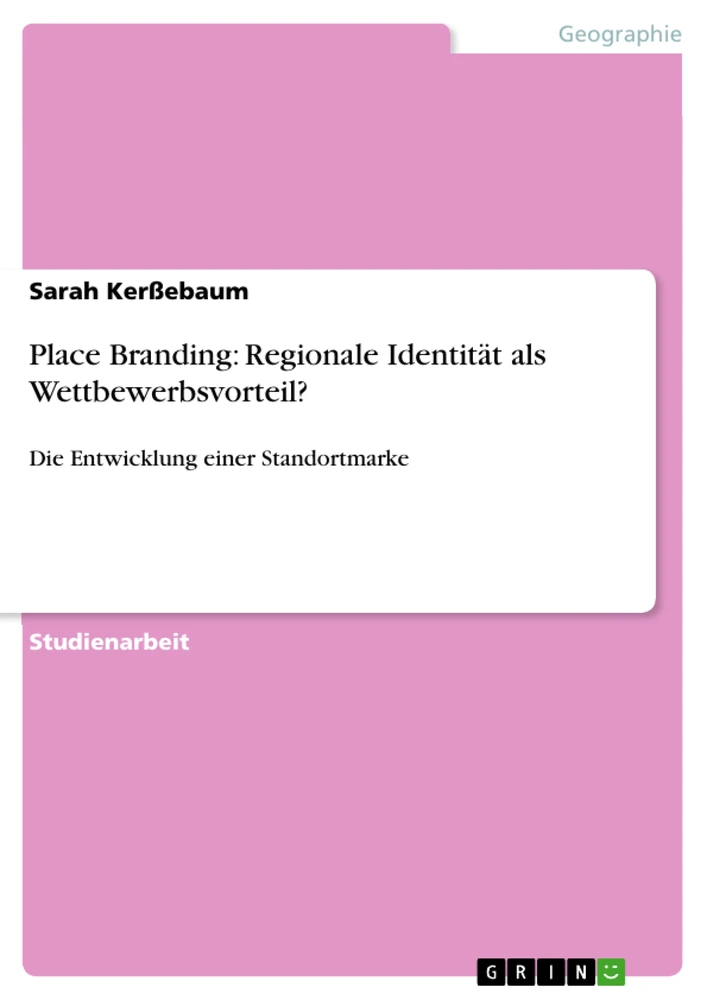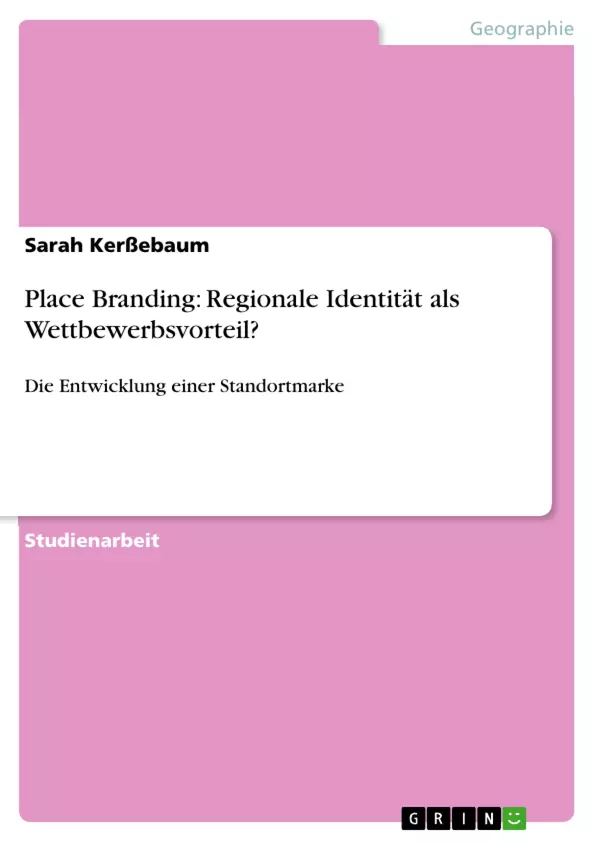Mit den Worten von Simon Anholt beginnend, kein Standort „[…] can now think of surviving, let alone prospering, unless it knows how to wield the weapons of business“ (Anholt, 2010a: 3). Es handelt sich hier um kein neuartiges Phänomen. Seit Anbeginn der Geschichte stehen Orte in einem Konkurrenzkampf um Siedler, Konsumenten, Besucher und Investoren (vgl. Ashworth/Kavaratzis, 2010: 1). Doch gerade in der modernen, von technischem Fortschritt geprägten Welt, scheint diese Erkenntnis immer wichtiger geworden zu sein. Neue Anforderungen an Wirtschaftsstandorte drängen Gemeinden, Städte und Regionen dazu, sich mithilfe einer eigenen Marke im Wettbewerb behaupten zu können. In den letzten Jahren kann man regelrecht von einer „Labelflut“ (Scherer, 2010: 276) sprechen. Umso wichtiger ist es zu erkennen, dass Orte kontinuierlich produziert, wahrgenommen und konsumiert werden durch interaktive Prozesse sowohl in der physischen als auch virtuellen Umgebung (vgl. Govers/Go, 2009: 2). Durch die globale Vernetzung sind Standorte zunehmend globalen Kräften ausgesetzt, auf die auf lokaler Ebene reagiert werden muss. Konsumenten, Besucher und Investoren entwickeln sogenannte „glocal identities“ (Cresswell, 2004: 11) und verfügen über eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es werden Standorte bevorzugt, welche ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse abdecken. Es ist folglich essentiell durch verschiedene Standorttypen unterschiedliche Lebensstile möglich zu machen. Ziel des Place Branding ist somit die Bedeutung und Einzigartigkeit eines jeden Ortes hervorzuheben und nicht auf der gleichen Ebene mit anderen Standorten zu konkurrieren, sondern einen eigenen, einmaligen Pfad zu beschreiten. Hierbei scheint die regionale Identität der Schlüssel zum Erfolg zu sein, um bei den Rezipienten ein positives Image zu festigen. Inspiration für diese neue Form des Managements bieten Strategien des konventionellen Standortmarketing und Corporate Branding (vgl. Hanna/Rowley, 2008: 63). Die Veränderungen in der sozialen und politischen Umwelt machen den mehr identitätsorientierten Ansatz des Place Branding zu einer Notwendigkeit im 21. Jahrhundert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Place Branding
- Definitorische Abgrenzung
- Herkunft des Konzepts
- Ziele und Erfolgsfaktoren
- Identitätsorientiertes Standortmarketing
- Regionale Identität
- Die Rolle des Image
- Øresund Region - best practice?
- Kontext und Strategie
- Bewertung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern marktorientierte Strategien vor dem Hintergrund komplexer regionaler Identitäten ein hilfreiches Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Standorten sein können.
- Definition und Abgrenzung des Place Branding-Konzepts im Vergleich zu herkömmlichen Place Marketing-Strategien
- Analyse der entscheidenden Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Etablierung einer Standortmarke
- Bewertung des Potenzials regionaler Identität als zusätzlichen Wettbewerbsvorteil
- Anwendung des Place Branding-Konzepts anhand des Fallbeispiels Øresund Region
- Abschließende Beurteilung und Ausblick
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Place Branding ein und stellt die Relevanz von Standortmarketing in der heutigen Zeit heraus.
- Das zweite Kapitel beleuchtet das Konzept Place Branding in seinen Facetten. Es werden Definition, Herkunft, Ziele und Erfolgsfaktoren des Konzepts dargestellt.
- Das dritte Kapitel fokussiert auf die Bedeutung regionaler Identität und Imagebildung im Kontext von Place Branding.
- Das vierte Kapitel analysiert die Anwendung des Place Branding-Konzepts in der Praxis anhand des Fallbeispiels Øresund Region.
Schlüsselwörter
Place Branding, Standortmarketing, regionale Identität, Imagebildung, Wettbewerbsvorteil, Øresund Region.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Place Branding?
Es ist die Anwendung von Markenstrategien auf Städte oder Regionen, um deren Einzigartigkeit hervorzuheben und im Wettbewerb um Investoren und Besucher zu bestehen.
Welche Rolle spielt die regionale Identität beim Branding?
Die Identität ist der Schlüssel zum Erfolg, da sie die Grundlage für ein authentisches und positives Image bei den Zielgruppen bildet.
Was ist die Øresund-Region und warum ist sie ein Beispiel für Place Branding?
Die Region verbindet Dänemark und Schweden; sie nutzt gezieltes Marketing, um sich als integrierter und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort zu positionieren.
Was unterscheidet Place Branding von klassischem Standortmarketing?
Place Branding ist identitätsorientierter und langfristiger angelegt, während klassisches Marketing oft kurzfristige Verkaufsziele verfolgt.
Warum stehen Orte heute in einem stärkeren Konkurrenzkampf?
Durch die globale Vernetzung und Mobilität können Investoren und Fachkräfte freier wählen, was Standorte zwingt, ihre Vorteile deutlicher zu kommunizieren.
- Citar trabajo
- Sarah Kerßebaum (Autor), 2014, Place Branding: Regionale Identität als Wettbewerbsvorteil?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273229