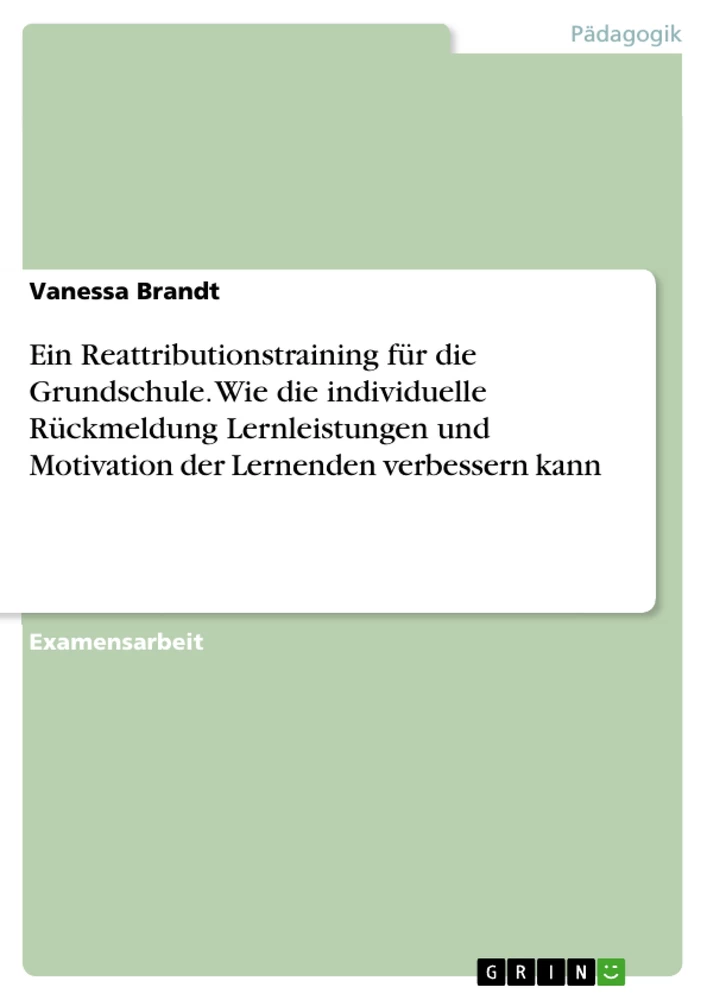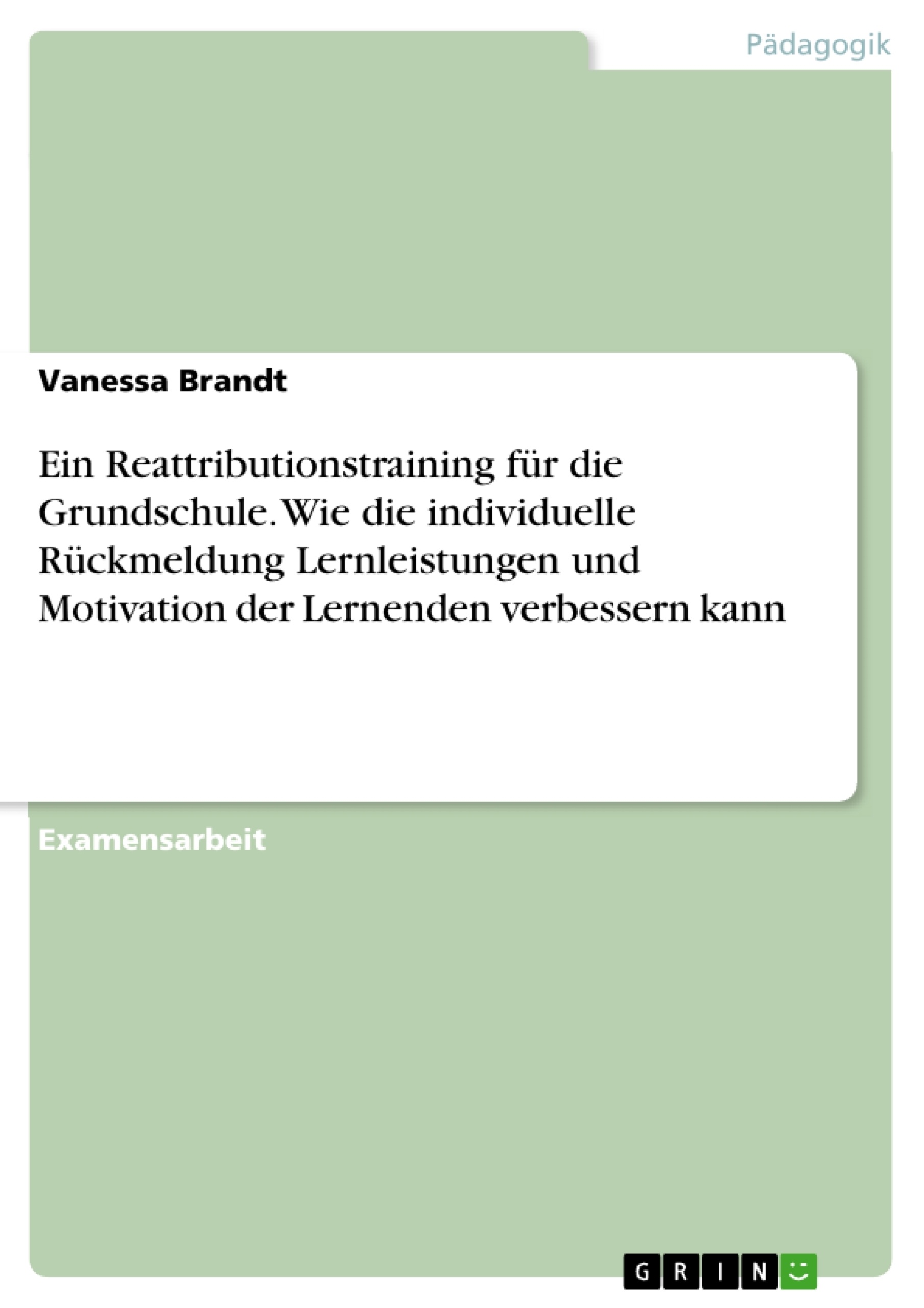Diese Arbeit befasst sich mit der Auswirkung der individuellen Rückmeldung auf die Lernleistung, die Motivation und auf den Attributionsstil der Schülerinnen und Schüler. Im Theorieteil werden die Themen Motivation, Attribution, Reattributionstrainings und Feedback und die Zusammenhänge wissenschaftlich dargelegt. Die dargestellten Zusammenhänge werden mit einer empirischen Untersuchung, die in einer Grundschule durchgeführt wurde, bestätigt. Durchgeführt wurde ein Reattributionstraining in Form von schriftlichen und mündlichen individuellen Rückmeldungen zu Leistungen im Fach Mathematik.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MOTIVATION
- Definition Motivation
- Grundlagen der Motivationsforschung
- Motivation in einer Lern- und Leistungsumgebung
- Zielorientierung
- Bezugsnormen
- KAUSALATTRIBUTION
- Definition von Attribution und Attributionstheorien
- Entwicklung der Attributionstheorie
- Die erlernte Hilflosigkeit
- Das Kovariationsprinzip
- Dimensionskonzepte
- Dimensionen der Kausalattribution
- Kausalattribution in einer Leistungsumgebung
- REXITRIBUTIONSTRAINING
- Theoretische Grundlagen
- Günstige Attributionstendenzen
- Techniken des Reattributionstrainings
- Modellierungstechniken
- Kommentierungstechniken
- FEEDBACK
- Definition und Bedeutung von Feedback
- Feedbackformen
- Kriterien für ein gelungenes Feedback
- Funktion und Wirkung von Feedback
- Individuelles Feedback
- Feedback in schriftlicher Form
- Feedback in mündlicher Form
- EIGENES FORSCHUNGSVORHABEN
- METHODE
- Stichprobe
- Training
- Instrumente
- Mathematikleistungstest
- Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)
- Attributionsstil-Fragebogen für Kinder und Jugendliche (ASF-KJ)
- Durchführung
- ERGEBNISSE
- Mathematikleistung
- Motivation
- Lernzielorientierung
- Annäherungsleistungszielorientierung
- Vermeidungsleistungszielorientierung
- Arbeitsvermeidungszielorientierung
- Kausalattribution
- Positive Ereignisse
- Negative Ereignisse
- DISKUSSION
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Interpretation und Reflektion der Ergebnisse
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Auswirkungen eines Reattributionstrainings auf die Lernleistung, Motivation und den Attributionsstil von Grundschülern. Das Training basiert auf individuellen Rückmeldungen in mündlicher und schriftlicher Form, die selbstwert- und motivationsförderliche Aspekte beinhalten. Ziel ist es, die Lernmotivation der Schüler zu steigern und ihren Attributionsstil zu verändern, sodass sie Erfolge eher auf internale Ursachen zurückführen und Misserfolge eher auf mangelnde Anstrengung attribuieren.
- Die Bedeutung von Motivation und Attribution für den Lernerfolg
- Die Auswirkungen von Feedback auf die Lernmotivation und den Attributionsstil
- Die Wirksamkeit von Reattributionstrainings zur Förderung der Lernleistung und Motivation
- Die Rolle der individuellen Rückmeldung bei der Gestaltung eines effektiven Reattributionstrainings
- Die praktische Relevanz der Ergebnisse für den pädagogischen Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Problematik der unterschiedlichen Auswirkungen von Lehrer-Rückmeldung auf die Motivation und Lernleistung von Schülern heraus. Das erste Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Motivation und stellt verschiedene Motivationstheorien vor, darunter die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan. Der Fokus liegt auf der Motivation in einer Lern- und Leistungsumgebung, insbesondere auf der Zielorientierung von Schülern und den Bezugsnormen bei der Bewertung von Leistungen.
Das zweite Kapitel behandelt das Thema Kausalattribution und erläutert die Entwicklung der Attributionstheorie, ausgehend von der Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Es werden Kelleys Kovariationsprinzip und verschiedene Dimensionskonzepte der Kausalattribution vorgestellt, die zur Erklärung von Erfolg und Misserfolg herangezogen werden können. Der Zusammenhang zwischen Kausalattribution und Leistung in einer Leistungsumgebung wird ebenfalls beleuchtet.
Das dritte Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen des Reattributionstrainings vor und erläutert die Bedeutung von günstigen Attributionstendenzen für den Lernerfolg. Es werden verschiedene Techniken des Reattributionstrainings vorgestellt, die auf Modellierungs- und Kommentierungstechniken basieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung von Kommentierungstechniken im Rahmen des eigenen Forschungsvorhabens.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Feedback und erläutert die Definition und Bedeutung von Feedback in Lehr-Lernkontexten. Verschiedene Feedbackformen werden vorgestellt, wobei der Fokus auf den Feedbacktypen von Hattie und Timperley liegt, die für die Reattribution relevant sind. Es werden Kriterien für ein gelungenes Feedback und die Funktion und Wirkung von Feedback erläutert. Abschließend wird auf das individuelle Feedback in schriftlicher und mündlicher Form eingegangen.
Das fünfte Kapitel umreißt das eigene Forschungsvorhaben, das die Auswirkungen von individuellen Rückmeldungen auf die Lernleistung, Motivation und Attribution von Grundschülern untersucht. Es wird ein Reattributionstraining auf der Basis von Kommentierungstechniken in einer 4. Klasse durchgeführt.
Der Methodenteil beschreibt die Stichprobe, das Training, die Instrumente und die Durchführung der Untersuchung. Es werden die Mathematikleistungstests, die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO) und der Attributionsstil-Fragebogen für Kinder und Jugendliche (ASF-KJ) vorgestellt.
Das siebte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die sowohl in tabellarischer Form als auch anhand von Abbildungen dargestellt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Experimentalgruppe im Mathematikleistungstest signifikant höhere Zuwächse erzielt als die Kontrollgruppe. Auch die Motivation der Experimentalgruppe zeigt positive Veränderungen. Der Attributionsstil der Schüler bezüglich der Mathematikleistungsergebnisse konnte durch das Reattributionstraining ebenfalls positiv beeinflusst werden.
Die Diskussion fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und interpretiert diese im Kontext der theoretischen Grundlagen. Es werden die praktische Bedeutsamkeit der Ergebnisse und die Implikationen für den pädagogischen Alltag beleuchtet. Der Ausblick stellt die Grenzen der Untersuchung dar und formuliert Vorschläge für zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Motivation, Attribution, Reattributionstraining, Feedback, Lernleistung, Lernmotivation, Attributionsstil, Grundschule, Mathematik, individuelle Rückmeldung, selbstwertförderliche Rückmeldung, motivationsförderliche Rückmeldung, Lernzielorientierung, Arbeitsvermeidung, pädagogischer Alltag.
- Citar trabajo
- Vanessa Brandt (Autor), 2013, Ein Reattributionstraining für die Grundschule. Wie die individuelle Rückmeldung Lernleistungen und Motivation der Lernenden verbessern kann, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273370