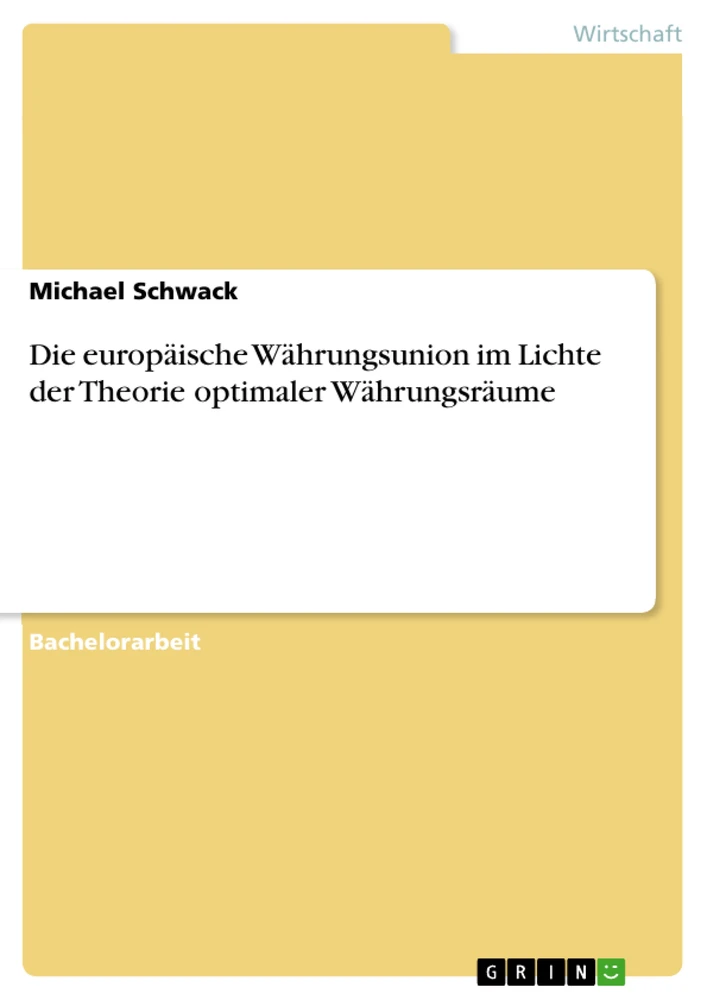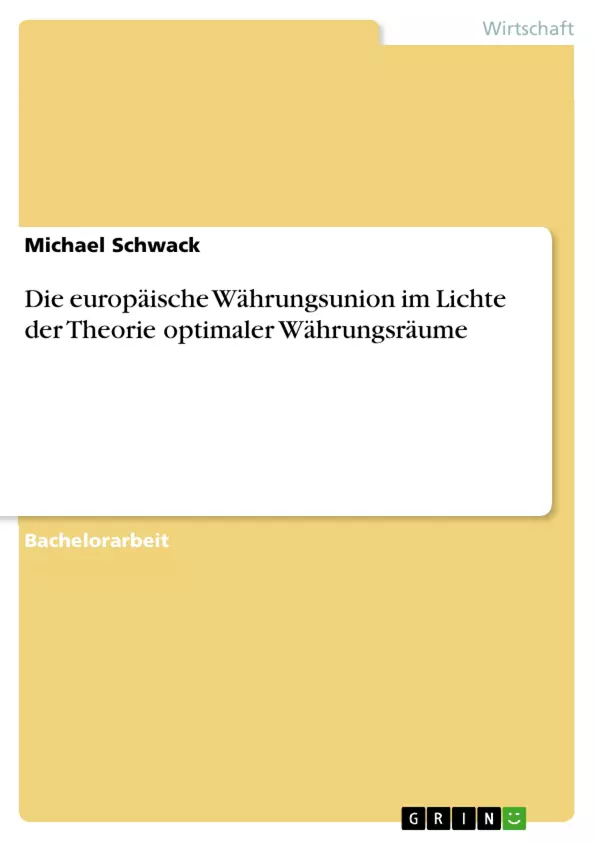Ein gutes Jahrzehnt nach Einführung des Euro innerhalb des europäischen Währungsraumes steht dieser in der Kritik. Dies zeigt sich vor allem an den negativen Berichterstattungen über den Euro selbst und über die „Hüterin des Euro“: die Europäische Zentralbank. Im Fokus der Kritik steht insbesondere ihr Ankauf von Staatsanleihen hochverschuldeter Länder Europas, für die die solventen Länder der Währungsunion mit haften. Die Kritik gegen den Euro zeigt sich unter anderem darin, dass die Bundespartei „Alternative für Deutschland“, kurz AfD, als ersten Punkt in ihrem Wahlprogramm „eine geordnete Auflösung des Euro-Währungsgebietes“ fordert. Lediglich ein halbes Jahr nach ihrer Gründung am 06. Februar 2013 , verpasste sie mit 4,7% der Wählerstimmen knapp den Einzug in den deutschen Bundestag. Das zentrale Argument der AfD, Europa sei kein optimaler Währungsraum , soll in dieser Arbeit wissenschaftlich untersucht werden.
Dazu wird in Kapitel 2 die Entstehungsgeschichte des Euro in ihren Grundzügen skizziert. In einem Zwischenfazit wird die Einhaltung der Konvergenzkriterien bewertet, da in dieser Arbeit die These zugrunde gelegt wird, dass diese Kriterien einen Einfluss auf den Erfolg der Europäischen Währungsunion, kurz EWU, ausüben. Zur Verifizierung dieser These wird in Kapitel 3 zunächst der Begriff der Währungsunion in ihrer optimalen Form definiert, bevor die Vor- und Nachteile eines Beitritts in eine Währungsunion im Detail diskutiert werden. Die oben genannte These, dass es sich bei der Europäischen Währungsunion um keine erfolgreiche Währungszone handelt, wird anschließend anhand einer Analyse mit den Vor- und Nachteilen vorgenommen. Dazu werden in einem nächsten Schritt drei traditionelle Theorien einer optimalen Währungsunion ausführlich beschrieben, die die zuvor beschriebenen Nachteile zu lösen versuchen. Kapitel 4 bewertet die EWU in Bezug auf diese Theorien von optimalen Währungsräumen und benennt zentrale Steuerungsmechanismen, die für den Erfolg der Union notwendig wären.
Im Fazit werden die Ergebnisse zusammenfassend gebündelt und systematisiert. Abschließend wird zu der Frage Stellung bezogen, inwieweit es sich bei der EWU um eine optimale Währungsunion handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte und Entstehung des Euro-Raumes
- Notwendigkeit eines Euro-Raumes
- Umsetzung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
- Binnenmarkt
- Freier Warenverkehr
- Personenverkehrsfreiheiten
- Dienstleistungsfreizügigkeit
- Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit
- Die erste Stufe der EWU
- Die zweite Stufe der EWU
- Die dritte Stufe der EWU
- Der Maastricht-Vertrag als Voraussetzung für den Eintritt in die EWU
- Konvergenzkriterien
- Preisstabilität
- Solide Staatsfinanzen
- Wechselkursstabilität
- Niveau der langfristigen Zinssätze
- Zwischenfazit über die Einhaltung der Konvergenzkriterien in der EWU
- Optimale Währungsräume
- Beurteilung von Währungsräumen
- Der Vergleich mit der EWU
- Asymmetrische Schocks als Gefährdung einer optimalen Währungsunion
- Theorien von optimalen Währungsräumen
- Die Theorie von Mundell
- Die Theorie von McKinnon
- Die Theorie von Kenen
- Vergleich der Währungstheorien mit der EWU
- Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entstehung der Europäischen Währungsunion (EWU) und bewertet deren Auswirkungen auf die Euro-Mitgliedsstaaten im Lichte der Theorie optimaler Währungsräume. Ziel ist es, die Entwicklung der EWU im Kontext ihrer historischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu untersuchen und festzustellen, ob die Eurozone den Kriterien optimaler Währungsräume gerecht wird.
- Entwicklung der EWU und des Euro
- Theoretische Grundlagen von optimalen Währungsräumen
- Bewertung der EWU im Lichte der Theorien
- Asymmetrische Schocks und ihre Auswirkungen auf die Währungsunion
- Die Rolle von Faktormobilität, Offenheitsgrad und Diversifikationsgrad
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Geschichte und Entstehung des Euro-Raumes beleuchtet. Die Entwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) wird anhand der verschiedenen Phasen der Integration dargestellt, wobei der Fokus auf die Notwendigkeit eines gemeinsamen Währungsraums und die Umsetzung der Währungsunion liegt. Der Maastricht-Vertrag und seine Konvergenzkriterien, die den Eintritt in die EWU ermöglichen, werden ebenfalls analysiert.
Kapitel 3 widmet sich den Theorien optimaler Währungsräume und präsentiert die wichtigsten Ansätze von Mundell, McKinnon und Kenen. Diese Theorien liefern ein theoretisches Framework, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Währungsunion zu bewerten. Die Anwendung dieser Theorien auf die EWU ermöglicht es, die euro-spezifischen Herausforderungen und Chancen zu analysieren.
Schlüsselwörter
Europäische Währungsunion, Euro, optimale Währungsräume, Mundell-Fleming-Modell, Theorie optimaler Währungsräume, Asymmetrische Schocks, Faktormobilität, Offenheitsgrad, Diversifikationsgrad, Konvergenzkriterien, Maastricht-Vertrag.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Europäische Währungsunion ein optimaler Währungsraum?
Die Arbeit untersucht diese Frage wissenschaftlich anhand klassischer Theorien und analysiert, ob die Eurozone die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Währungsunion erfüllt.
Welche Theorien optimaler Währungsräume werden behandelt?
Es werden die drei traditionellen Theorien von Robert Mundell, Ronald McKinnon und Peter Kenen ausführlich beschrieben und mit der EWU verglichen.
Was sind die Maastricht-Konvergenzkriterien?
Dazu gehören Preisstabilität, solide Staatsfinanzen (Defizit- und Schuldenstand), Wechselkursstabilität und das Niveau der langfristigen Zinssätze.
Was gefährdet eine optimale Währungsunion?
Besonders asymmetrische Schocks stellen eine Gefahr dar, da betroffene Länder innerhalb einer Währungsunion nicht mehr über das Instrument der Abwertung ihrer eigenen Währung verfügen.
Welche Faktoren sind für den Erfolg des Euro entscheidend?
Wichtige Faktoren sind die Mobilität der Produktionsfaktoren, der Offenheitsgrad der Volkswirtschaften sowie der Grad der Produktdiversifizierung innerhalb des Währungsraums.
- Quote paper
- Michael Schwack (Author), 2013, Die europäische Währungsunion im Lichte der Theorie optimaler Währungsräume, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273373