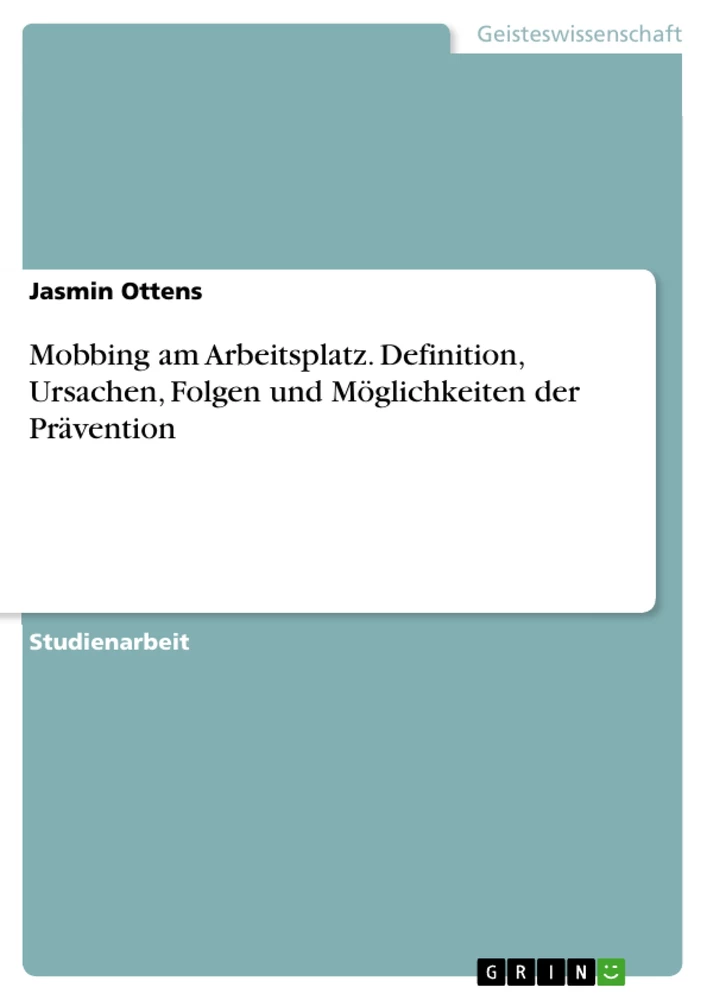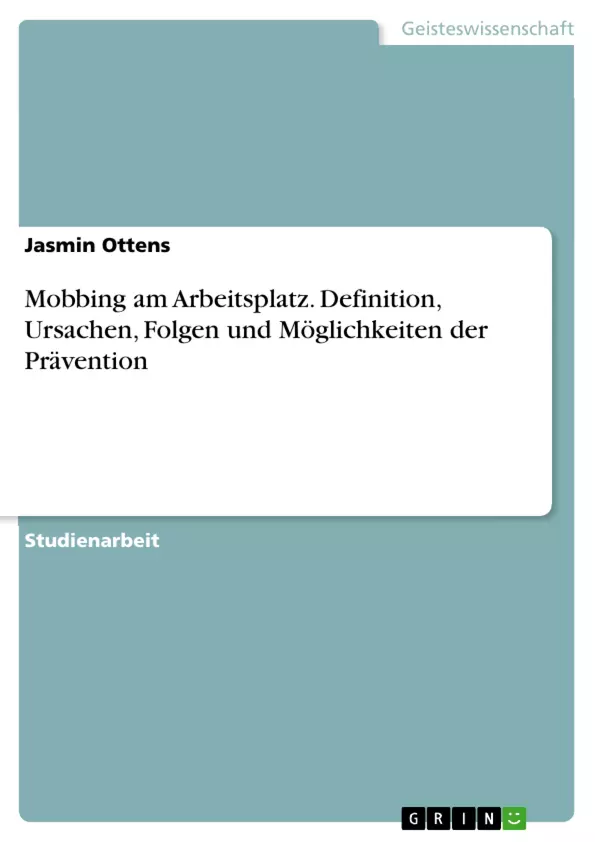Ich habe mich für das Thema „Mobbing“ entschieden, da dies uns alle betrifft. Es kann jeden treffen, unabhängig von der Hautfarbe, dem sozialen Status oder anderen menschlichen Merkmalen. Mobbing findet in allen Kontexten statt, ob am Arbeitsplatz oder in der Schule. In dieser Hausarbeit richte ich den Fokus auf Mobbing am Arbeitsplatz, wobei zu beachten ist, dass der Inhalt genauso auf andere Bereiche bezogen werden kann, wie zum Beispiel Mobbing in der Schule oder in der Universität. In dieser Arbeit ist nur eine oberflächliche Betrachtung der Situation „Mobbing am Arbeitsplatz“ möglich und könnte durchaus ausführlicher beschrieben werden, was mir leider aus Platzgründen nicht möglich ist.
Aufgrund meiner Recherchen wird ersichtlich, dass nicht nur bestimmte Berufsgruppen betroffen sind, sondern dass Mobbing überall stattfindet. Selbst Ärzte, Juristen oder Professoren gehören zu den Mobbingopfern. Des Öfteren kommt es vor, dass der Begriff Mobbing völlig falsch präsentiert wird, z.B. in den Medien und dabei vorschnell banale Konflikte, als Mobbing ausgelegt werden. Dennoch besteht gesellschaftlich ein Konsens darüber, dass es sich bei Mobbing um Vorgänge handelt, denen entgegengewirkt werden muss. Möglichkeiten der Prävention und Intervention werde ich im Laufe dieser Arbeit vorstellen. Darüber hinaus, möchte ich auf den Begriff Mobbing und seine Definition, die Ursachen und Gründe für Mobbing, den typischen Verlauf einer Mobbingsituation, die Häufigkeit von Mobbing und die Auswirkungen auf das einzelne Individuum eingehen. Natürlich gibt es weitaus mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zu der Thematik Mobbing, doch ich beschränke mich auf die meiner Meinung nach wichtigsten:
1. Mobbing muss von typischen Stresssituationen am Arbeitsplatz abgegrenzt werden.
2. Mobbing ist multikausal.
3. Mobbing ist kein harmloser Akt, sondern hat Konsequenzen (körperlich / juristisch).
4. Gegen Mobbing muss etwas unternommen werden (Prävention / Intervention).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung / Problematik
- Der Begriff „Mobbing“
- Die Herkunft
- Definition
- Mobbinghandlungen nach H. Leymann
- Die Häufigkeit von Mobbing
- Mobbing, aber wieso? Ursachen auf zwei Ebenen
- Die berufliche Ebene
- Die menschliche / persönliche Ebene
- Der typische Verlauf einer Mobbingsituation
- Die vier Phasen des Mobbingprozesses
- Die Auswirkungen von Mobbing
- Mobbing: Prävention und Intervention
- Mögliche Präventionsmaßnahmen
- Mögliche Interventionsmaßnahmen
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Mobbing am Arbeitsplatz und analysiert dessen Ursachen, Verlauf und Auswirkungen. Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Mechanismen von Mobbing zu beleuchten und Präventions- sowie Interventionsmaßnahmen aufzuzeigen.
- Definition und Herkunft des Begriffs „Mobbing“
- Ursachen von Mobbing auf beruflicher und menschlicher Ebene
- Der typische Verlauf einer Mobbingsituation in vier Phasen
- Auswirkungen von Mobbing auf Betroffene, Mobber, Belegschaft, Betrieb und Gesellschaft
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Mobbing vor und erläutert die Relevanz des Themas. Der Begriff „Mobbing“ wird definiert und seine Herkunft sowie die Häufigkeit von Mobbing am Arbeitsplatz werden beleuchtet.
Im dritten Kapitel werden die Ursachen für Mobbing auf zwei Ebenen untersucht: der beruflichen Ebene und der menschlichen / persönlichen Ebene. Die berufliche Ebene umfasst Faktoren wie Arbeitsorganisation, Arbeitsgestaltung und das Verhalten der Führungsperson, während die menschliche Ebene negative Emotionen wie Neid, Eifersucht, Rachegelüste und Hass fokussiert.
Kapitel vier beschreibt den typischen Verlauf einer Mobbingsituation anhand eines Vier-Phasen-Modells. Die vier Phasen umfassen Konflikte, den Beginn des Psychoterrors, die offizielle Eskalation und den Ausschluss des Opfers.
Im fünften Kapitel werden die Auswirkungen von Mobbing auf verschiedene Bereiche beleuchtet, darunter die Auswirkungen auf das Mobbingopfer, den Mobber, die Belegschaft, den Betrieb und die Gesellschaft.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Mobbing. Es werden verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die auf die Früherkennung, das positive Arbeitsklima und die Sensibilisierung von Mitarbeitern abzielen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Mobbing, Arbeitsplatz, Ursachen, Verlauf, Auswirkungen, Prävention, Intervention, Arbeitsorganisation, Arbeitsgestaltung, Führungsverhalten, Neid, Eifersucht, Rachegelüste, Hass, Psychoterror, Ausschluss, Arbeitsklima, Sensibilisierung, Mitarbeitermotivation.
- Quote paper
- Jasmin Ottens (Author), 2014, Mobbing am Arbeitsplatz. Definition, Ursachen, Folgen und Möglichkeiten der Prävention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273460