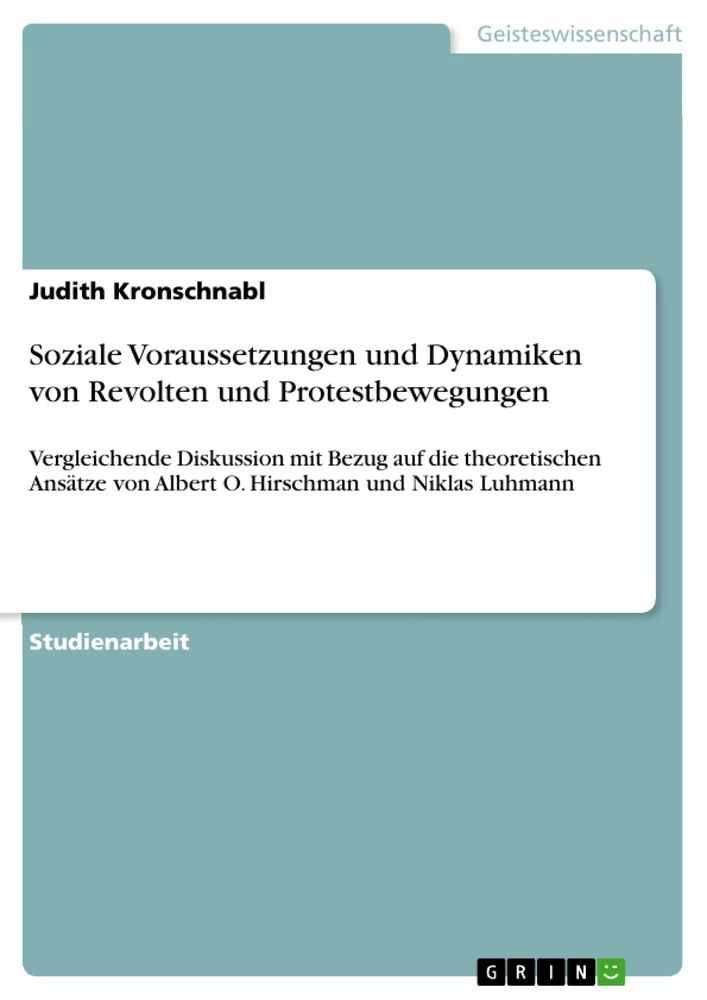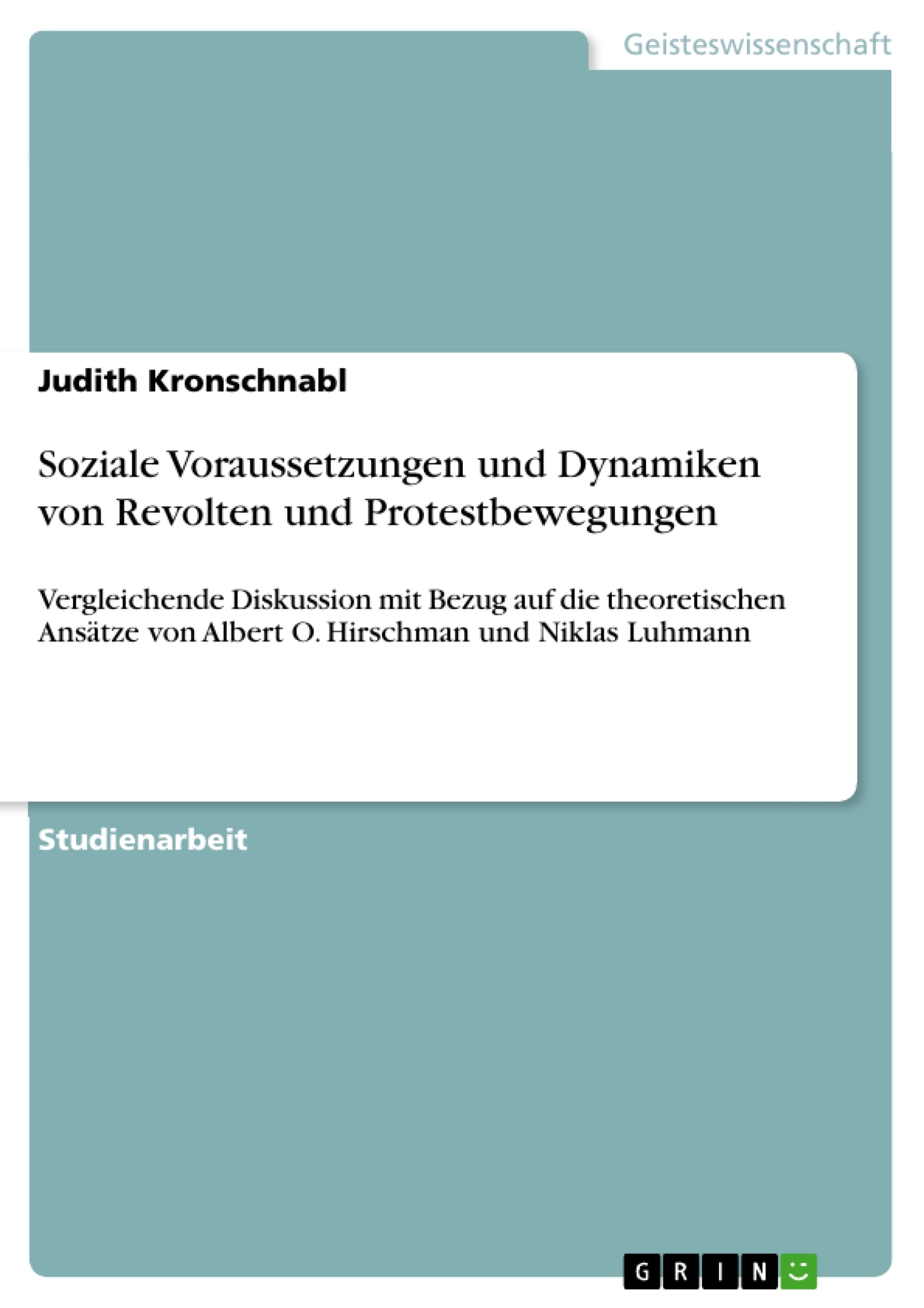Stuttgart 21, die Occupy-Bewegung, „stoppt ACTA“ und nicht zuletzt der sog. arabische Frühling - dies sind nur die aktuellsten Beispiele für Revolten und Protestbewegungen. Egal ob es sich um den Bau eines neuen Bahnhofs, Flugzeuglärm, Datenschutzgesetzte oder gar eine unterdrückende Regierung handelt: Proteste sind Bestandteil des öffentlichen Lebens geworden.
Weltweit gehen Menschen auf die Straße um zu protestieren. Doch wodurch kommt es zum Protest? Genügt Unzufriedenheit oder Enttäuschung um Revolutionen zu starten? Was treibt Menschen an, auf diese Weise am öffentlichen Leben teilzunehmen?
Zur Beantwortung dieser Fragen sollen die Theorien zweier Autoren vorgestellt werden, die das Phänomen des Protests von ganz unterschiedlichen Ausgangs-punkten zu erklären versuchen. Beginnend mit Albert O. Hirschman, der in seinem Buch Engagement und Enttäuschung – Über das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl wirtschaftliche Aspekte mit sozialwissenschaftlichen vereint, wird die These erläutert, dass eine zyklenähnliche Hinwendung vom privaten Konsum zur Teilnahme am öffentlichen Leben (unter anderem zum Protest) existiert, welche sich nicht zuletzt aufgrund von Enttäuschungen vollzieht. Nach dieser eher ökonomischen Analyse wird Niklas Luhmanns Kapitel über Protestbewegungen, aus dessen Buch Soziologie des Risikos, Einblicke in den systemtheoretischen Ansatz ermöglichen.
Diese ganz verschiedenen Sichtweisen sollen dem Leser dieser Hausarbeit einen Überblick darüber geben, welche sozialen Voraussetzungen für die Entstehung von Revolten und Protestbewegungen notwendig sind und welche Dynamiken sich aus ihnen entwickeln können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Albert O. Hirschman – Engagement und Enttäuschung
- Die Theorie
- Soziale Voraussetzungen und Dynamiken
- Niklas Luhmann - Soziologie des Risikos
- Die Theorie
- Soziale Voraussetzungen und Dynamiken
- Vergleichende Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die sozialen Voraussetzungen und Dynamiken von Revolten und Protestbewegungen. Sie setzt sich mit den Theorien von Albert O. Hirschman und Niklas Luhmann auseinander, die unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen des Protests bieten.
- Die Rolle von Enttäuschung und Frustration in Bezug auf politisches Engagement
- Der Einfluss von wirtschaftlichen Faktoren auf die Teilnahme am öffentlichen Leben
- Die systemtheoretische Sichtweise auf Protestbewegungen und ihre sozialen Voraussetzungen
- Die Bedeutung von Risiko und Unsicherheit für die Entstehung von Revolten
- Ein Vergleich der beiden Theorien und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Revolten und Protestbewegungen heraus und beleuchtet aktuelle Beispiele wie Stuttgart 21, die Occupy-Bewegung und den „arabischen Frühling“. Sie führt die Theorien von Hirschman und Luhmann als Ansatzpunkte zur Erklärung des Phänomens ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
2. Albert O. Hirschman – Engagement und Enttäuschung
Dieses Kapitel behandelt die Theorie von Albert O. Hirschman, die auf der Beobachtung basiert, dass sich Phasen intensiver politischer Beteiligung mit Phasen des Rückzugs ins Private abwechseln. Hirschman analysiert die Gründe für diese zyklischen Bewegungen und stellt die These auf, dass Enttäuschung eine zentrale Rolle im Prozess des Präferenzwandels spielt.
2.1. Die Theorie
Hirschman argumentiert, dass jede Form von Aktivität, sei es Konsum oder politisches Engagement, früher oder später zu Enttäuschung und Frustration führen kann. Dies liegt an der Unbegrenztheit der menschlichen Bedürfnisse. Enttäuschung führt zu einem Wechsel der Präferenzen und kann dazu beitragen, dass Menschen sich vom öffentlichen Leben zurückziehen.
2.2. Soziale Voraussetzungen und Dynamiken
Dieser Abschnitt betrachtet die sozialen Voraussetzungen und Dynamiken, die Hirschman mit seiner Theorie verbindet. Er analysiert, wie sich die Wechselwirkung zwischen Enttäuschung und politischem Engagement auf die Entstehung und Entwicklung von Protestbewegungen auswirkt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Revolten, Protestbewegungen, soziale Voraussetzungen, Dynamiken, Enttäuschung, Präferenzwandel, politische Beteiligung, öffentliches Leben, privates Leben, Risiko, Systemtheorie, Engagement, Luhmann, Hirschman.
Häufig gestellte Fragen
Warum nehmen Menschen an Protestbewegungen teil?
Laut Albert O. Hirschman resultiert politisches Engagement oft aus einer Enttäuschung über den privaten Konsum, was zu einem zyklischen Wechsel zum öffentlichen Handeln führt.
Was ist Niklas Luhmanns Sicht auf Protest?
Luhmann betrachtet Protestbewegungen im Kontext der Systemtheorie und der Soziologie des Risikos. Protest ist hier eine Reaktion auf die Risikowahrnehmung moderner Systeme.
Genügt Unzufriedenheit allein für eine Revolte?
Nein, es müssen spezifische soziale Voraussetzungen und Dynamiken (wie Enttäuschungsprozesse oder Systemirritationen) zusammenkommen, damit aus Unzufriedenheit organisierter Protest entsteht.
Was versteht Hirschman unter dem Wechsel zwischen Privatwohl und Gemeinwohl?
Er beschreibt, dass Bürger phasenweise ihr Glück im Privaten suchen und bei Enttäuschung ihre Energie in das öffentliche Engagement (Protest, Politik) investieren.
Welche Rolle spielt das Risiko bei der Entstehung von Protesten?
Das Risiko ist ein zentraler Auslöser; wenn Entscheidungen von Systemen als riskant wahrgenommen werden, bilden sich Protestbewegungen als Korrektiv oder Widerstand.
- Citar trabajo
- Judith Kronschnabl (Autor), 2012, Soziale Voraussetzungen und Dynamiken von Revolten und Protestbewegungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273463