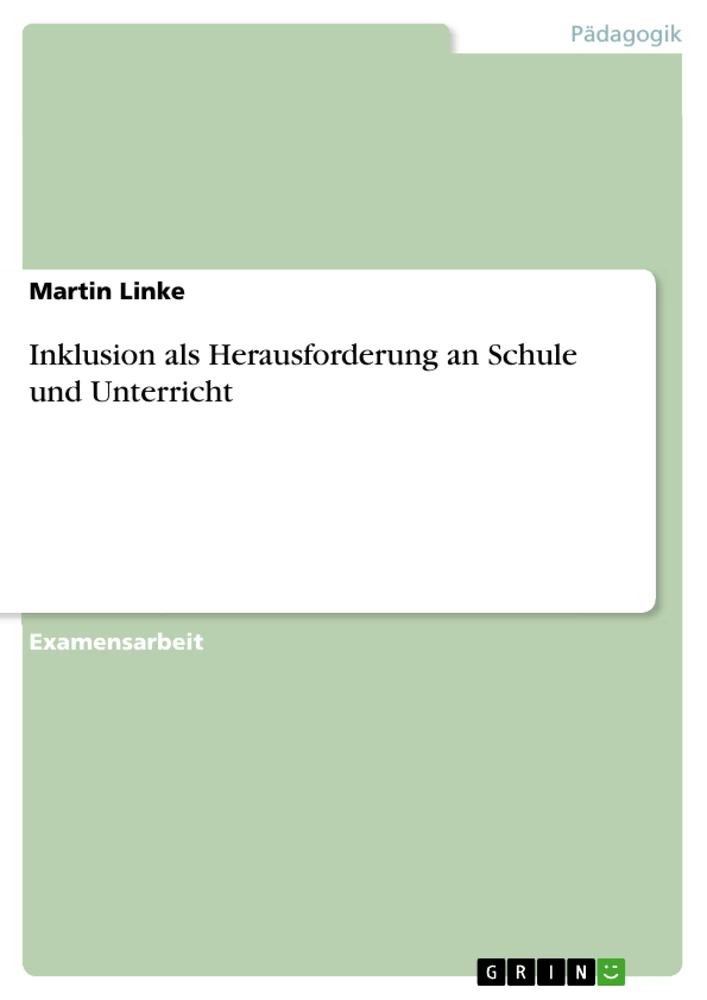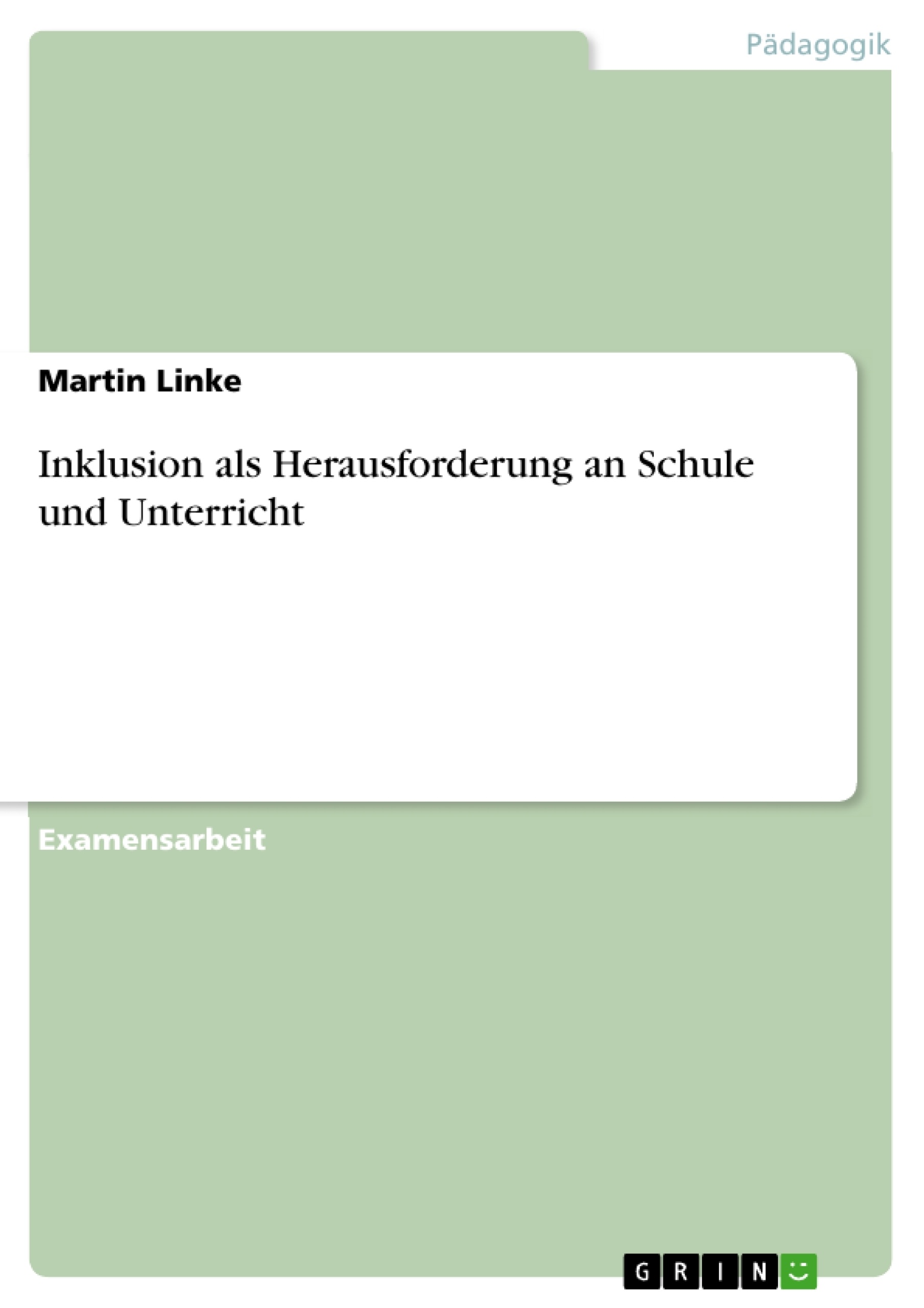Diese Arbeit diskutiert das bildungspolitische Thema der Inklusion. Dabei werden der geschichtliche Kontext und Heterogenität als theoretisches Fundamentum herausgearbeitet. Im Anschluss daran folgt der Hauptteil: Die Umsetzung der Inklusion im aktuellen Schulsystem mit Kritik und Anregungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 2. Inklusion im historischen Kontext
- 2.1. Geschichtliche Entwicklung der sonderpädagogischen Anfänge bis in die Gegenwart
- 2.2. Definition Inklusion
- 2.3. Ruf nach Inklusion
- 3. Heterogenität in inklusiven Lerngruppen
- 3.1. Heterogenitätskonzepte in inklusiver Pädagogik
- 3.2. Entwicklungslogische Didaktik
- 4. Umsetzung im Schulsystem
- 4.1. Vorbehalte von Lehrern und Eltern
- 4.1.1. „Kinder mit Behinderung leiden in integrativen Klassen"
- 4.1.2. „Mein normalbegabtes Kind wird vernachlässigt"
- 4.1.3. „Mein Kind mit Behinderung erfährt keine ausreichende und gerechte Förderung an der Regelschule"
- 4.1.4. „Inklusion stellt eine hohe Belastung für Lehrkräfte dar"
- 4.2. Grundlagenproblem: Lehrkräfte
- 4.3. Aktuelle Problematiken in den Rahmenbedingungen inklusiven Unterrichts
- 4.1. Vorbehalte von Lehrern und Eltern
- 5. Nachhaltigkeit von Inklusion
- 5.1. Schulabschluss
- 5.2. Berufswelt
- 6. Index für Inklusion als Konzept für Inklusion
- 6.1. Der Index als Schlüsselelement inklusiver Pädagogik
- 6.2. Der Index für Inklusion in der Praxis
- 7. Schluss
- 8. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Hausarbeit untersucht Inklusion als Herausforderung an Schule und Unterricht. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der Sonderpädagogik und die Entstehung des Inklusionsgedankens. Sie beleuchtet die Bedeutung von Heterogenität in inklusiven Lerngruppen und stellt didaktische Modelle für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen vor. Die Arbeit untersucht die Umsetzung von Inklusion im Schulsystem, beleuchtet dabei die Vorbehalte von Lehrkräften und Eltern, und analysiert die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches inklusives Schulsystem. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Nachhaltigkeit von Inklusion und stellt die Bedeutung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung heraus. Abschließend stellt die Arbeit den Index für Inklusion als Instrument zur Selbstevaluation von Schulen vor.
- Historische Entwicklung der Sonderpädagogik und der Inklusion
- Heterogenität in inklusiven Lerngruppen und didaktische Modelle
- Umsetzung von Inklusion im Schulsystem und die Herausforderungen für Lehrkräfte und Eltern
- Nachhaltigkeit von Inklusion und die Bedeutung der beruflichen Integration
- Der Index für Inklusion als Instrument zur Selbstevaluation von Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel erörtert die geschichtliche Entwicklung der Sonderpädagogik von der Exklusion über die Separation hin zur Integration. Es werden die Ursprünge der sonderpädagogischen Einrichtungen im 19. Jahrhundert dargestellt, die mit der Einrichtung von Hilfsschulen begannen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Probleme der Integration, wie die Stigmatisierung von Schülern und die Schwierigkeiten bei der Rücküberweisung in die Regelschule. Anschließend wird der Begriff der Inklusion definiert und die Bedeutung der Salamanca-Erklärung und der UN-Behindertenrechtskonvention für die Entwicklung der Inklusion hervorgehoben.
Kapitel 3 untersucht die Bedeutung von Heterogenität in inklusiven Lerngruppen und stellt die performative Theorie der Behinderung als ein relevantes Heterogenitätskonzept vor. Es wird die entwicklungslogische Didaktik nach Georg Feuser vorgestellt, die ein didaktisches Modell für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen bietet. Feuser argumentiert für eine individualisierte Förderung aller Schüler, die gleichzeitig in Kooperation miteinander lernen sollen. Das Kapitel erläutert die Grundprinzipien der entwicklungslogischen Didaktik und stellt die Bedeutung des „Gemeinsamen Gegenstandes" für den inklusiven Unterricht heraus.
Kapitel 4 befasst sich mit der praktischen Umsetzung von Inklusion im Schulsystem. Es werden mögliche Vorbehalte von Lehrkräften und Eltern gegenüber Inklusion diskutiert, wie z.B. die Angst, dass Kinder mit Behinderung in integrativen Klassen leiden oder dass Schüler ohne Behinderung vernachlässigt werden. Die Arbeit widerlegt diese Vorbehalte mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und zeigt die positiven Auswirkungen von Inklusion auf das Lernklima und die schulische Entwicklung aller Schüler auf. Das Kapitel analysiert die Herausforderungen für Lehrkräfte, die sich durch die steigende Heterogenität in inklusiven Lerngruppen ergeben, und beleuchtet die Bedeutung von Teamteaching und der sonderpädagogischen Fortbildung von Lehrkräften. Abschließend werden aktuelle Problematiken in den Rahmenbedingungen inklusiven Unterrichts, wie die Barrierefreiheit von Schulen, der Mangel an Sonderpädagogen und die Schließung von Förderschulen, diskutiert.
Kapitel 5 analysiert die Nachhaltigkeit von Inklusion und untersucht die Situation von Schülern mit Behinderung nach dem Schulabschluss. Es werden aktuelle Zahlen zum Inklusionsanteil in Deutschland präsentiert und die Bedeutung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung hervorgehoben. Die Arbeit stellt verschiedene Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung vor, wie die Arbeitsassistenz und die unterstützte Beschäftigung. Darüber hinaus wird das Projekt „AutoMobil: Ausbildung ohne Barrieren" vorgestellt, das sich für die inklusive betriebliche Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderung einsetzt.
Kapitel 6 stellt den Index für Inklusion als Instrument zur Selbstevaluation von Schulen vor. Die Arbeit erläutert die theoretischen Grundlagen des Index und die Bedeutung der drei Dimensionen „inklusive Kulturen schaffen", „inklusive Strukturen etablieren" und „inklusive Praktiken entwickeln". Der Index bietet Schulen die Möglichkeit, sich selbst einzuschätzen und zu beurteilen, wie inklusiv sie arbeiten. Das Kapitel beschreibt die praktische Anwendung des Index und die fünf Phasen des Index-Prozesses. Abschließend wird ein Beispiel für die Anwendung des Index an einer Gesamtschule in Köln-Holweide vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Inklusion, Sonderpädagogik, Integration, Heterogenität, entwicklungslogische Didaktik, Gemeinsamer Unterricht, Teamteaching, Barrierefreiheit, Schulabschluss, Berufswelt, Arbeitsassistenz, unterstützte Beschäftigung, Index für Inklusion, Selbstevaluation, Schulentwicklung, Bildungsgerechtigkeit, und gesellschaftliche Teilhabe. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen von Inklusion für Schule und Unterricht und analysiert die notwendigen Schritte für eine erfolgreiche Umsetzung von Inklusion in allen Lebensbereichen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit zur Inklusion?
Die Arbeit untersucht Inklusion als Herausforderung für Schule und Unterricht, beleuchtet den historischen Kontext der Sonderpädagogik und analysiert die Umsetzung im aktuellen Schulsystem.
Was versteht man unter entwicklungslogischer Didaktik?
Nach Georg Feuser ist dies ein Modell für heterogene Lerngruppen, bei dem alle Schüler an einem „Gemeinsamen Gegenstand“ kooperativ lernen und individuell gefördert werden.
Welche Vorbehalte haben Eltern und Lehrer gegenüber Inklusion?
Häufige Ängste sind, dass Kinder mit Behinderung in Regelschulen leiden, normalbegabte Kinder vernachlässigt werden oder die Belastung für Lehrkräfte zu hoch ist.
Was ist der „Index für Inklusion“?
Es handelt sich um ein Instrument zur Selbstevaluation von Schulen, um inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken zu etablieren.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention?
Sie ist ein wesentlicher Meilenstein, der das Recht auf inklusive Bildung völkerrechtlich verankert und den Wandel von der Integration zur Inklusion vorangetrieben hat.
Wie wird die Nachhaltigkeit von Inklusion bewertet?
Nachhaltigkeit zeigt sich vor allem im erfolgreichen Schulabschluss und der anschließenden Integration in die Berufswelt, etwa durch Arbeitsassistenz oder unterstützte Beschäftigung.
- Quote paper
- Martin Linke (Author), 2014, Inklusion als Herausforderung an Schule und Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273525