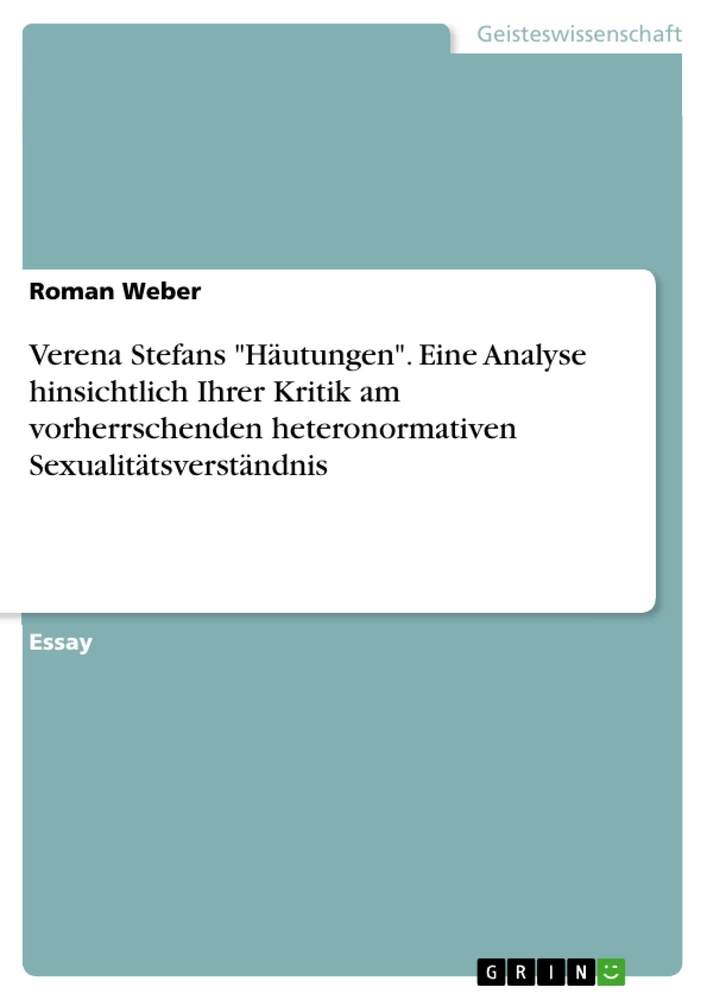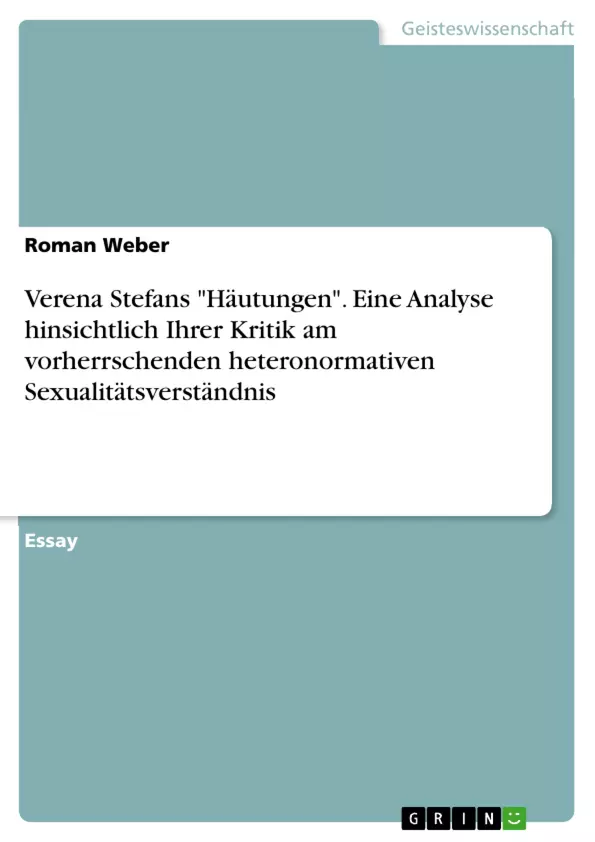Die Problematisierung eines als asymmetrisch verstandenen Machtverhältnisses, das sich insbesondere in der Konstruktion von Geschlechterdichotomien verselbstständigt, erscheint bei Stefan als Topos eines Stark-Schwach-Gegensatzes ausgeleuchtet. Das Patriarchat, bei Stefan dargestellt als gleichsam usurpatorische Herrschaftsform, lässt Frauen, Kindern, Alten und Schwachen keine individuellen Gestaltungsräume, so dass „diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt ausser dem Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen durften.“ So hört der Gestaltungsraum, indem sich Frauen noch im 20. Jahrhundert bewegen dürfen, vor der Schwelle zum als vom Patriarchat öffentlich proklamierten Raum auf. Demnach ist gerade der politische Bereich – in bürgerlichen wie in linken Organisationen und Strukturen – überwiegend wenn nicht in Teilen sogar ausschliesslich Angelegenheit des phallischen Geschlechts. Hier vor allem setzt die Kritik einer sich akzentuierenden feministischen Literatur an, wobei sie den den Frauen zugedachte Ort innerhalb der „männlich dominierten“ Gesellschaft als Begrenzung des „weiblichen Lebenszusammenhanges“ beschreibt. Sowohl der Ausschluss von Frauen aus dem Politischen wie auch die Tabuisierung privater Verhältnisse führten zu einer subversiven Politisierungs- und Veränderungspraxis, welche insbesondere Stefans publizistisches Schaffen prägte. Im Unterschied etwa zu Strucks „Klassenliebe“ kann „Häutungen“ als Bewegungstext verstanden werden, denn die Autorin kommt aus der aktiven Szene der Frauenbewegung und vollzieht in gewissem Sinne stellvertretend den allgemein ersehnten Schritt zur Selbstthematisierung und -reflexion. Das Patriarchat steht bei Stefan sinnbildlich für eine Herrschaftsform der Superiorität, dessen Legitimation sich aber in der Sprache Stefans im „genitalen ernst“ eines sich rasch vollziehenden Koitus erschöpft. Aufgrund der Sensibilisierung für ein patriarchal „macht-asymmetrisches Sex-Gender-System“ sollen folgende Fragen diskutiert werden: Auf welche Weise wird das vorherrschende Sex-Gender-System kritisiert? Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen und welche Deutungsansätze bieten postkoloniale Theorien? Welche subversiven Praktiken bieten sich für Stefan im „radikalen Subjektivismus“ an, um das zeitgenössische vergeschlechtlichte und heteronormative Sexualitätsverständnis zu kritisieren und zu hinterfragen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- „Beim schreiben bin ich auf die sprache gestossen"
- „Mich springen die blicke der männer an"
- „Eine all tägliche behandlung einer kolonisierten"
- „Nieder mit dem Koitus!"
- Schlussteil
- Quellen
- Gedruckte Quellen
- Darstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert Verena Stefans Werk „Häutungen" im Hinblick auf dessen Kritik am vorherrschenden heteronormativen Sexualitätsverständnis. Die Arbeit untersucht die spezifischen Sprach- und Schreibweisen, die Stefan verwendet, um die patriarchale Ordnung und ihre Auswirkungen auf die weibliche Erfahrung zu dekonstruieren.
- Sprachkritik und die Konstruktion einer weiblichen Sprache
- Die Darstellung des weiblichen Körpers und die Verobjektivierung durch den männlichen Blick
- Die Verbindung zwischen Sexismus, Rassismus und Kolonialismus
- Die Kritik am Koitus als Ausdruck patriarchaler Machtverhältnisse
- Die Suche nach einer neuen, selbstbestimmten weiblichen Sexualität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Essays ein und stellt Verena Stefans Werk „Häutungen" als einen wichtigen Text der feministischen Literatur vor. Die Arbeit argumentiert, dass Stefans Werk die problematischen Machtverhältnisse des Patriarchats in der Sprache, im Körper und in der Sexualität offenlegt.
Der erste Teil des Hauptteils analysiert Stefans Sprachkritik und ihren Versuch, eine neue, weibliche Sprache zu schaffen. Die Arbeit zeigt auf, wie Stefan die alltägliche Sprache dekonstruiert und neue Wörter und Schreibweisen verwendet, um die weibliche Erfahrung differenzierter auszudrücken.
Der zweite Teil befasst sich mit der Darstellung des weiblichen Körpers in „Häutungen" und der Verobjektivierung durch den männlichen Blick. Die Arbeit untersucht, wie Stefan die kulturellen Zwänge und Disziplinierungen, die den weiblichen Körper prägen, kritisch beleuchtet.
Der dritte Teil des Hauptteils untersucht die Verbindung zwischen Sexismus, Rassismus und Kolonialismus in Stefans Werk. Die Arbeit argumentiert, dass Stefan die Unterdrückung der Frau mit der Unterdrückung von Schwarzen und Kolonisierten in Beziehung setzt und so die universelle Natur patriarchaler Machtverhältnisse aufzeigt.
Der vierte und letzte Teil des Hauptteils analysiert Stefans Kritik am Koitus als Ausdruck patriarchaler Machtverhältnisse. Die Arbeit zeigt auf, wie Stefan den Koitus als einen Akt der Unterwerfung und Verkörperung männlicher Dominanz darstellt und eine alternative, selbstbestimmte weibliche Sexualität propagiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die feministische Literatur, die Kritik am Patriarchat, die Sprache als Ausdruck von Machtverhältnissen, die Darstellung des weiblichen Körpers, die Verobjektivierung, der Koitus als Ausdruck männlicher Dominanz, die Suche nach einer neuen weiblichen Sexualität und die Verbindung zwischen Sexismus, Rassismus und Kolonialismus.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Verena Stefans Werk "Häutungen"?
Es ist ein zentraler Text der Frauenbewegung, der das patriarchale Sex-Gender-System und die heteronormative Sexualität radikal kritisiert.
Warum ist die Sprachkritik in "Häutungen" so wichtig?
Stefan argumentiert, dass die bestehende Sprache männlich dominiert ist und Frauen eine eigene Ausdrucksweise finden müssen, um ihre Erfahrungen zu beschreiben.
Wie wird der Koitus im Buch dargestellt?
Er wird als Akt patriarchaler Macht und männlicher Dominanz kritisiert, was in der Forderung "Nieder mit dem Koitus!" gipfelt.
Welche Verbindung zieht Stefan zwischen Sexismus und Kolonialismus?
Sie beschreibt die alltägliche Behandlung der Frau als die einer "Kolonisierten" innerhalb der männlichen Gesellschaft.
Was bedeutet "radikaler Subjektivismus" bei Stefan?
Es ist die Praxis, das eigene Erleben und den eigenen Körper zum Ausgangspunkt politischer Veränderung und Selbstbefreiung zu machen.
- Quote paper
- Master of Arts UZH Roman Weber (Author), 2011, Verena Stefans "Häutungen". Eine Analyse hinsichtlich Ihrer Kritik am vorherrschenden heteronormativen Sexualitätsverständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273570