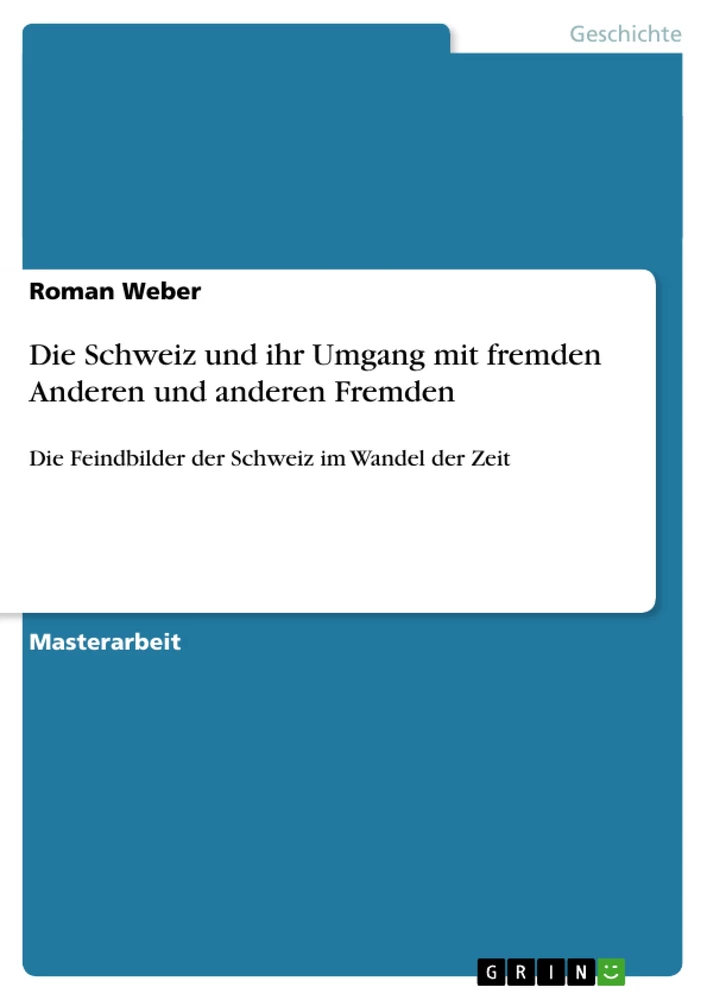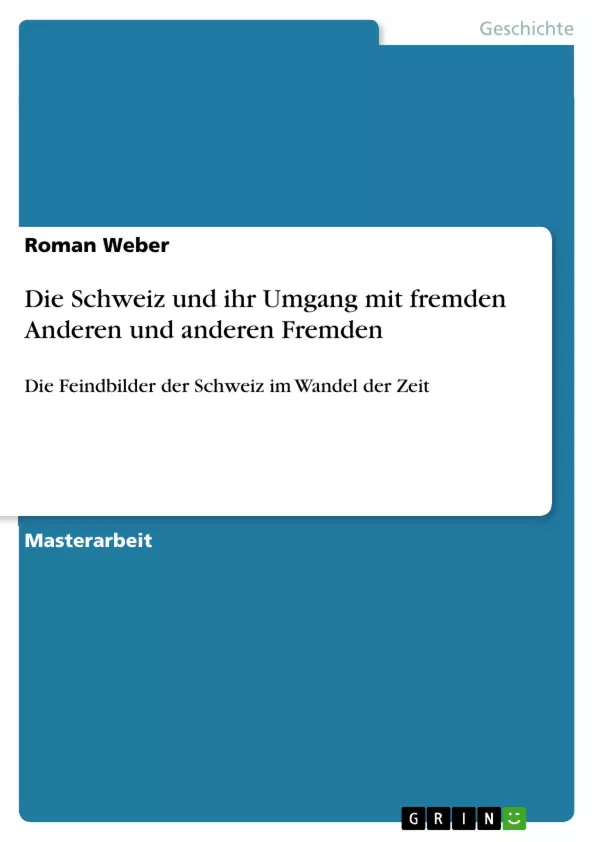Über eine Schweizer Fahne als Teppich schreiten schwarz gekleidete Männer. Das Schweizerkreuz, als weisses Kreuz auf rotem Grund eingezeichnet, verschwindet unter den Sohlen der schwarzen Stiefel. Der rote Teppich zeichnet sich vor einem weissen Hintergrund ab und markiert gleichzeitig eine Grenze. Das Bild zeigt sieben Beinpaare. Sieben Männer schreiten voran, auf den Teppich zu. Eine Momentaufnahme: Man sieht nur die abgeschnittenen unteren Teile der Beine. Die Stiefel des ersten Mannes sind prominent im Vordergrund, weil er den Teppich schon betreten hat. Die Gruppe hinter ihm folgt ihm nach und macht es ihm gleich. Die Männer werfen ihre Schatten voraus. Aufgrund des Schattenwurfs muss es Morgen oder Abend sein. Eher Abenddämmerung, denn das Bild wird von einem Slogan mit Ausrufezeichen begleitet, der gelb markiert ist und wie ein Stempel auf dem Bild angebracht worden ist. «Jetzt ist genug!» heisst es da. Als ob es schon fast zu spät wäre. Um die Botschaft des Bildes noch zu unterstreichen und Klarheit darüber zu schaffen, für welche Zwecke geworben wird, steht in weisser Schrift auf rotem Grund, den Farben der Schweizer Fahne nachempfunden: «Masseneinwanderung stoppen.» Die Slogans scheinen dabei austauschbar, während das Bild in den Inseraten dasselbe bleibt. Die hier erwähnten Sätze, die allesamt mit einem Ausrufezeichen versehen sind und die Aussage deshalb verstärken, sollen die Brisanz eines Themas aufzeigen, das ich in meiner Arbeit behandle. Im Folgenden wird aufgrund dessen versucht, die hier zum Vorschein kommende Problematisierung des Fremden und von Fremdheit schlechthin in der Geschichte der Schweiz seit der Schächtverbotsinitiative von 1893 bis zur Minarettverbotsinitiative von 2009 zu analysieren. Dabei soll gefragt werden, ob und wenn ja welche Geschichte gerade auch die eben erwähnten Schlagworte haben. Ist in der Darstellung des Fremden eine gewisse Systematik erkennbar? Welchen Kontinuitäten folgt die Fremdenproblematisierung? Oder sind stattdessen auch gewisse Brüche in der Geschichte feststellbar? Welche Auswirkungen haben solche Bilder und Diskurse auf die politischen Akteure und plebiszitären Prozesse?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Ansatz: Widersprüchlichkeit der Fremddarstellung
- Das konstruierte Andere
- Der Fremde und das Eigene
- Kulturelle Identität
- Das orientalisierte Andere
- Rassismus ohne Rassen
- Arbeitsmethode: Historische Diskursanalyse
- Forschungsstand
- Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Ansatz: Widersprüchlichkeit der Fremddarstellung
- Hauptteil
- Vom Antijudaismus ohne Juden zum wirkmächtigen Überfremdungskonzept
- Judenfeindliche Traditionen in der Schweiz
- Christentum als Äquivalent nationaler Einheit
- Ostjüdische Migration und Antisemitismus
- Der Überfremdungsbegriff — eine Deutschschweizer Erfindung
- Jahre der Enge und die Geistige Landesverteidigung
- Geistige Landesverteidigung als mystisch aufgeladene Abwehrhaltung
- Die antisemitische Judenfrage als antisemitische Überfremdungsfrage
- Das Boot ist voll
- Wachstum und Arbeitskräftemangel nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Überfremdungsinitiativen der 60er und 70er Jahre
- I. Überfremdungsinitiative
- II. Überfremdungsinitiative
- III. Überfremdungsinitiative
- IV. und V. Überfremdungsinitiative
- Der Überfremdungsdiskurs als Konstante — Zwischenfazit
- Etablierung rechter Positionen in der gesellschaftlichen Mitte
- Politisierung des Asylthemas
- Gesamtgesellschaftliche Akzeptanz rechter Argumentationsmuster
- Der Aufstieg der SVP
- Die Politik der SVP — diskursive Felder und inhaltliche Schwerpunkte
- Veränderungen in der Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung
- Zuzug nicht-christlich geprägter Migrantinnen und Migranten
- Strukturwandel der Immigration
- Islamdiaspora in der Schweiz
- Islamisierung öffentlicher Debatten
- Die Minarettverbotsinitiative — islamkritische und feministische Stimmen
- Christliches Erbe — Wiederkehr einer verschüttet geglaubten Vokabel
- Christliches Erbe auf Schweizer Boden
- Kolonisierungsfantasien
- Unterdrückte Muslima und feministischer Emanzipationsauftrag
- Vom Antijudaismus ohne Juden zum wirkmächtigen Überfremdungskonzept
- Schlussteil
- Schlussbetrachtungen und Ausblick
- Bibliographie
- Gedruckte Quellen
- Zeitungen
- Geschäfte des Nationalrates (chronologisch)
- Botschaften und Berichte des Bundesrates (chronologisch)
- Internetquellen
- Darstellungen
- Internetseiten
- Gedruckte Quellen
- curriculum vitae
Häufig gestellte Fragen
Was thematisiert die Arbeit bezüglich Fremdheit in der Schweiz?
Die Arbeit analysiert die Problematisierung des Fremden in der Schweizer Geschichte von der Schächtverbotsinitiative (1893) bis zur Minarettverbotsinitiative (2009).
Woher stammt der Begriff der „Überfremdung“?
Der Text beschreibt den Überfremdungsbegriff als eine Deutschschweizer Erfindung, die besonders in den 1960er und 70er Jahren durch verschiedene Volksinitiativen geprägt wurde.
Welche Rolle spielt die SVP in diesem Diskurs?
Die SVP (Schweizerische Volkspartei) hat durch die Politisierung des Asylthemas und gezielte Kampagnen rechte Positionen in der gesellschaftlichen Mitte etabliert.
Was wird unter „Geistiger Landesverteidigung“ verstanden?
Dies war eine mystisch aufgeladene Abwehrhaltung während der Kriegsjahre, die nationale Einheit beschwören sollte und oft mit antisemitischen Überfremdungsfragen verknüpft war.
Wie veränderte sich die Debatte durch die Minarettverbotsinitiative?
Die Debatte verlagerte sich hin zu einer Islamisierung öffentlicher Diskurse, in denen christliches Erbe und die Kritik an der Unterdrückung von Frauen als Argumente genutzt wurden.
- Citation du texte
- Master of Arts UZH Roman Weber (Auteur), 2014, Die Schweiz und ihr Umgang mit fremden Anderen und anderen Fremden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273629