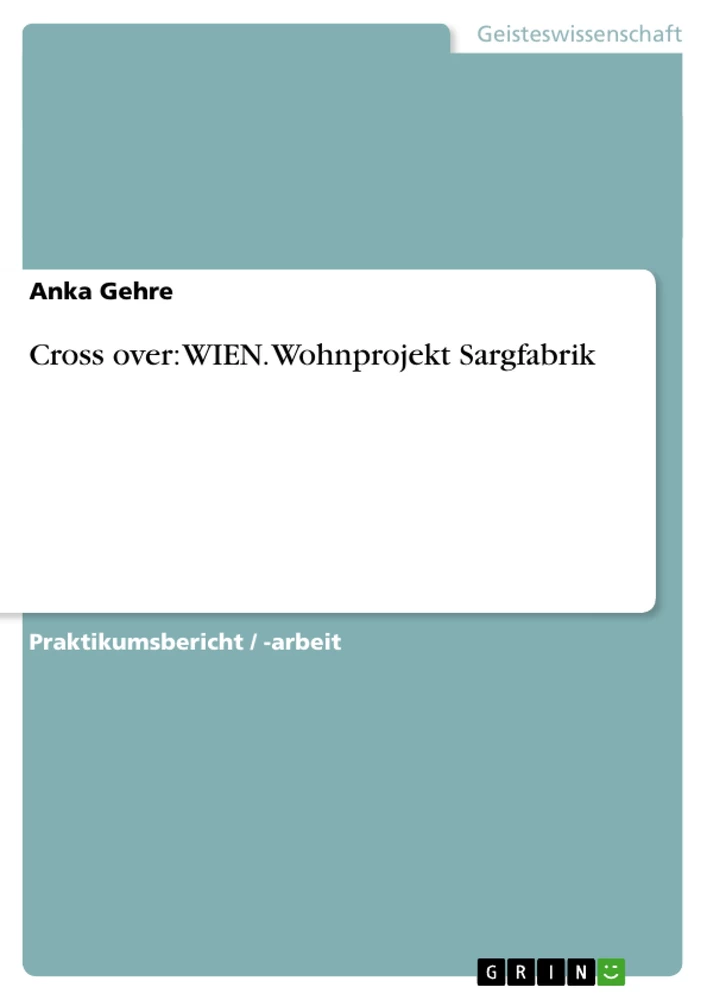Im Rahmen des im WS 1999/2000 stattfindenden interdisziplinär durchgeführten
Seminars Cross over: WIEN, an welchem neben Studenten der Stadt- und
Regionalsoziologie auch Studenten der Fächer Deutsch als Fremdsprache und
Angewandte Sprachwissenschaft teilnahmen, unternahmen wir vom 16. bis 21.
November 1999 eine Exkursion nach Wien.
Ziel der Stadt- und Regionalsoziologiestudenten war es, einige Projekte zum
Thema Wohnen in Wien kennenzulernen und durch Gespräche mit den jeweiligen
Verantwortlichen einiges über die Hintergründe der Wohnprojekte zu erfahren.
Nach einer Besichtigung des Karl - Marx - Hofes, welcher als historisches Beispiel
für eine gelungene Architektur von Arbeiterwohnungen im beginnenden
Industriezeitalter gelten kann, wurden gegenwärtig im Bau befindliche, wie z.B. das
Projekt Autofreies Wohnen oder die Wiener Gasometer, als auch bereits laufende
Projekte, wie die Wiener Sargfabrik begangen.
Auffallend bei allen Projekten war die Absicht, Wohnen neu zu deuten, Alternativen
zu den herkömmlichen Wohnformen zu bieten, was jedoch unter den
verschiedensten Blickwinkeln geschah. So lag die Absicht des Projektes "Autofreies
Wohnen" eindeutig darin, in ökologischer Hinsicht neue Perspektiven zu eröffnen,
während man in den Wiener Gasometern mehr Gewicht auf eine fast futuristisch
anmutende Gestaltung legte. Unsere Aufgabe jedoch war es, das Wohnprojekt
"Sargfabrik" näher ins Auge zu nehmen, was wohl zu den erfolgreichsten seiner Art
in Wien zählen dürfte, nicht nur wegen des ausgefallenen Namens, der leichter zu
erklären ist, als man denken mag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines, Geschichte des Vereins für integrative Lebensgestaltung
- Architektur
- "Miss Sargfabrik"
- Finanzierung, Lastenaufteilung
- Konflikte, Mitbestimmung im Verein
- Umsetzung der Theorie in die Praxis?
- Geplante Gemeinschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Exkursionsbericht beschreibt das Wohnprojekt Sargfabrik in Wien und untersucht dessen Entstehung, Architektur, Finanzierung, soziale Strukturen und Herausforderungen. Der Bericht analysiert die Umsetzung gemeinschaftlicher Lebensentwürfe und die Integration verschiedener Lebensformen in einem urbanen Kontext.
- Geschichte und Entstehung des Vereins für integrative Lebensgestaltung
- Architektur und Gestaltung des Wohnprojekts
- Finanzierung und Lastenaufteilung unter den Bewohnern
- Konflikte und Mitbestimmungsprozesse innerhalb der Gemeinschaft
- Vergleich der Theorie gemeinschaftlichen Wohnens mit der Praxis im Projekt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Bericht dokumentiert eine Exkursion nach Wien im Rahmen eines interdisziplinären Seminars, bei der verschiedene Wohnprojekte, darunter die Sargfabrik, besucht wurden. Das Seminar zielte darauf ab, verschiedene Ansätze zu alternativen Wohnformen kennenzulernen und deren Hintergründe zu erforschen. Die Sargfabrik wird als besonders erfolgreiches Beispiel hervorgehoben, welches im Bericht näher untersucht wird.
Allgemeines, Geschichte des Vereins für integrative Lebensgestaltung: Das Wohnprojekt Sargfabrik, offiziell Matznergasse, entstand auf dem Gelände einer ehemaligen Sargfabrik. Gegründet wurde es 1989 von einer Gruppe Wiener Bürger mit unterschiedlichen Hintergründen, die unzufrieden mit traditionellen Wohnformen waren. Der Verein, zunächst "Verein utopisches Zentrum" genannt, suchte nach gemeinschaftlichen Lebensentwürfen und integrierte verschiedene Lebensformen und Kulturen. Der Erwerb des Geländes und der anschließende Bauprozess waren mit erheblichen Herausforderungen, einschließlich rechtlicher Schwierigkeiten und dem Abriss der alten Gebäude, verbunden. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es dem Verein, das Projekt erfolgreich umzusetzen.
Architektur: Der Neubau der Sargfabrik, geplant vom "Baukünstlerkollektiv" BKK 2, orientierte sich an den Abmessungen der alten Fabrikhallen. Die ungewöhnliche Raumhöhe von 4,80 m wurde durch eine stiegenartige Konstruktion teilweise halbiert, was zu unterschiedlichen Höhen in den Wohnräumen führte. Große Fensterflächen kennzeichnen das Gebäude und spiegeln die Offenheit des Projekts wider. Neben den Wohneinheiten bietet die Sargfabrik einen Kindergarten, ein Schwimmbad, Seminarräume und einen Veranstaltungssaal – Einrichtungen, die auch von Außenstehenden genutzt werden können. Diese „Luxuseinrichtungen“ unterstreichen die integrative und gemeinschaftliche Ausrichtung des Projekts.
Schlüsselwörter
Wohnprojekt Sargfabrik, Wien, integrative Lebensgestaltung, gemeinschaftliches Wohnen, alternative Wohnformen, Architektur, Finanzierung, Konflikte, Mitbestimmung, Urbanes Leben.
Häufig gestellte Fragen zum Exkursionsbericht: Wohnprojekt Sargfabrik Wien
Was ist der Gegenstand dieses Exkursionsberichts?
Der Bericht dokumentiert eine Exkursion zum Wiener Wohnprojekt Sargfabrik im Rahmen eines interdisziplinären Seminars zu alternativen Wohnformen. Er analysiert die Entstehung, Architektur, Finanzierung, soziale Strukturen und Herausforderungen dieses Projekts und untersucht die Umsetzung gemeinschaftlicher Lebensentwürfe in einem urbanen Kontext.
Welche Themen werden im Bericht behandelt?
Der Bericht behandelt die Geschichte und Entstehung des Vereins für integrative Lebensgestaltung, die Architektur und Gestaltung des Wohnprojekts, die Finanzierung und Lastenaufteilung unter den Bewohnern, Konflikte und Mitbestimmungsprozesse innerhalb der Gemeinschaft sowie einen Vergleich der Theorie gemeinschaftlichen Wohnens mit der Praxis im Projekt Sargfabrik.
Wie ist die Sargfabrik entstanden?
Das Wohnprojekt Sargfabrik (offiziell Matznergasse) entstand 1989 auf dem Gelände einer ehemaligen Sargfabrik. Eine Gruppe Wiener Bürger, unzufrieden mit traditionellen Wohnformen, gründete den Verein (zunächst "Verein utopisches Zentrum"), um gemeinschaftliche Lebensentwürfe zu verwirklichen und verschiedene Lebensformen und Kulturen zu integrieren. Der Erwerb des Geländes und der Bauprozess waren mit erheblichen Herausforderungen verbunden, darunter rechtliche Schwierigkeiten und der Abriss alter Gebäude.
Wie ist die Architektur der Sargfabrik gestaltet?
Der Neubau, geplant vom "Baukünstlerkollektiv" BKK 2, orientiert sich an den Abmessungen der alten Fabrikhallen. Die ungewöhnliche Raumhöhe von 4,80 m wurde teilweise halbiert, was zu unterschiedlichen Höhen in den Wohnräumen führte. Große Fensterflächen kennzeichnen das Gebäude und spiegeln die Offenheit des Projekts wider. Neben Wohneinheiten bietet die Sargfabrik einen Kindergarten, ein Schwimmbad, Seminarräume und einen Veranstaltungssaal – Einrichtungen, die auch von Außenstehenden genutzt werden können.
Wie wird die Sargfabrik finanziert?
Der Bericht geht auf die Finanzierung und Lastenaufteilung unter den Bewohnern ein, beschreibt aber die konkreten Mechanismen nicht im Detail. Es wird lediglich erwähnt, dass die Finanzierung eine der Herausforderungen des Projekts darstellte.
Welche Konflikte und Mitbestimmungsprozesse gab es?
Der Bericht erwähnt Konflikte und Mitbestimmungsprozesse innerhalb der Gemeinschaft der Sargfabrik, beschreibt aber die konkreten Konflikte und deren Lösungen nicht detailliert. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass dies ein wichtiger Aspekt der Analyse ist.
Wie wird die Theorie des gemeinschaftlichen Wohnens in der Praxis umgesetzt?
Der Bericht vergleicht die Theorie gemeinschaftlichen Wohnens mit der Praxis im Projekt Sargfabrik. Die Ergebnisse dieses Vergleichs werden jedoch nicht explizit dargestellt. Es wird lediglich erwähnt, dass dies ein zentrales Thema der Untersuchung ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Projekt?
Schlüsselwörter sind: Wohnprojekt Sargfabrik, Wien, integrative Lebensgestaltung, gemeinschaftliches Wohnen, alternative Wohnformen, Architektur, Finanzierung, Konflikte, Mitbestimmung, Urbanes Leben.
- Quote paper
- Anka Gehre (Author), 2000, Cross over: WIEN. Wohnprojekt Sargfabrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27388