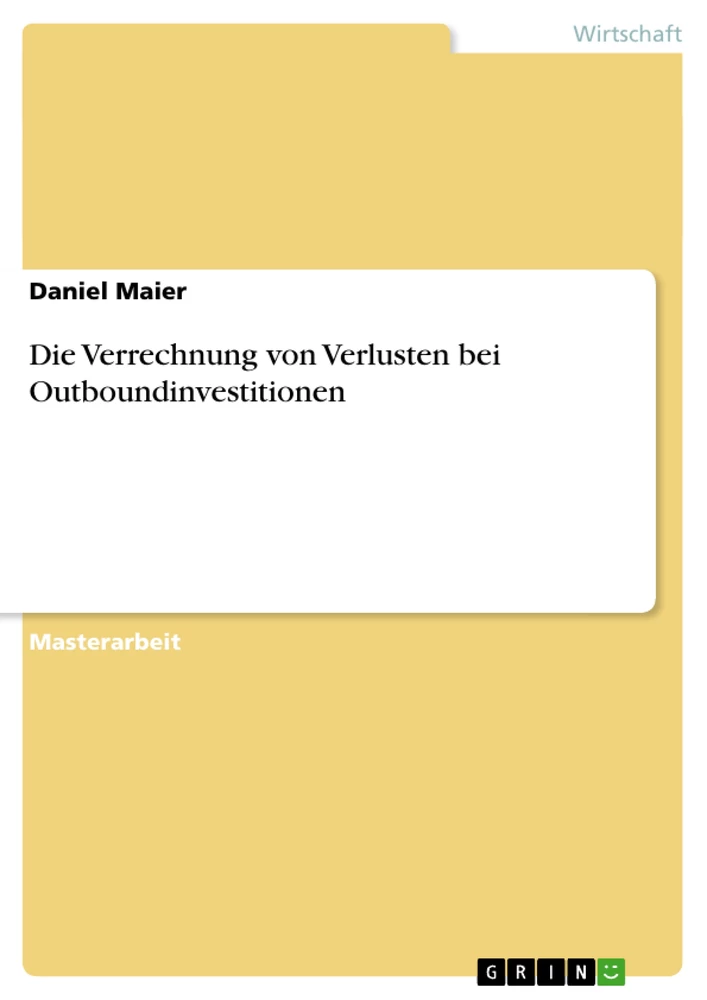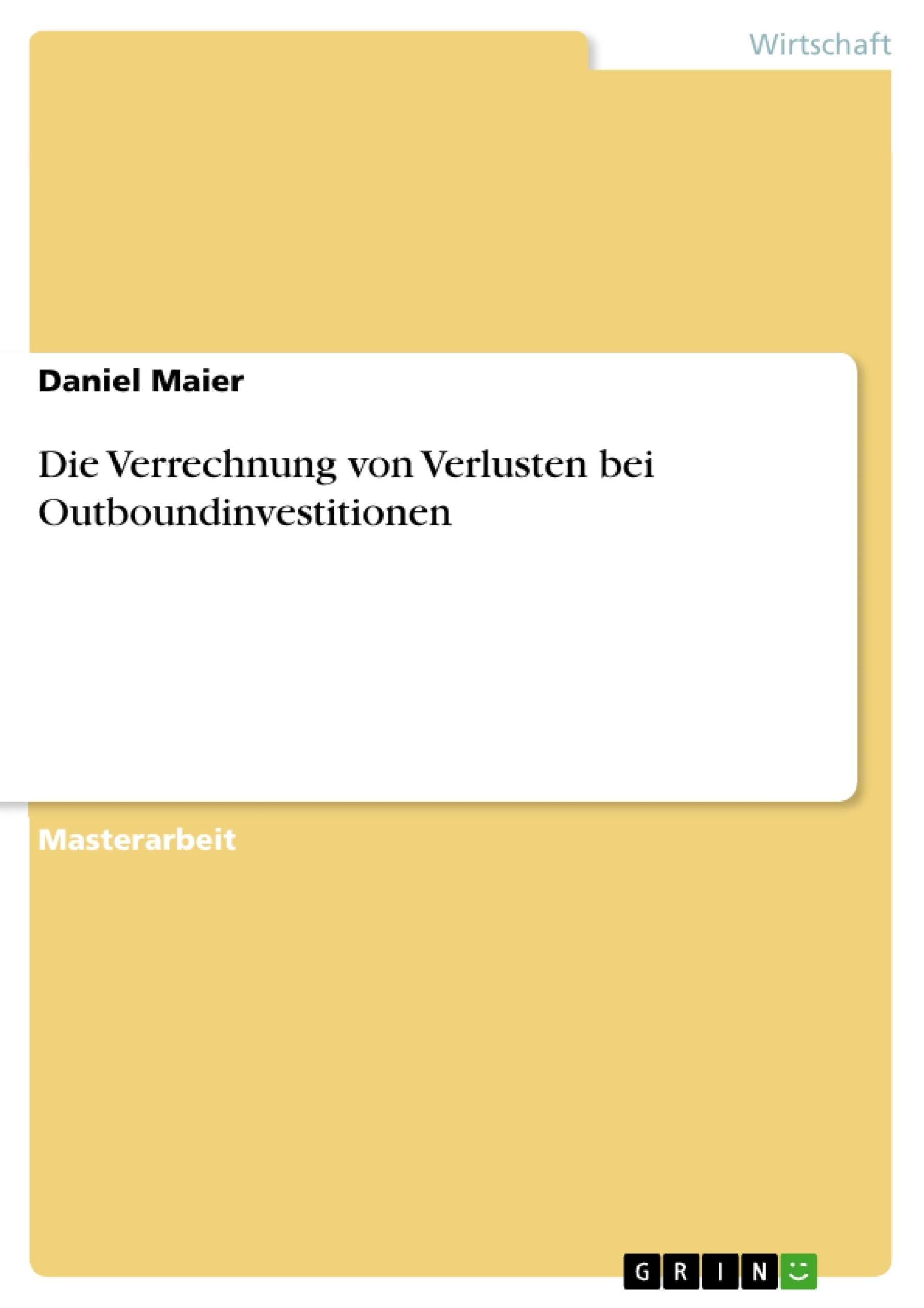Im Zuge der europäischen Integration sind nicht nur die einzelnen Nationen und Volkswirtschaften enger zusammen gewachsen. Auch die Bedeutung des EU/EWR–Raums als Markt für inländische Unternehmen nahm stetig zu, und darum deren dortige Aktivität. Aufgrund dessen werden positive als auch negative Einkünfte inzwischen unter dem Einfluss einer Vielzahl von Jurisdiktionen generiert, wobei der Forschungsgegenstand in dieser Arbeit Letztere sein sollen. Angesichts stetig ansteigender in– und ausländischer Verlustvorträge und der vorherrschenden Finanzmarktkrise, die immer mehr Unternehmen rote Zahlen schreibt lässt, erscheint es für diese grenzübergreifend agierenden Unternehmen von immensen Interesse zu sein, die durch die Outboundaktivitäten erlittenen Verluste im Inland steuerlich nutzen zu können. Andernfalls würde es zu ökonomischen Fehlanreizen kommen, weswegen es in den letzten Jahren hauptsächlich durch den EuGH initiierte Bemühungen innerhalb des Gemeinschaftsgebiets gibt, die grenzüberschreitende Verlustnutzung zumindest teilweise zu ermöglichen. Über die konkrete Reichweite dieser Vorgaben gibt es in der Literatur und Rechtsprechung jedoch höchst unterschiedliche Auffassungen.
Angesichts dieser Unklarheit soll in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Vorgaben konkret durch den EuGH gemacht werden, welche Verluste deswegen berücksichtigt werden müssen, wie diese Berücksichtigung konkret ausgestaltet ist bzw. sein sollte, und welche Folgen sich daraus für die Organschaft ergeben. Dazu wird einleitend in Kapital 2 erörtert, welche Anforderungen an ein Verlustverrechnungssystem aus rechtlicher sowie ökonomischer Sicht zu stellen sind. Sodann werden die entscheidenden Urteile des EuGH in Hinblick auf die grenzüberschreitende Verlustverrechnung – Marks & Spencer (3. Kapitel) und Lidl Belgium (4. Kapitel) – vorgestellt, und die entscheidenden Grundsätze eingehend erörtert. Da sich zeigen wird, dass diese keineswegs zweifelsfrei aufgestellt sind, werden anschließend in Kapitel 5 die verbleibenden Auslegungslücken identifiziert und mögliche Lösungen aufgezeigt. Daraufhin wird in Kapitel 6 eine denkbare Gestaltungsmöglichkeit zur doppelten Verlustnutzung diskutiert, die sich aus diesen Lücken ergibt. Da sich aus den vorausgehenden Kapiteln erahnen lassen wird, dass die gegenwärtigen Organschaftsregelungen gegen das Unionsrecht verstoßen, wird darauf in Kapitel 7 näher eingegangen, und mögliche Lösungen vorgestellt...
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Die Bedeutung der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung in Europa
- Anforderungen an die Verlustverrechnung
- Nationalrechtliche Anforderungen
- Unionsrechtliche Anforderungen
- Ökonomische Anforderungen
- Der Ausgangsfall: Die Rechtssache Marks & Spencer
- Sachverhalt
- Vorlagefragen
- Entscheidung
- Zusammenfassung
- Die Rechtssache Lidl Belgium — Übertragung der Marks & Spencer—Grundsätze auf den Betriebsstättenfall?
- Sachverhalt
- Urteil
- Zusammenfassung
- Offene Fragen aus den Grundsatzentscheidungen Marks & Spencer und Lidl Belgium
- Konkretisierung finaler Verluste
- Abkehr von diesem Konzept durch den EuGH?
- Berücksichtigung finaler Verluste im Rahmen der Gewerbesteuer
- Berücksichtigungszeitpunkt finaler Verluste: phasenverschobene vs. phasengleiche Berücksichtigung
- Fazit — Zweifelsfragen nur unzureichend beantwortet
- Ermöglichen die Grundsatzentscheidungen eine doppelte Verlustnutzung?
- Negativer Progressionsvorbehalt im deutschen Steuerrecht
- Die Rechtssache Ritter—Coulais
- Möglichkeit zur doppelten Verlustnutzung eröffnet?
- Reformnotwendigkeit der bestehenden deutschen Organschaftsregelungen
- Bestehende Verletzungen des Unionsrechts
- Vorschläge zur unionsrechtskonformen Ausgestaltung
- Korrektur der bestehenden Organschaftsregelungen
- Das österreichische Modell
- Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer—Bemessungsgrundlage (GKKB)
- Belastungsvergleich verschiedener Gruppenbesteuerungssyteme
- Modell und —annahmen
- Ergebnisse
- Quo vadis grenzüberschreitende Verlustnutzung?
- Literaturverzeichnis
- Rechtsquellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Verrechnung von Verlusten bei Outboundinvestitionen und analysiert die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Kontext der grenzüberschreitenden Verlustnutzung. Die Arbeit untersucht die rechtlichen und ökonomischen Anforderungen an ein Verlustverrechnungssystem und analysiert die relevanten EuGH-Urteile in den Rechtssachen Marks & Spencer und Lidl Belgium.
- Die Bedeutung der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung in Europa
- Die Anforderungen an ein Verlustverrechnungssystem aus rechtlicher und ökonomischer Sicht
- Die Grundsatzentscheidungen des EuGH in den Rechtssachen Marks & Spencer und Lidl Belgium
- Die offenen Fragen und Auslegungslücken in der EuGH-Rechtsprechung
- Die Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf die deutsche Organschaftsbesteuerung und die Möglichkeit einer doppelten Verlustnutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Bedeutung der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung im Kontext der europäischen Integration. Es werden die rechtlichen Anforderungen an ein Verlustverrechnungssystem aus nationaler und europäischer Sicht erörtert, sowie die ökonomischen Kriterien der Investitionsneutralität.
Das zweite Kapitel analysiert die Grundsatzentscheidung des EuGH in der Rechtssache Marks & Spencer. Es werden die Sachverhaltsmerkmale, die Vorlagefragen, die Urteilsbegründung und die wichtigsten Schlussfolgerungen des EuGH dargestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Rechtssache Lidl Belgium und der Übertragung der Marks & Spencer—Grundsätze auf den Betriebsstättenfall. Es wird untersucht, inwiefern die vom EuGH entwickelten Grundsätze auf die Verlustverrechnung im Betriebsstättenfall anwendbar sind.
Das vierte Kapitel analysiert die offenen Fragen aus den Grundsatzentscheidungen Marks & Spencer und Lidl Belgium. Es werden die verschiedenen Auslegungslücken in der EuGH-Rechtsprechung im Detail untersucht und mögliche Lösungen aufgezeigt.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Frage, ob die Grundsatzentscheidungen des EuGH eine doppelte Verlustnutzung ermöglichen. Es wird analysiert, ob sich durch die Verbindung des negativen Progressionsvorbehalts mit der Berücksichtigung finaler Verluste ein Double-Dip-Effekt generieren lässt.
Das sechste Kapitel behandelt die Reformnotwendigkeit der bestehenden deutschen Organschaftsregelungen. Es werden die bestehenden Verletzungen des Unionsrechts durch die deutschen Organschaftsregelungen aufgezeigt und verschiedene Lösungsansätze diskutiert.
Das siebte Kapitel stellt einen Belastungsvergleich verschiedener Gruppenbesteuerungssysteme dar. Die verschiedenen Modelle werden anhand eines Kapitalwertmodells hinsichtlich ihrer steuerlichen Belastung untersucht.
Das achte Kapitel befasst sich mit der Frage, wie die grenzüberschreitende Verlustnutzung in Zukunft gestaltet werden sollte. Es werden die verschiedenen Lösungsansätze und die Chancen und Risiken der einzelnen Modelle diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die grenzüberschreitende Verlustverrechnung, die Niederlassungsfreiheit, das Territorialitätsprinzip, die Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse, die Finalität von Verlusten, die Anrechnungsmethode mit Nachversteuerung, die Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer—Bemessungsgrundlage (GKKB), die deutsche Organschaft und die Investitionsneutralität.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das EuGH-Urteil „Marks & Spencer“?
Das Urteil besagt, dass eine grenzüberschreitende Verlustverrechnung möglich sein muss, wenn Verluste im Ausland „final“ sind, also dort nicht mehr genutzt werden können.
Wann gelten Verluste als „final“?
Verluste sind final, wenn die ausländische Tochtergesellschaft liquidiert wurde oder keine rechtliche Möglichkeit mehr besteht, die Verluste im Sitzstaat geltend zu machen.
Was ist die Bedeutung des Falls „Lidl Belgium“?
In diesem Fall übertrug der EuGH die Marks-&-Spencer-Grundsätze auf ausländische Betriebsstätten und präzisierte die Bedingungen für den Verlustabzug.
Was versteht man unter einer „doppelten Verlustnutzung“?
Es beschreibt Szenarien (Double-Dip), in denen derselbe Verlust steuerlich sowohl im Ausland als auch im Inland geltend gemacht wird, was durch das Unionsrecht meist verhindert werden soll.
Was ist die GKKB?
Die Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage ist ein Vorschlag der EU-Kommission zur Vereinheitlichung der Steuerbasis und Vereinfachung der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung.
- Citar trabajo
- Daniel Maier (Autor), 2013, Die Verrechnung von Verlusten bei Outboundinvestitionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273931