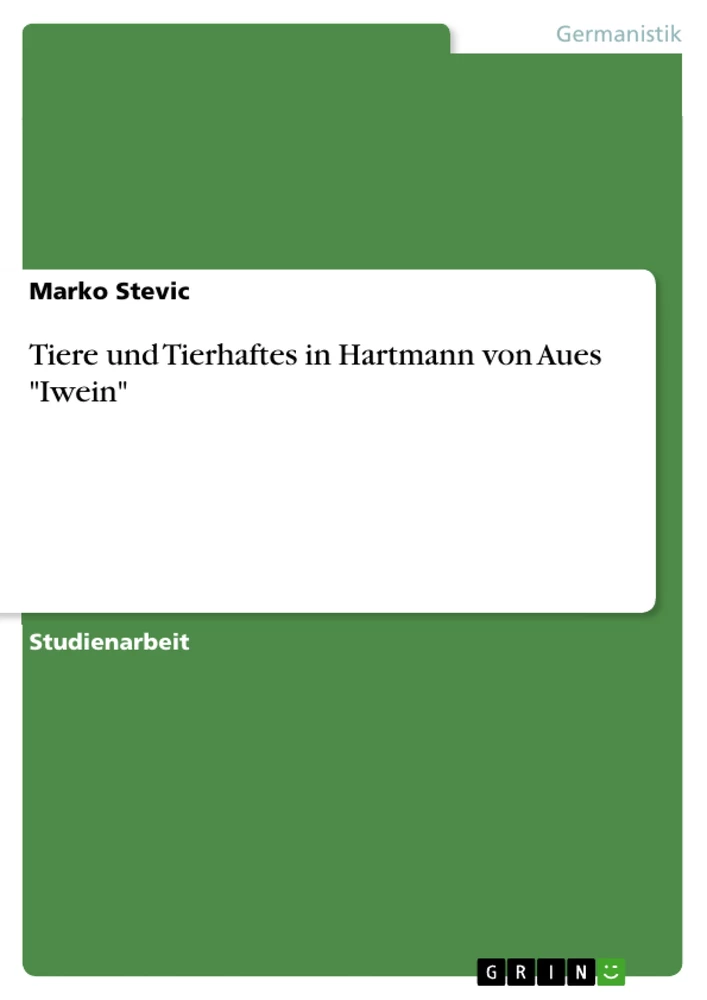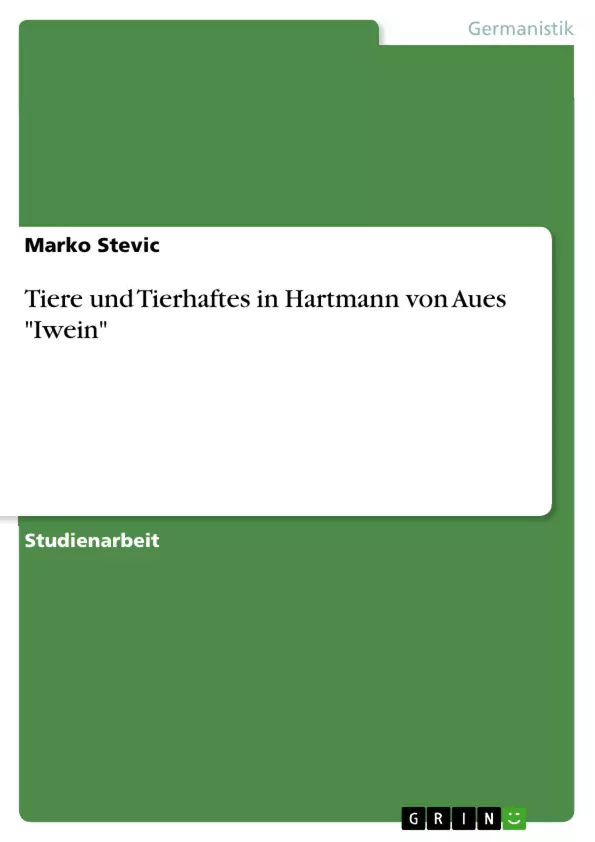Als die literarischen Strömungen im 18. und 19. Jahrhundert nach der Aufklärung wieder dem Gedankengut des Mittelalters und der „Volkskultur“ mehr Wertschätzung zu verleihen beabsichtigt hatten, wurden auch gewisse Vorstellungen über Tiere in die Literatur mit hinein projiziert. In Goethes Werken finden sich viele Tiermetaphern, man denke nur an die berühmteste, als der Pudel im Faust seine Gestalt ändert, und sich Mephistopheles offenbart: „Das ist des Pudels Kern.“ Andere Beispiele für Tiermetaphorik wären die berühmten Schlangen in E.T.A. Hoffmanns „Der goldne Topf“. Diese von den Ursprüngen der Menschheit bis in die Gegenwart reichende Verwendung von Tiermetaphorik hat diverse Motive und Funktionen, doch eines haben allesamt gemeinsam: Man kann dem Signifikat „Tier“ verschiedene signifikante Inhalte zuordnen, die zueinander auch widersprüchlich sein können, aber dennoch assoziativ sind.
Dass auch in Hartmanns von Aue Iwein der metaphorische (und metonymische) Gebrauch der Tiere bestimmte Funktionen hat, soll die vorliegende Arbeit darstellen. Hierbei ist anzumerken, dass die Beziehungen zwischen Mensch und Tier verknüpft sind zum Verhältnis zwischen Mensch und Gott, was eines der zentralen Themen Hartmanns von Aue ausmacht. In diesem Aufsatz werden alle vorkommenden Figuren und Erscheinungen, die sich, mittelbar oder unmittelbar, in ein paradigmatisches Bedeutungsfeld des „Tierischen“ einordnen lassen, genauestens geprüft, beschrieben und gedeutet. Die Zielsetzung ist es, folgende Fragen zu beantworten:
Wie lässt sich das Tierhafte bzw. wie lassen sich Tiere im Iwein darstellen?
Welche Funktionen haben die Tiere in der Erzählung und für was stehen diese?
Welche Funktion hat der jeweilige Erzählteil, in welchem etwas Tierartiges vorkommt, im Kontext und im Verhältnis zu anderen Elementen und zum Gesamtwerk?
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich folgendermassen: Als erstes liefere ich im zweiten Teil nach der Einführung einige Angaben zum Autor des Iwein, zum Werk selber sowie der Quellenlage.
Im darauf folgenden, dritten Teil soll eine genaue Textanalyse der Szenen erfolgen, in denen Tiere im Verlauf der Erzählung auftauchen und dem Hauptprotagonisten entweder hilfreich oder hinderlich entgegentreten...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verfasser und Werk
- Hartmann von Aue
- Quelle und Überlieferung
- Tiersymbolik — Textanalysen und Interpretationen
- Der Wilde Mann
- Die Quelle
- Der Löwe und der Drache
- Der Ritter mit dem Löwen
- Erzählstrukturen, Motive, Deutungsversuche
- Heilsgeschichtliche Struktur
- Der doppelte Cursus
- Geistliche Naturdeutungen
- Bezüge zur Bibel
- Tiefenpsychologische Interpretationen
- Historisch-soziologische Interpretationen
- Keltische Motive
- Motive der Freundschaft
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Verwendung von Tieren und tierhaften Elementen im Artusroman "Iwein" von Hartmann von Aue. Ziel ist es, die Funktionen und Bedeutungen der Tiere in der Erzählung zu analysieren und zu interpretieren, sowie die Rolle der Tiersymbolik im Kontext der Handlung und des Gesamtwerks zu beleuchten.
- Die Darstellung von Tieren und Tierhaftem in "Iwein"
- Die Funktionen der Tiere in der Erzählung und ihre symbolische Bedeutung
- Die Rolle der „tierreichen" und „tierartigen" Szenen im Kontext des Gesamtwerks
- Die Beziehung zwischen Mensch und Tier im Verhältnis zu Mensch und Gott
- Die Verknüpfung von Tiersymbolik mit christlichen und heidnischen Motiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Tiersymbolik in der Geschichte der Menschheit beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden Informationen über den Autor Hartmann von Aue und das Werk "Iwein" gegeben, sowie die Quellenlage erläutert. Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Szenen, in denen Tiere im Verlauf der Erzählung auftauchen und eine wichtige Rolle spielen. So wird die Begegnung mit dem Wilden Mann, das Betreten der mythischen Quelle, der Kampf zwischen dem Drachen und dem Löwen, und alle Abenteuer, die Iwein mit Hilfe des Löwen besteht, genauer betrachtet und interpretiert.
Das vierte Kapitel widmet sich verschiedenen Motiven, Erzählstrukturen und Deutungsmöglichkeiten des Gesamtwerks. Es werden die heilsgeschichtliche Struktur, der doppelte Cursus, geistliche Naturdeutungen, Bezüge zur Bibel, tiefenpsychologische Interpretationen, historisch-soziologische Interpretationen, keltische Motive und Motive der Freundschaft beleuchtet. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und setzt die Tiersymbolik im Kontext der literarischen Funktion des Werks.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Tiersymbolik in Hartmanns "Iwein", die Beziehung zwischen Mensch und Tier, die christliche und heidnische Symbolik, der Artusroman, die Heilsgeschichte, der doppelte Cursus, die geistliche Naturdeutung, die Tiefenpsychologie, die historische und soziologische Interpretation, die keltische Mythologie und die höfische Freundschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Tiere in Hartmann von Aues "Iwein"?
Tiere dienen als Metaphern und Symbole, die Iweins Entwicklung als Ritter begleiten und sein Verhältnis zu Gott und zur höfischen Gesellschaft widerspiegeln.
Was symbolisiert der Löwe in der Erzählung?
Der Löwe steht für Treue, ritterliche Tugend und göttlichen Beistand. Er wird zu Iweins treuestem Begleiter, nachdem dieser ihn vor einem Drachen gerettet hat.
Wer ist der "Wilde Mann" in diesem Kontext?
Der Wilde Mann ist eine tierhafte Figur, die die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis markiert und Iwein den Weg zur mythischen Quelle weist.
Welche Deutungsebenen bietet die Tiersymbolik im Werk?
Die Arbeit nutzt heilsgeschichtliche, tiefenpsychologische, keltische und historisch-soziologische Ansätze, um das "Tierhafte" im Iwein zu interpretieren.
Was ist der "doppelte Cursus" im Artusroman?
Es beschreibt die Struktur des Romans, in dem der Held zweimal ausziehen muss: zuerst, um Ruhm zu gewinnen, und nach einem tiefen Fall erneut, um wahre ritterliche Identität zu finden.
- Citation du texte
- Marko Stevic (Auteur), 2010, Tiere und Tierhaftes in Hartmann von Aues "Iwein", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273934