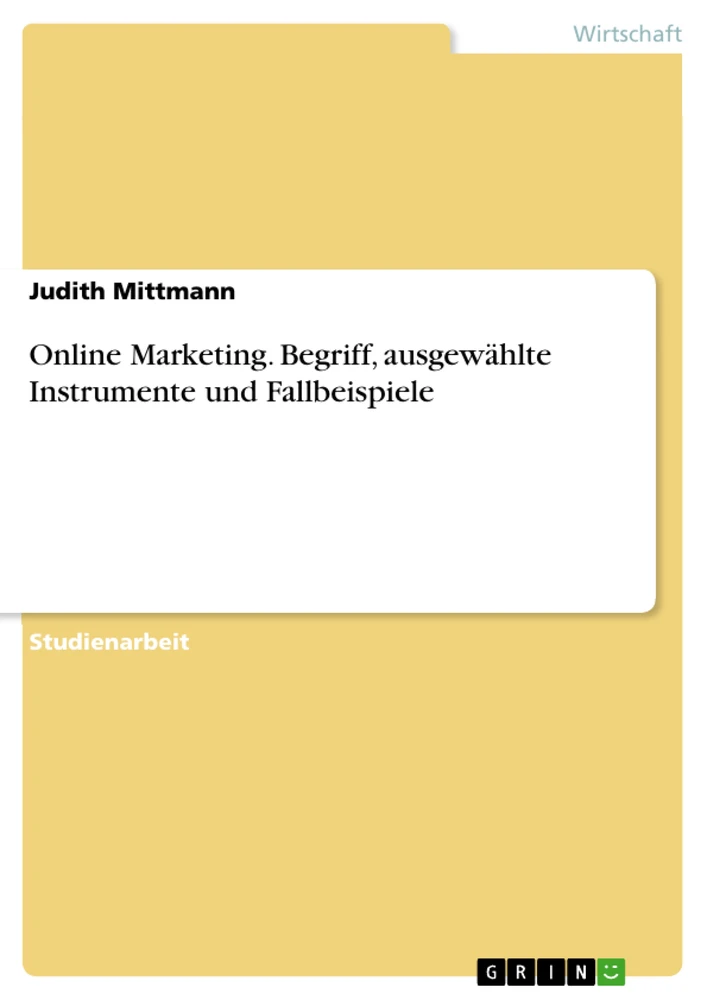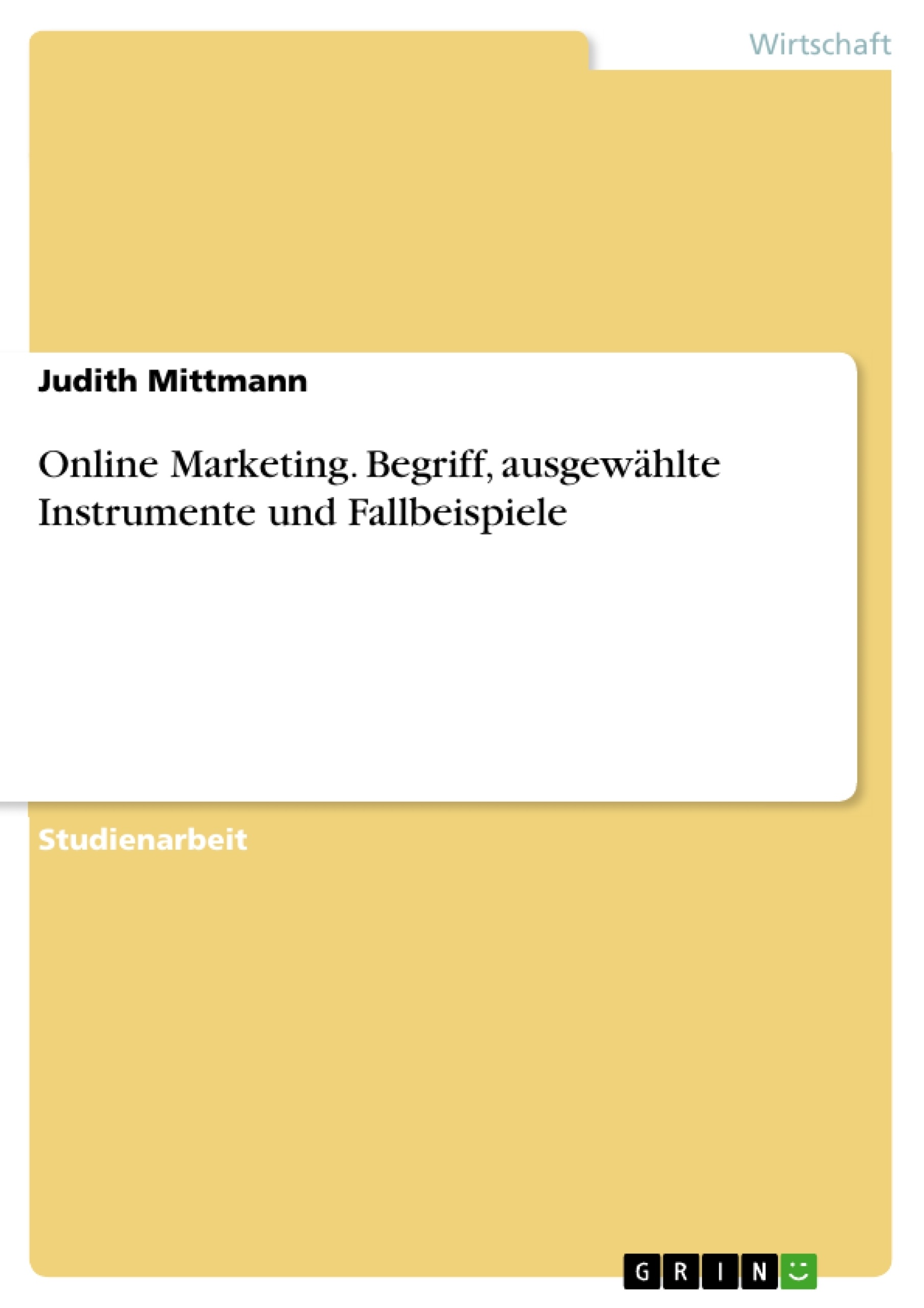Dass Marketing für nahezu alle Unternehmen eine unverzichtbare Denkweise bzw. Führungskonzeption geworden ist, steht spätestens seit der Nachkriegszeit vollkommen außer Frage. Die klassischen Marketinginstrumente sieht man heutzutage in nahezu allen Unternehmen vertreten – ob passiv oder aktiv.
Im 21. Jahrhundert stehen Firmen und Dienstleister allerdings vor einer neuen Herausforderung: dem Online – Marketing. Rasend schnelle technische Fortschritte und Innovationen haben unsere Gesellschaft an das Internet und den Umgang mit eben diesem gebunden und quasi davon abhängig gemacht. E-Mails, Smartphone und Tablet sind aus unserem heutigen Alltag – ob geschäftlich oder privat – nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig wird das Internet als Marktplatz durch seinen dezentralen Verwaltungscharakter immer unübersichtlicher: nahezu jeder kann ohne die Kontrolle eines zentralen Verwaltungsorgans, eine Webseite ins Internet stellen, woraus eine immense Komplexität resultiert. An dieser Stelle müssen Unternehmen ansetzen und ihre Marketingmaßnahmen um eine Vielzahl von Neuerungen ergänzen: Brief- und Radiowerbung reichen heute nicht mehr aus. Ein fundiertes und optimalerweise auch kostengünstiges Online-Marketing muss etabliert werden. Doch wie kam es eigentlich zu dieser Entwicklung? Welche Instrumente bieten sich in diesem Zusammenhang an? Und gibt es Praxisbeispiele?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel dieser Arbeit und Weg der Darstellung
- Begriffliche Grundlagen
- Definition des Online-Marketings und Abgrenzung vom Internetmarketing
- Gründe für die zunehmende Bedeutung des Online-Marketings
- Ziele des Online-Marketings
- Instrumente des Online-Marketings
- Klassische Online-Werbung
- Suchmaschinenmarketing
- Affiliate-Marketing
- E-Mail-Marketing
- Virales Marketing
- Fallbeispiele
- Videoclips von Edeka
- Affilinet
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Grundlagen des Online-Marketings und zeigt deren Relevanz für Unternehmen im 21. Jahrhundert auf. Sie soll dem Leser ein leicht verständliches Verständnis für die Funktionsweise und Anwendung des Online-Marketings vermitteln.
- Definition und Abgrenzung des Online-Marketings vom Internetmarketing
- Bedeutung und Ursachen für die wachsende Relevanz des Online-Marketings
- Ziele und Instrumente des Online-Marketings
- Praxisbeispiele für erfolgreiches Online-Marketing
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Kapitel beleuchtet die wachsende Bedeutung des Online-Marketings in der heutigen Zeit und stellt die zentrale Problematik der steigenden Komplexität des digitalen Marktplatzs dar. Es werden die Ziele und der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
Begriffliche Grundlagen
Dieses Kapitel erläutert die Definition des Online-Marketings und grenzt es vom Internetmarketing ab. Es untersucht die Gründe für die zunehmende Relevanz des Online-Marketings, insbesondere die Verbreitung des Internets als Massenmedium und den Anstieg der Computerverbreitung.
Instrumente des Online-Marketings
Dieses Kapitel stellt verschiedene Online-Marketing-Instrumente vor, wie beispielsweise klassische Online-Werbung, Suchmaschinenmarketing, Affiliate-Marketing, E-Mail-Marketing und virales Marketing. Es vermittelt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, die das Online-Marketing bietet.
Fallbeispiele
Dieses Kapitel präsentiert zwei Unternehmen, die erfolgreich Online-Marketing einsetzen: Edeka mit seinen Videoclips und Affilinet, dessen Geschäftsmodell auf Online-Marketing basiert. Es verdeutlicht die praktische Anwendung des Online-Marketings.
Schlüsselwörter
Online-Marketing, Internetmarketing, digitale Medien, Unternehmenskommunikation, Zielgruppenansprache, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing, virales Marketing, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Online-Marketing und Internetmarketing?
Die Begriffe werden oft synonym verwendet, wobei Online-Marketing alle Marketing-Maßnahmen umfasst, die online durchgeführt werden, um Kunden auf digitalen Kanälen zu erreichen.
Welche Instrumente gehören zum Online-Marketing?
Zu den wichtigsten Instrumenten zählen Suchmaschinenmarketing (SEO/SEA), Affiliate-Marketing, E-Mail-Marketing, virales Marketing und klassische Online-Werbung.
Warum wird Online-Marketing für Unternehmen immer wichtiger?
Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung und der Allgegenwart von Smartphones und Internet ist Online-Marketing notwendig, um in einem zunehmend komplexen digitalen Marktplatz sichtbar zu bleiben.
Was versteht man unter viralem Marketing?
Virales Marketing nutzt soziale Netzwerke und Medien, um eine Werbebotschaft durch Mundpropaganda schnell zu verbreiten, wie beispielsweise die Videoclips von Edeka.
Was ist Affiliate-Marketing?
Es ist ein partnerschaftsbasiertes Vertriebsmodell, bei dem Unternehmen (Advertiser) Provisionen an Partner (Affiliates) zahlen, die deren Produkte oder Dienstleistungen bewerben.
- Quote paper
- Judith Mittmann (Author), 2014, Online Marketing. Begriff, ausgewählte Instrumente und Fallbeispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273981