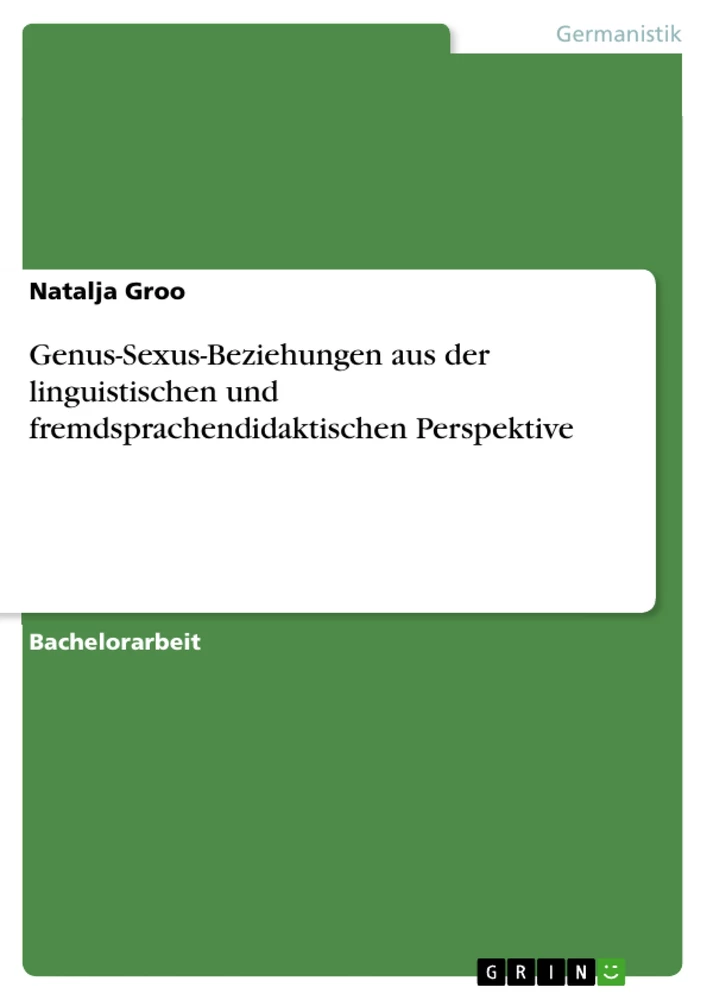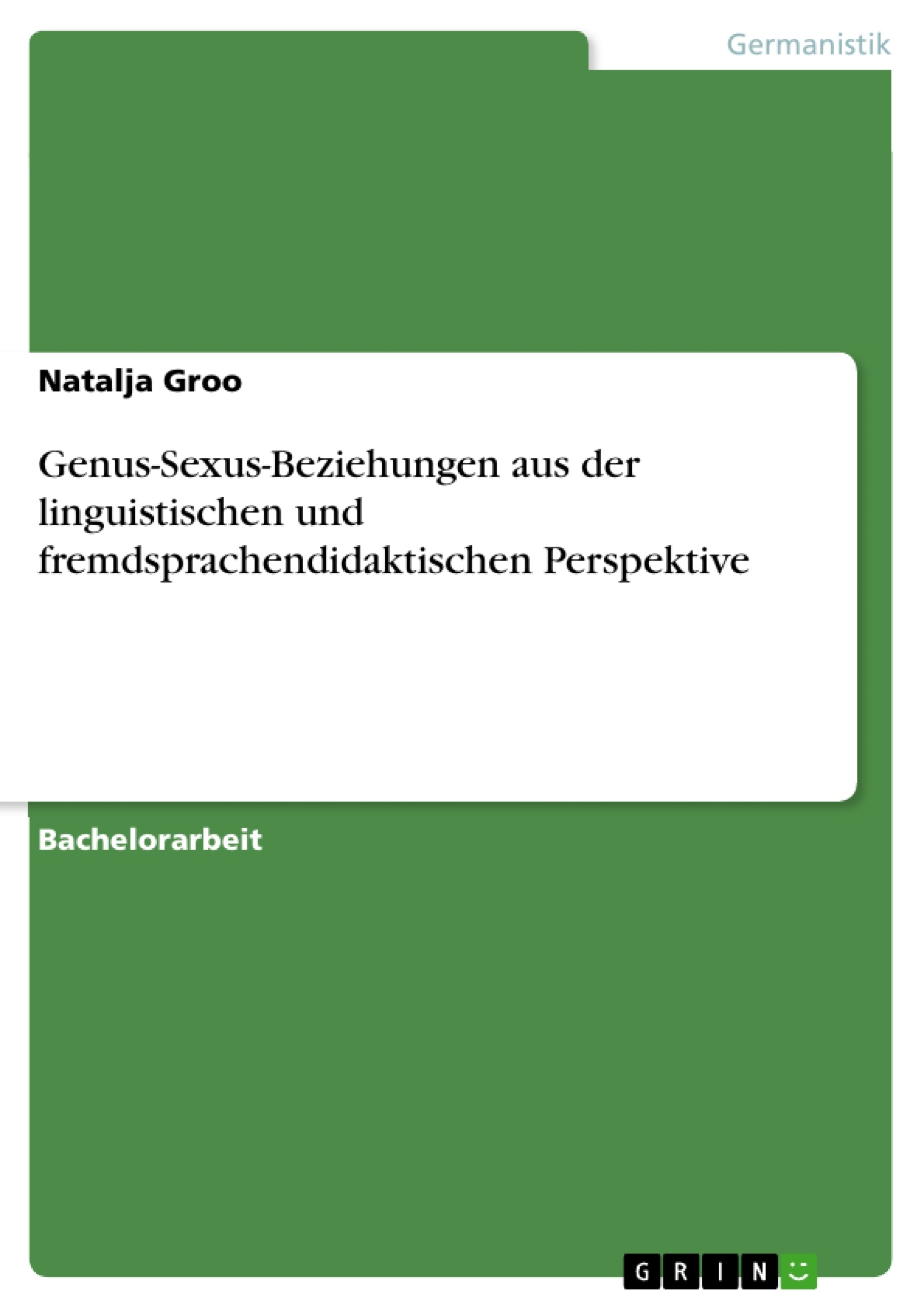Die Genus-Sexus-Beziehungen in der Germanistik sind von derart zeitloser Aktualität, dass es nicht verwundert, immer wieder neue Ansätze zu finden, die dieses Relationsgefüge in unterschiedlicher Akzentuierung darstellen. Die Forschungsdiskussion reicht in synchroner Betrachtung von der Antike bis zur Gegenwart, in diachroner Betrachtung berührt sie fast alle humanitären Wissenschaften: Sprachwissenschaft, Literatur, Philosophie, Psychologie, Soziologie, Ethnologie, Politologie, Rechtswissenschaft usw.
Sehr oft weisen die Beiträge zur Genus-Sexus-Problematik einen provozierenden, widersprüchlichen, manchmal expressiven oder auch revolutionären Charakter auf, aber gerade deswegen sind sie einem Linguisten oder einer Linguistin nie gleichgültig und regen meist durch ihre Kontrastivität zum Mitdenken, oder auch zu eventueller Teilnahme an der Diskussionen an.
Aufgabe dieser Arbeit ist es, das Wesentliche des Forschungsstandes zu den Genus-Sexus-Beziehungen aus den linguistischen und fremdsprachendidaktischen Perspektiven
herauszufinden und zu analysieren. Sehr wichtig ist es dabei, eine einseitige Darstellung der Problematik zu vermeiden und ein möglichst unabhängiges, objektives Forschungsbild zu
schaffen. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit vor allem die kontroversen genustheoretischen Aufsätze bevorzugt.
Als erstes soll die Auseinandersetzung zwischen Grimm/Rothe und Brugmann/Michels beachtet werden (Kap. 2). Zum einen, weil sie in der Forschungsdiskussion als grundlegend gilt, und zum anderen, weil sie auf alle anderen Forschungsrichtungen einen unmittelbaren Einfluss hat. Unabhängig davon, ob nun die Funktionen der grammatischen Kategorie „Genus“ (Kap. 3) oder die Faktoren der Genuszuweisung in der deutschen Grammatik (Kap. 4), der generische Gebrauch des Maskulinums in der feministischen Linguistik (Kap. 5) oder auch der Problemgehalt des Genuserwerbs in den DaF-Didaktiken (Kap. 6) diskutiert werden, steht die von Grimm/Roethe und Brugmann/Michels angesprochene Problematik der Arbitrarität bzw. Motiviertheit der grammatischen Kategorie „Genus“ immer im Mittelpunkt.
Auf bereits erwähnte Themenkreise soll im Forschungsüberblick entsprechend vertiefend eingegangen werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Ziel und Rahmen dieser Arbeit
- 1 Allgemeines
- 2 Historische Erklärungsmodelle für die Entstehung der Genera
- 2.1 Sexus-Unterschied als primäre Ursache der Genusdifferenzierung
- 2.2 Sexus als sekundärer Genusaspekt
- 2.3 Zusammenfassung
- 3 Funktionen des Genus in der deutschen Gegenwartsprache
- 4 Faktoren der Genuszuweisung im Deutschen
- 4.1 Morphologische Faktoren für die Genuszuweisung
- 4.2 Semantische Faktoren für die Genuszuweisung
- 4.3 Lautliche Faktoren für die Genuszuweisung
- 4.4 Genusschwankungen
- 5 Genus-Sexus-Beziehung aus feministischer Sprachperspektive
- 5.1 Das generische Maskulinum
- 5.2 Auseinandersetzung um den generischen Sprachgebrauch
- 5.3 Vorschläge für die sprachliche Gleichbehandlung von Männern und Frauen
- 5.4 Sprachwandel unter dem Einfluss der feministischen Linguistik
- 6 Genus-Sexus-Beziehung aus fremdsprachendidaktischer Perspektive
- 6.1 Ursachen für die Lehr- und Lernschwierigkeit der Kategorie „Genus"
- 6.2 Didaktische Vorschläge für die Erleichterung des Genuserwerbs
- 6.2.1 Mnemotechniken
- 6.2.2 Didaktische Adaptation von Genuszuweisungsprinzipien
- 6.2.3 Arbeit am Text und grammatische Übungen
- 6.3 Zusammenfassung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den Genus-Sexus-Beziehungen in der deutschen Sprache, wobei sie sowohl linguistische als auch fremdsprachendidaktische Perspektiven beleuchtet. Ziel ist es, den Forschungsstand zu diesem Thema zu analysieren und ein möglichst unabhängiges, objektives Bild zu schaffen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf kontroverse genustheoretische Aufsätze und vermeidet einseitige Darstellungen.
- Die Entstehung des grammatischen Geschlechts im Deutschen
- Die Funktionen des Genus in der deutschen Sprache
- Faktoren der Genuszuweisung im Deutschen
- Die Kritik am generischen Maskulinum aus feministischer Sicht
- Didaktische Herausforderungen und Lösungsansätze beim Genuserwerb im DaF-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Debatte um die Entstehung des Genussystems im Deutschen. Die Arbeit stellt die gegensätzlichen Ansichten von Grimm/Rothe und Brugmann/Michels dar, die entweder den Sexus als primäre Ursache für die Genusdifferenzierung sehen oder das Genus als eine formale Kategorie betrachten, die unabhängig vom Sexus entstanden ist.
Kapitel 3 untersucht die Funktionen des Genus in der deutschen Gegenwartsprache. Es werden die strukturell-logische, textverweisende, die Bedeutungsunterschiede anzeigende und die kommunikativ-pragmatische Funktion des Genus erläutert. Die Arbeit zeigt, dass das Genus trotz seiner scheinbaren Abstraktheit eine wichtige Rolle in der Organisation der Sprache spielt.
Kapitel 4 analysiert die Faktoren der Genuszuweisung im Deutschen. Es werden morphologische, semantische und lautliche Regeln sowie Genusschwankungen betrachtet. Die Arbeit zeigt, dass die Genuszuweisung im Deutschen zwar nicht vollständig arbiträr ist, aber dennoch von zahlreichen Ausnahmen und komplexen Zusammenhängen geprägt ist.
Kapitel 5 befasst sich mit der Genus-Sexus-Beziehung aus feministischer Sprachperspektive. Es wird die Kritik am generischen Maskulinum als einem Ausdruck sprachlicher Diskriminierung von Frauen dargestellt. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Lösungsvorschläge der feministischen Linguistik, wie z.B. die Beidbenennung, die Neutralisierung und die Feminisierung.
Kapitel 6 untersucht die Genus-Sexus-Beziehung aus fremdsprachendidaktischer Perspektive. Es werden die Ursachen für die Lernschwierigkeiten beim Genuserwerb im DaF-Unterricht analysiert. Die Arbeit stellt verschiedene didaktische Vorschläge zur Erleichterung des Genuserwerbs vor, wie z.B. Mnemotechniken, die Adaptation von Genuszuweisungsprinzipien und die Arbeit am Text.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das grammatische Geschlecht (Genus), das natürliche Geschlecht (Sexus), die Genus-Sexus-Beziehung, die Entstehung des Genussystems im Deutschen, die Funktionen des Genus, die Faktoren der Genuszuweisung, die Kritik am generischen Maskulinum, die feministische Sprachwissenschaft, die fremdsprachendidaktische Perspektive, der Genuserwerb im DaF-Unterricht und die didaktischen Möglichkeiten zur Erleichterung des Genuserwerbs.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Genus-Sexus-Beziehung?
Es beschreibt das Verhältnis zwischen dem grammatischen Geschlecht (Genus) und dem biologischen Geschlecht (Sexus) in der Sprache.
Wie entstand das Genussystem in der deutschen Sprache?
Es gibt verschiedene Theorien: Einige Forscher wie Grimm sehen den Sexus als primäre Ursache, während andere wie Brugmann das Genus als formale Kategorie betrachten, die unabhängig vom Sexus entstand.
Was ist die Kritik der feministischen Linguistik am generischen Maskulinum?
Die feministische Linguistik kritisiert, dass das generische Maskulinum Frauen sprachlich unsichtbar macht und fordert Alternativen wie Beidbenennung oder Neutralisierung.
Welche Faktoren bestimmen die Genuszuweisung im Deutschen?
Die Genuszuweisung erfolgt durch morphologische (Form), semantische (Bedeutung) und lautliche Faktoren, ist jedoch oft komplex und weist Ausnahmen auf.
Warum ist der Genuserwerb für DaF-Lerner so schwierig?
Die Schwierigkeit liegt in der teilweisen Arbitrarität der Genuszuweisung und dem Mangel an eindeutigen Regeln, was didaktische Hilfsmittel wie Mnemotechniken erforderlich macht.
- Quote paper
- Natalja Groo (Author), 2012, Genus-Sexus-Beziehungen aus der linguistischen und fremdsprachendidaktischen Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274064