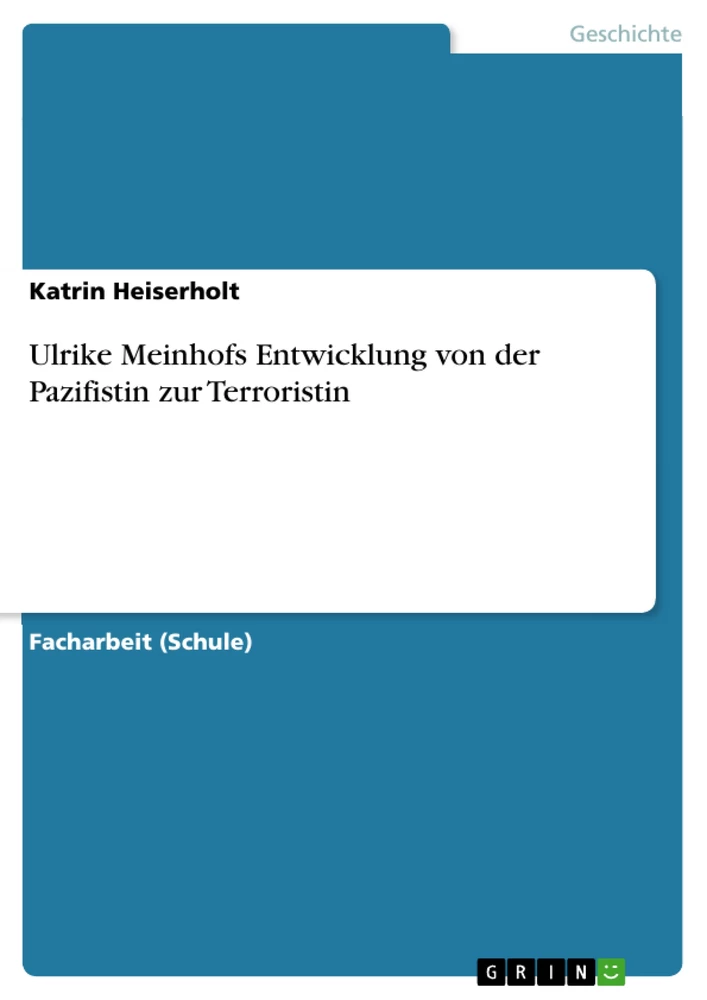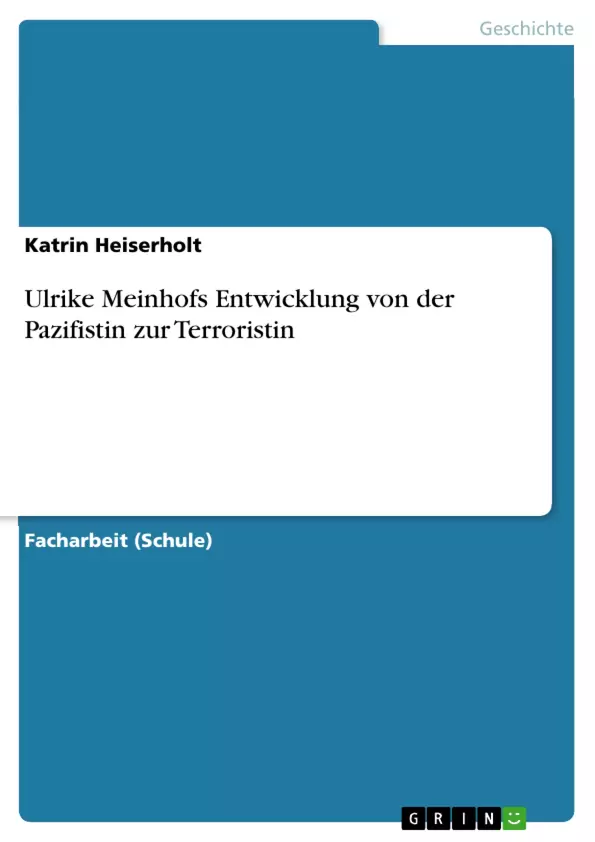Für dieses Thema habe ich mich entschieden, da mich die Frage nach den Gründen, die zur politischen Radikalität führen, sehr beschäftigt hat. Durch die Faszination des politischen Durchhaltevermögens der Pazifistin Ulrike Meinhof fiel es mir umso
schwerer, die Gedankenstränge nachvollziehen zu können, die ein Leben mit Gewalt schließlich legitimierten, ja sogar voraussetzen, um überhaupt leben zu können.
Daher werde ich im Folgenden versuchen, die Gründe für die zunehmende Gewaltakzeptanz Ulrike Meinhofs herauszufinden.
Aus dem Inhalt:
- Persönliche und gesellschaftliche Verhältnisse (Kindheit, Persönlichkeit, Gewissen, Familie und Karriere);
- Politische Schlüsselerlebnisse (Wiederaufrüstung, Antikommunismus, Notstandsgesetze, Große Koalition, Benno Ohnesorg, Frankfurter Kaufhausbrandstifter);
- Übergang zum Terrorismus (Aussagen über Gewaltanwendung, mögliche Gründe)
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Thema
- Vorwort
- Geschichtlicher Überblick
- Kurzbiographie Ulrike Meinhof
- Die Entwicklung Ulrike Meinhofs von der Pazifistin zur Terroristin
- Persönliche und gesellschaftliche Verhältnisse
- Erziehung und Einflüsse Ulrike Meinhofs
- Persönlichkeit Ulrike Meinhofs
- Verantwortungsbewusstsein und Gewissen
- Familie und Karriere
- Politische Schlüsselerlebnisse und Ulrikes Reaktionen
- Wiederaufrüstung und Antikommunismus
- Notstandsgesetze und Große Koalition
- Tod von Benno Ohnesorg
- Frankfurter Kaufhausbrandstiftung
- Übergang zum Terrorismus
- Ulrikes Aussagen über Gewaltanwendung vor dem Eintritt in das Untergrundleben
- Vermutliche Hauptgründe für die Entscheidung zur Gewaltanwendung
- Persönliche und gesellschaftliche Verhältnisse
- Schlussbetrachtung: Bewertung des militanten Widerstandes im Hinblick auf die Möglichkeit des gewaltfreien Widerstandes
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit analysiert die Entwicklung Ulrike Meinhofs von einer Pazifistin zur Terroristin. Sie untersucht die prägenden Lebensumstände, politischen Schlüsselerlebnisse und deren Einfluss auf ihre Radikalisierung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für Meinhofs zunehmende Akzeptanz von Gewalt zu verstehen und den Übergang von pazifistischem Engagement zum Terrorismus zu beleuchten.
- Die Rolle von Erziehung und Familie in der Entwicklung des Verantwortungsbewusstseins und Gewissens Ulrike Meinhofs
- Politische Schlüsselereignisse, wie die Wiederaufrüstung, die Notstandsgesetze, der Tod von Benno Ohnesorg und die Frankfurter Kaufhausbrandstiftung, als Katalysatoren für Meinhofs Radikalisierung
- Der Einfluss von Resignation und Ohnmacht auf Meinhofs Entscheidung für ein Leben im Untergrund und ihre Akzeptanz von Gewaltanwendung
- Die Bedeutung der moralischen Sensibilität und des Mitleidens für Meinhofs politische Haltung
- Die Frage nach der Legitimität von Gewalt im Kontext der politischen Verhältnisse der BRD in den 1960er und 1970er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung in das Thema beleuchtet die Motivation der Autorin, die Frage nach den Gründen für politische Radikalität zu untersuchen. Sie stellt die Faszination für Ulrike Meinhof als Pazifistin und die Schwierigkeit, ihre spätere Akzeptanz von Gewalt zu verstehen, dar. Der geschichtliche Überblick skizziert die politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, die geprägt war von politischer Lustlosigkeit und Verdrängung der Vergangenheit. Die Entstehung der Studentenbewegung der 1960er Jahre, die sich gegen die Wiederaufrüstung und den Vietnamkrieg wandte, wird im Kontext der politischen Bewusstseinsveränderung der jungen Generation dargestellt. Die Entstehung der Roten Armee Fraktion (RAF) als terroristische Untergrundorganisation wird kurz umrissen.
Der zweite Abschnitt analysiert die persönlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die Ulrike Meinhofs Entwicklung prägten. Die christliche Erziehung in einer bürgerlichen Familie und die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung ihrer moralischen Sensibilität und des Verantwortungsbewusstseins. Die Darstellung ihrer Persönlichkeit beleuchtet die Ambivalenz zwischen Selbstbewusstsein und Unsicherheit, die sich in ihren Beziehungen und ihrem Umgang mit der Öffentlichkeit widerspiegelte. Die Beschreibung ihrer Karriere und ihres Engagements in der Studentenbewegung verdeutlicht den Einfluss ihrer Pflegemutter Renate Riemeck und die zunehmende Radikalisierung ihrer politischen Haltung.
Im dritten Kapitel werden die wichtigsten politischen Schlüsselerlebnisse und Ulrikes Reaktionen darauf analysiert. Die Wiederaufrüstung und der Antikommunismus der Adenauer-Politik lösten bei Ulrike Meinhof eine tiefe Betroffenheit und ein starkes Engagement für ein kernwaffenfreies Deutschland aus. Die Notstandsgesetze, die sie als Bedrohung für die Demokratie sah, verstärkten ihre Kritik an den politischen Verhältnissen. Der Tod von Benno Ohnesorg und die Frankfurter Kaufhausbrandstiftung markierten Wendepunkte in Meinhofs Wahrnehmung der Gewalt und führten zu einer zunehmenden Sympathie für radikalere Handlungsweisen.
Der vierte Abschnitt befasst sich mit dem Übergang Ulrike Meinhofs zum Terrorismus. Ihre Aussagen über Gewaltanwendung vor dem Eintritt in das Untergrundleben zeigen die Spannung zwischen ihren pazifistischen Grundsätzen und der wachsenden Akzeptanz von Gewalt. Die Vermutlichen Hauptgründe für ihre Entscheidung für die Gewaltanwendung werden in der Resignation und Ohnmacht der Pazifistin, der Angst vor der Vergangenheit und der moralischen Sensibilität, die sie zu einer extremen Pauschalisierung von „gut" und „böse" führte, begründet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Entwicklung Ulrike Meinhofs von der Pazifistin zur Terroristin, die politische Radikalisierung, die RAF, die Studentenbewegung der 1960er Jahre, die Wiederaufrüstung, die Notstandsgesetze, der Tod von Benno Ohnesorg, die Frankfurter Kaufhausbrandstiftung, die moralische Sensibilität, das Verantwortungsbewusstsein, die Resignation und die Ohnmacht. Der Text beleuchtet die Rolle von Erziehung, Familie, politischen Schlüsselereignissen und persönlichen Erfahrungen in der Entwicklung von Ulrike Meinhofs politischer Haltung und ihrer Entscheidung für ein Leben im Untergrund.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Facharbeit über Ulrike Meinhof?
Die Arbeit analysiert den Radikalisierungsprozess von Ulrike Meinhof, von ihrem Ursprung als Pazifistin bis hin zu ihrer Rolle als Terroristin in der RAF.
Welche politischen Ereignisse prägten Meinhofs Entwicklung?
Wichtige Katalysatoren waren die Wiederaufrüstung, die Notstandsgesetze, der Tod von Benno Ohnesorg und die Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt.
Welche Rolle spielte ihre Erziehung für ihr späteres Handeln?
Ihre christlich-bürgerliche Erziehung und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus förderten ein starkes moralisches Verantwortungsbewusstsein und Mitleid mit Opfern.
Warum entschied sich Meinhof schließlich für die Gewalt?
Die Arbeit nennt Resignation, Ohnmacht gegenüber den politischen Verhältnissen der BRD und eine extreme moralische Schwarz-Weiß-Sicht als Hauptgründe.
Wie wird die Zeit der 1960er Jahre in der Arbeit beschrieben?
Als eine Ära der politischen Verdrängung der Vergangenheit, gegen die sich die Studentenbewegung und später radikale Gruppen wie die RAF auflehnten.
Wird in der Arbeit auch gewaltfreier Widerstand thematisiert?
Ja, die Schlussbetrachtung bewertet den militanten Widerstand kritisch im Hinblick auf die Möglichkeiten des gewaltfreien Protests.
- Citar trabajo
- Katrin Heiserholt (Autor), 2006, Ulrike Meinhofs Entwicklung von der Pazifistin zur Terroristin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274279