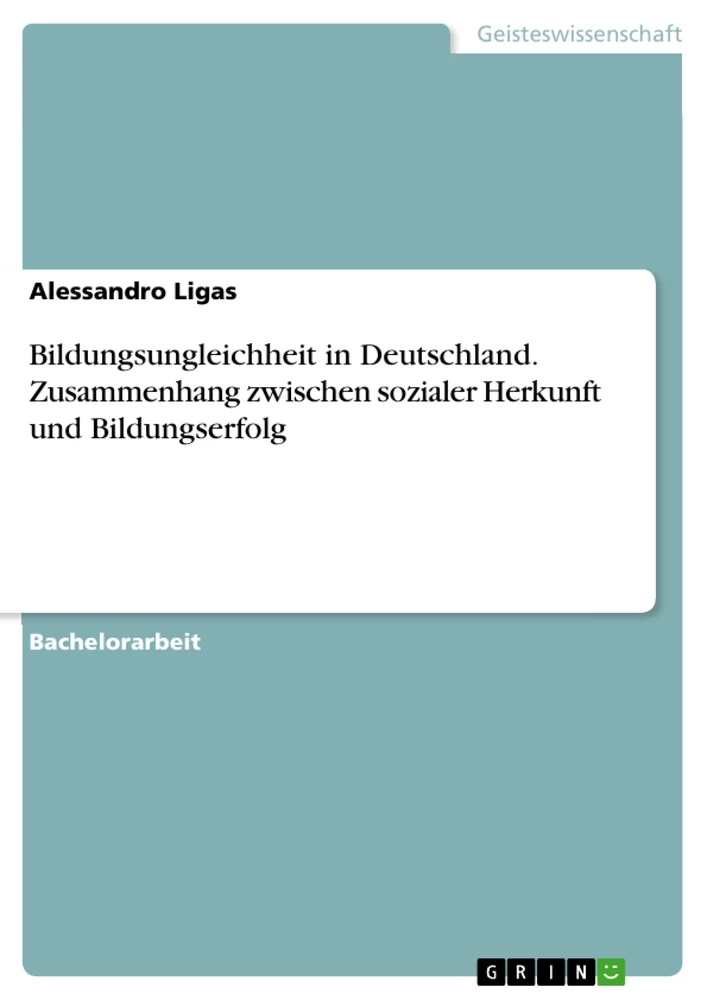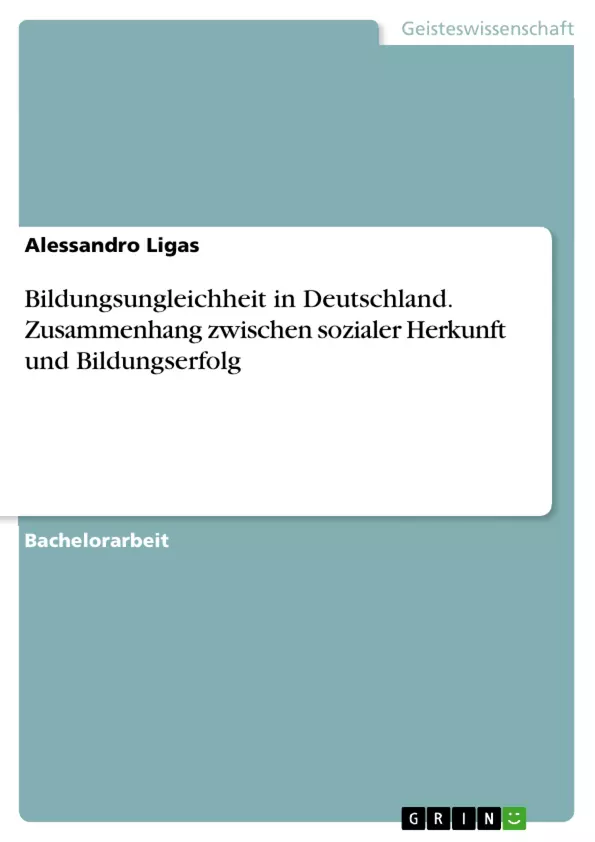Das deutsche Bildungssystem und die deutsche Bildungspolitik stehen seit gut fünf Jahrzehnten in der Kritik. Die deutsche Öffentlichkeit und Politik wurde durch die internationalen Schulleistungsstudien, insbesondere die PISA-(Programme for International Student Assessment) Studien, wieder daran erinnert, dass das deutsche Bildungssystem sehr stark nach sozialer Herkunft selektiert. Zwar ist dies ein Phänomen, das in den meisten Ländern der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) auftritt, doch nirgends ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg so eng miteinander verknüpft wie in Deutschland. Die Schülerleistung scheint nicht mehr (nur) das ausschlaggebende Kriterium zu sein, um den maximalen Bildungserfolg zu garantieren. Vielmehr scheint die berufliche Stellung der Eltern und deren Schichtzugehörigkeit einen viel zu bedeutenden Einfluss auf die Bildungskarriere eines Kindes zu nehmen. Die Eltern und ihre Kinder, besonders die der unteren Sozialschicht, klagen immer vehementer, dass sie durch das Bildungssystem im Vergleich zu den Kindern der oberen Sozialschicht ungleich behandelt werden. Die Folgen, die durch die Bildungsungleichheit entstehen, sind schwerwiegend, sowohl für die Gesellschaft als auch für den einzelnen Menschen. Denn Erfolge oder Misserfolge in der Bildung können die (berufliche) Zukunft eines Menschen bedeutsam beeinflussen. Ganz besonders im Hinblick auf die zukünftige Sozialstruktur einer Gesellschaft kann die Bildungsungleichheit einen folgenschweren Beitrag dazu leisten, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderdriftet.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Bildungsungleichheit in Deutschland - Stand und Entwicklung
- II.1 Begriffsbestimmungen
- II.1.1 Bildungsungleichheit
- II.1.2 Soziale Herkunft
- II.2 Aufbau des deutschen Bildungssystems
- II.3 Aktueller Forschungsstand
- II.3.1 Die Geschichte der Bildungsungleichheit in Deutschland
- II.3.2 Die PISA-Studie und ihre Ergebnisse in Bezug auf Bildungsungleichheit
- II.1 Begriffsbestimmungen
- III Theorien zur Bildungsungleichheit
- III.1 Ansätze der Rational-Choice-Theorie
- III.1.1 Das Modell von Raymond Boudon
- III.1.1.1 Der primäre Herkunftseffekt
- III.1.1.2 Der sekundäre Herkunftseffekt
- III.1.1.3 Das statistische Modell von Raymond Boudon
- III.1.2 Die Wert-Erwartungstheorie nach Hartmut Esser
- III.1.3 Die Humankapitaltheorie
- III.1.1 Das Modell von Raymond Boudon
- III.2 Der Ansatz Pierre Bourdieus
- III.2.1 Die Theorie der sozialen Praxis
- III.2.1.1 Der Habitus und der soziale Raum
- III.2.1.2 Die Kapitalarten
- III.2.2 „Die Illusion der Chancengleichheit"
- III.2.2.1 Bildungsprivileg und Bildungschancen
- III.2.2.2 Die Aufrechterhaltung der Ordnung
- III.2.1 Die Theorie der sozialen Praxis
- IV Fazit und Kritik
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Situation der Bildungsungleichheit in Deutschland zu beleuchten und anhand verschiedener soziokultureller Theorien (Modelle) zu begründen.
- Bildungsungleichheit in Deutschland
- Soziale Herkunft und Bildungserfolg
- Theorien der Bildungsungleichheit (Rational-Choice-Theorie, Pierre Bourdieu)
- Empirische Forschungsergebnisse (PISA-Studie)
- Kritik am deutschen Bildungssystem und Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bildungsungleichheit in Deutschland ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der deutschen Bildungspolitik und der Ergebnisse internationaler Schulleistungsstudien heraus.
Kapitel II beleuchtet den Stand und die Entwicklung der Bildungsungleichheit in Deutschland. Es werden zentrale Begriffe wie Bildungsungleichheit und soziale Herkunft definiert und das deutsche Bildungssystem in seinen Grundzügen erläutert. Der aktuelle Forschungsstand wird anhand der Geschichte der Bildungsungleichheit in Deutschland und der Ergebnisse der PISA-Studie dargestellt.
Kapitel III behandelt verschiedene Theorien der Bildungsungleichheit, die versuchen, einen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zu erklären. Es werden die wichtigsten Ansätze der Rational-Choice-Theorie, insbesondere die Modelle von Raymond Boudon und Hartmut Esser, sowie die Theorie der sozialen Praxis von Pierre Bourdieu im Kontext seiner Studie „Die Illusion der Chancengleichheit" dargestellt, analysiert und kritisch beurteilt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Bildungserfolg, PISA-Studie, Rational-Choice-Theorie, Pierre Bourdieu, „Die Illusion der Chancengleichheit", deutsches Bildungssystem, Kritik, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Erkenntnis der PISA-Studie für Deutschland?
Die Studie belegt, dass in Deutschland der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg im Vergleich zu anderen OECD-Ländern besonders eng verknüpft ist.
Was versteht Raymond Boudon unter primären und sekundären Herkunftseffekten?
Primäre Effekte sind schichtspezifische Leistungsunterschiede, während sekundäre Effekte die Bildungsentscheidungen der Eltern (z. B. Wahl der Schulform) trotz gleicher Leistung bezeichnen.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieus Theorie des Kapitals?
Bourdieu argumentiert, dass Bildungserfolg vom ökonomischen, sozialen und vor allem kulturellen Kapital (z. B. Bildungshintergrund der Eltern) abhängt.
Was meint Bourdieu mit der „Illusion der Chancengleichheit“?
Er vertritt die These, dass das Bildungssystem soziale Ungleichheiten eher legitimiert und reproduziert, anstatt sie durch echte Chancengleichheit aufzubrechen.
Warum ist Bildungsungleichheit ein schwerwiegendes gesellschaftliches Problem?
Sie führt dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderdriftet, da der Bildungserfolg die berufliche Zukunft und soziale Stellung massiv beeinflusst.
- III.1 Ansätze der Rational-Choice-Theorie
- Quote paper
- Alessandro Ligas (Author), 2013, Bildungsungleichheit in Deutschland. Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274308