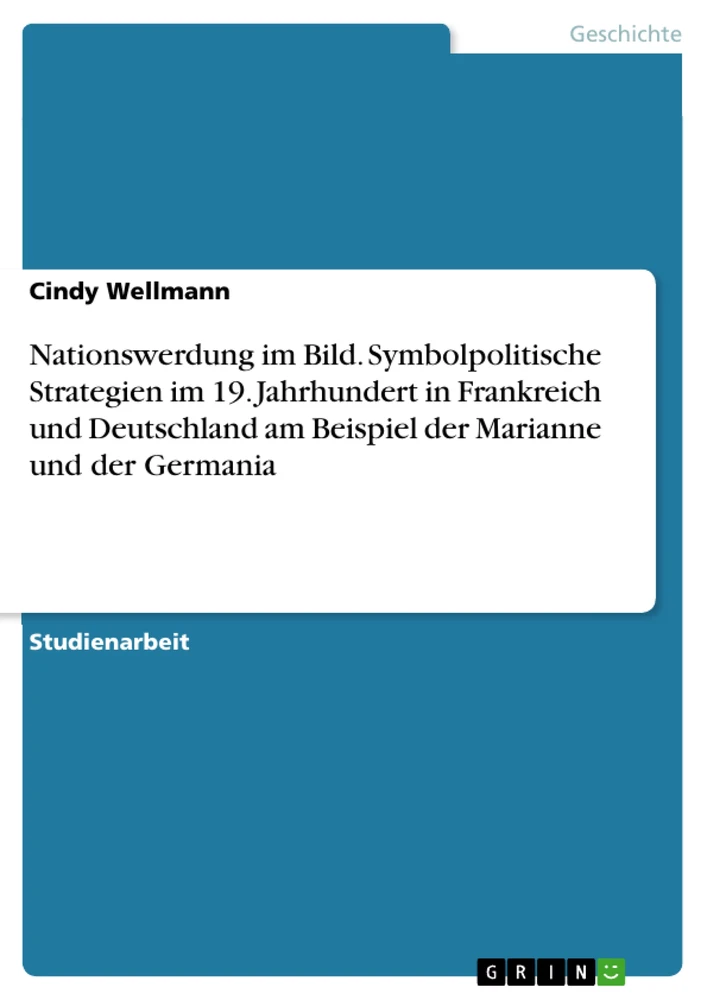„Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so,
dass die Idee im Bild immer unendlich wirksam und erreichbar bleibt.“
(Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen, Nr. 1112 und 1113)
Die Hauptfunktion einer Allegorie ist die memoria, das in Erinnerung-Rufen kollektiver Werte und Ordnungen. Abstrakte Eigenschaften und politisch-soziale Konzepte können nicht nur durch Sprache übermittelt, sondern auch durch ein visuelles Bild und einen Merksatz, der Begriff und Bild miteinander verbindet, begreifbar gemacht werden. Die Wirkung einer Allegorie zielt auf Synästhesie, die Zusammenführung unterschiedlicher Wahrnehmungsmechanismen, die die Einprägsamkeit der Konzepte fördern soll. Im Vordergrund stehen hierbei die Gefühle, die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit unterstützen.
Die Visualisierung der Nationen ist in Europa seit dem Mittelalter verankert.2 Ob die ungarische Pannonia, die Moer Danmark, die Moder Svea der Schweden, die Helvetica, Britannia, Polonia oder Italia, die Symbolgestalten der Nationen verdanken ihre Bedeutung Projektionen wechselhafter nationaler Geschichte. In Bezug auf den Verlauf der Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts in Europa sind diese beiden Allegorien die wohl interessantesten: Marianne und Germania.
Wie die bereits genannten Allegorien sind sie die weiblichen Versinnbildlichungen ihrer Nationen, in diesem Fall für die französische und deutsche Nation. Der Vergleich der beiden verdeutlicht ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede. Bereits vom Namen ausgehend, ergibt sich dem Rezipienten eine erste Ahnung der Spannung: Wenn die deutsche Nation Germania getauft wurde, warum wurde ihr Pendant nicht Francia oder Gallia genannt? Warum wurde für Frankreichs Allegorie ein gängiger Vorname gewählt?
Die Struktur und Funktionen allegorischer Sinnbilder legen es nahe, nicht nur die Entwicklungen einzelner zu beschreiben, sondern auch die Pragmatik ihrer Einsätze zu bestimmen. So wurden die Bilderwelten der Marianne und Germania in der Frühen Neuzeit durch politische Ereignisse wie Kriege, Friedensschlüsse, Königswahlen, Kaiserkrönung oder Reichstage geprägt. Die Botschaften, die sie vermitteln sollten, konnten auch dem nicht unwesentlichen illiteraten Teil der Bevölkerung zugänglich gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kreation einer Nationalfigur
- Geschichte der Entwicklung der Marianne
- Geschichte der Entwicklung der Germania
- Die Bilderwelten der Marianne und Germania
- Von der Französischen Revolution bis 1848
- Die frühe Germania
- Die Marianne von der Revolution bis zum Bürgerkönig
- Marianne und Germania im Zeichen der Revolution von 1848
- Die Veitsche Germania
- Die Marianne der Zweiten Republik
- Marianne und Germania im Zeichen des Deutsch-Französischen Kriegs
- Germanias Entwicklung zur Walküre
- Der Pathos der Dritten Republik
- Von der Französischen Revolution bis 1848
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der allegorischen Figuren Marianne und Germania als nationale Symbole Frankreichs und Deutschlands. Die Zielsetzung besteht darin, die unterschiedlichen Formen der Herausbildung moderner Nationalvorstellungen in den Bilderwelten beider Nationen zu vergleichen und die politischen Programme in der Inszenierung der Allegorien aufzuzeigen.
- Entwicklung der allegorischen Figuren Marianne und Germania
- Vergleich der Symbolik und Attribute beider Figuren
- Einfluss politischer Ereignisse auf die Darstellung der Allegorien
- Analyse der semantischen Gehalte und Funktionen der Allegorien im Kommunikationsprozess
- Symbolpolitische Strategien und Auseinandersetzungen über die Interpretation der Allegorien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der nationalen Allegorien ein und betont die Bedeutung von Bildern und Symbolen für die Vermittlung kollektiver Werte und Ordnungen. Sie stellt die Figuren Marianne und Germania als zentrale Beispiele für die Visualisierung nationaler Identität im 19. Jahrhundert vor und skizziert die Forschungsfrage nach den unterschiedlichen Formen der Herausbildung nationaler Vorstellungen in den Bilderwelten Deutschlands und Frankreichs.
Kreation einer Nationalfigur: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Allegorien Marianne und Germania. Es wird die Entwicklung beider Figuren kurz nachgezeichnet, wobei der Fokus auf die jeweiligen historischen und politischen Kontexte liegt.
Die Bilderwelten der Marianne und Germania: Dieses Kapitel analysiert die Bilderwelten von Marianne und Germania von der Französischen Revolution bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Es untersucht die Veränderungen in der Darstellung der Figuren im Laufe der Zeit und deren Bedeutung in verschiedenen politischen Kontexten. Die Analyse umfasst die Attribute der Allegorien, ihre ästhetischen Darstellungsweisen und die symbolpolitischen Strategien, die mit ihrer Verwendung verbunden waren. Die Entwicklung der beiden Figuren wird anhand künstlerischer Erzeugnisse, hauptsächlich Gemälde, in chronologischer Reihenfolge nachvollzogen.
Schlüsselwörter
Marianne, Germania, Nationalallegorien, Frankreich, Deutschland, Nationalismus, Symbolpolitik, Bildanalyse, 19. Jahrhundert, Französische Revolution, Deutsch-Französischer Krieg, visuelle Kommunikation, nationale Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung der Nationalallegorien Marianne und Germania
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der allegorischen Figuren Marianne und Germania als nationale Symbole Frankreichs und Deutschlands. Sie vergleicht die unterschiedlichen Formen der Herausbildung moderner Nationalvorstellungen in den Bilderwelten beider Nationen und zeigt die politischen Programme in der Inszenierung der Allegorien auf.
Welche Aspekte der Figuren Marianne und Germania werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung beider Figuren von ihren Anfängen bis zum Deutsch-Französischen Krieg, ihre Symbolik und Attribute, den Einfluss politischer Ereignisse auf ihre Darstellung, die semantischen Gehalte und Funktionen der Allegorien im Kommunikationsprozess sowie symbolpolitische Strategien und Auseinandersetzungen über ihre Interpretation.
Welche Zeiträume werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse umfasst den Zeitraum von der Französischen Revolution bis zum Deutsch-Französischen Krieg, mit besonderem Fokus auf die Entwicklung der Figuren in den jeweiligen politischen Kontexten und Umbrüchen wie der Revolution von 1848.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse basiert hauptsächlich auf künstlerischen Erzeugnissen, vor allem Gemälden, um die Entwicklung der Figuren Marianne und Germania chronologisch nachzuvollziehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung der Nationalfiguren, ein Kapitel zur Analyse der Bilderwelten von Marianne und Germania über verschiedene historische Perioden, und ein Fazit. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Marianne, Germania, Nationalallegorien, Frankreich, Deutschland, Nationalismus, Symbolpolitik, Bildanalyse, 19. Jahrhundert, Französische Revolution, Deutsch-Französischer Krieg, visuelle Kommunikation, nationale Identität.
Welche konkreten Fragen werden im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Marianne und Germania, vergleicht deren Symbolik und Attribute, analysiert den Einfluss politischer Ereignisse auf ihre Darstellung und beleuchtet die symbolpolitischen Strategien, die mit ihrer Verwendung verbunden waren.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Es gibt Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung, das Kapitel zur Kreation der Nationalfiguren und das Kapitel zu den Bilderwelten von Marianne und Germania. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den jeweiligen Inhalt und die behandelten Aspekte.
- Quote paper
- Cindy Wellmann (Author), 2013, Nationswerdung im Bild. Symbolpolitische Strategien im 19. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland am Beispiel der Marianne und der Germania, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274377