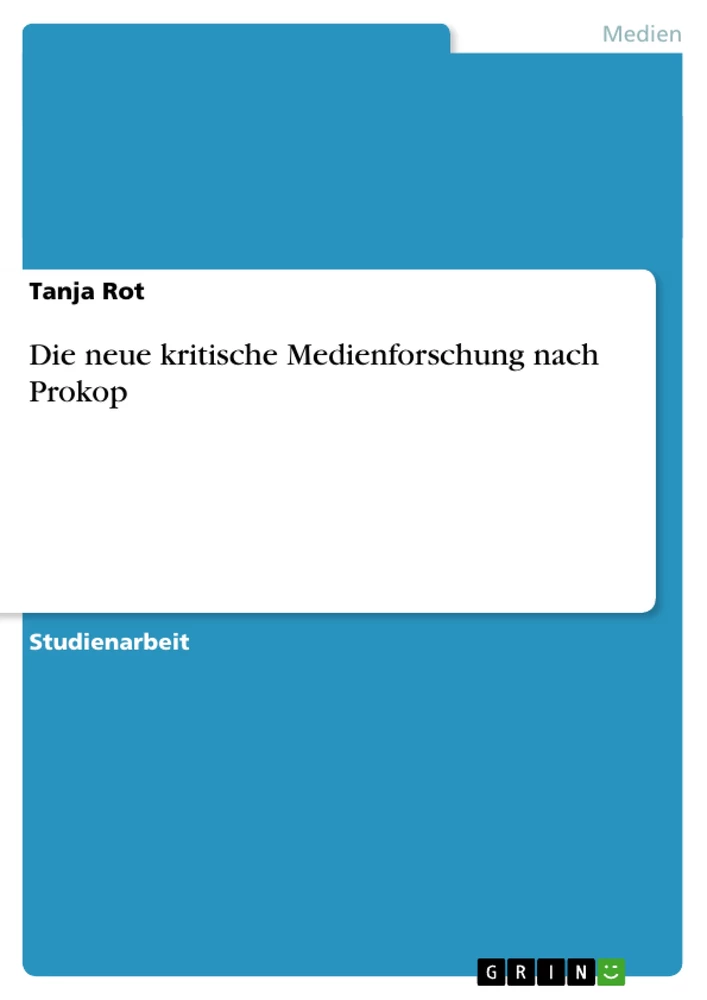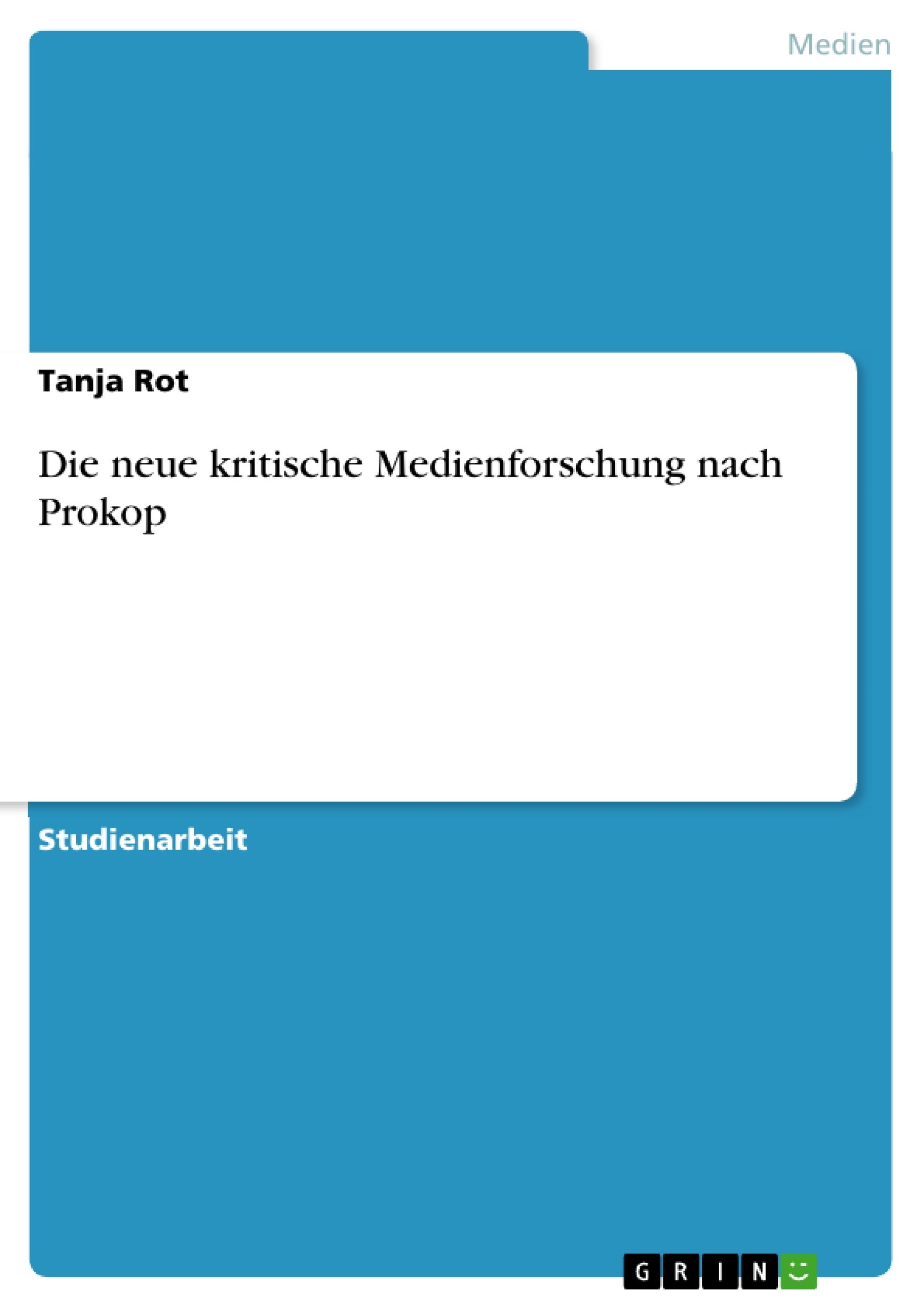Anhand der Darstellung der neuen kritischen Medienforschung Prokops soll erörtert werden, welche kritischen Fragen übernommen wurden und wie diese heute beantwortet werden.
Schlussendlich soll geklärt werden, inwieweit der kulturpessimistische Ansatz Adornos in der kritischen Medientheorie Prokops einen Platz findet und inwieweit diese kritischen Ansätze berechtigt sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen und Grundbegriffe der kritischen Medientheorie
- Die kritische Medientheorie Prokops
- Der Kritikbegriff bei Prokop
- Der Medienkapitalismus: Ideologiekritik
- Kapitalistische-kommerzielle Strukturen der Medienindustrie nach Prokop
- Kritikpunkte an den Medien-Oligopol-Kapitalismus nach Prokop
- Kommerzielle Zielgruppenforschung – Darstellung nach Prokop
- Quantitative und qualitative Zielgruppenforschung
- Kritikpunkte der kommerziellen Zielgruppenforschung nach Prokop
- Das Manipulationspotential der Massenmedien
- „Zirkel von Manipulation“ - Adornos Kritik der Kulturindustrie
- Prokops Position zum kulturkritischen Begriff der Kritischen Theorie
- Der Entwurf einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie
- Das Verfassungsverständis der Kulturalisten und Neoliberalen nach Prokop
- Verstand und Gefühl im demokratisch-tolerante Modell
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kritische Medientheorie von Dieter Prokop im Kontext der Frankfurter Schule und der Kritischen Theorie. Sie analysiert Prokops Übernahme und Weiterentwicklung kritischer Fragen der Medientheorie und beleuchtet dessen Ansatz einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie. Die Arbeit erörtert die Relevanz des kulturpessimistischen Ansatzes Adornos in Prokops Theorie und hinterfragt die Berechtigung der dargestellten kritischen Ansätze.
- Prokops kritische Medientheorie im Vergleich zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule
- Analyse des Medienkapitalismus und seiner Auswirkungen auf die Medienproduktion und -rezeption
- Kritik an der kommerziellen Zielgruppenforschung und ihren Folgen
- Das Manipulationspotenzial der Massenmedien und dessen Einfluss auf die Gesellschaft
- Prokops Entwurf einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie als Gegenmodell
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt die zentrale These vor: Eine Analyse der kritischen Medientheorie von Dieter Prokop, unter Berücksichtigung seines Ansatzes für eine zukünftige, demokratisch-tolerante Kulturindustrie, im Vergleich zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule, insbesondere Adornos und Horkheimers. Es wird die Frage nach der Übernahme und Weiterentwicklung kritischer Fragen und die Berechtigung der kritischen Ansätze thematisiert.
Grundlagen und Grundbegriffe der kritischen Medientheorie: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen der kritischen Medientheorie, basierend auf der materialistischen Gesellschaftstheorie Adornos und Horkheimers. Es wird das hohe Manipulationspotential der Massenmedien und die Kritik an den kommerziellen Aspekten der Kulturindustrie hervorgehoben. Die Kritik bezieht sich nicht nur auf die Medien selbst, sondern auch auf deren Rolle innerhalb des kapitalistischen Systems und deren ideologischen Einfluss.
Die kritische Medientheorie Prokops: Dieses Kapitel präsentiert Prokops materialistische Medientheorie, die den „Kampf der Individuen zwischen gesellschaftlichen Zwängen und dem Wunsch nach Emanzipation“ in den Mittelpunkt stellt. Prokops Theorie wird als eine der wenigen materialistischen Medientheorien vorgestellt, die die realistischen Bedingungen der Medienforschung und deren Verhaftung an grundlegende gesellschaftliche Gesetze berücksichtigt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen, die die Interessen der Werbewirtschaft bedienen, sieht sich Prokop an die Grundgesetze gebunden.
Der Medienkapitalismus: Ideologiekritik: Dieser Abschnitt betont die Vorherrschaft von Oligopolen im Welt-Medienmarkt und analysiert die vertikale und horizontale Konzentration in Medienkonzernen nach Prokop. Es werden die Auswirkungen dieser Konzentration auf die Gestaltung, Verbreitung und Qualität von Medienprodukten diskutiert. Dabei wird die Kritik an der fehlerhaften Zielgruppenbestimmung der Oligopol-Konzerne, die sich auf kaufkräftige Konsumenten konzentrieren und somit weniger kaufkräftige Bevölkerungsgruppen vernachlässigen, im Detail erläutert.
Kommerzielle Zielgruppenforschung – Darstellung nach Prokop: Hier werden die quantitative und qualitative Zielgruppenforschung im Kontext der kommerziellen Interessen der Medienindustrie beschrieben. Die Kapitel analysiert die Methoden der Zielgruppenforschung, die darauf abzielen, Werbung effektiv an ein konsumfreudiges Publikum zu richten, und beleuchtet die damit verbundenen Folgen für die Medieninhalte und die Rezeption.
Das Manipulationspotential der Massenmedien: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Manipulationspotential der Massenmedien, ausgehend von Adornos Kritik an der Kulturindustrie. Er analysiert den „Zirkel der Manipulation“ und vergleicht Prokops Position mit dem kulturkritischen Ansatz der Kritischen Theorie.
Der Entwurf einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie: Das Kapitel beschreibt Prokops Gegenmodell zu einem manipulativen Medienkapitalismus: den Entwurf einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie. Es wird das Verfassungsverständnis der Kulturalisten und Neoliberalen nach Prokop beleuchtet und die Rolle von Verstand und Gefühl in diesem Modell erörtert.
Schlüsselwörter
Kritische Medientheorie, Dieter Prokop, Frankfurter Schule, Kritische Theorie, Medienkapitalismus, Ideologiekritik, Zielgruppenforschung, Manipulation, Kulturindustrie, Demokratisch-tolerante Kulturindustrie, Materialistische Medientheorie.
Häufig gestellte Fragen zu "Kritische Medientheorie nach Dieter Prokop"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die kritische Medientheorie von Dieter Prokop im Kontext der Frankfurter Schule und der Kritischen Theorie. Sie untersucht Prokops Übernahme und Weiterentwicklung kritischer Fragen der Medientheorie und beleuchtet seinen Ansatz einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich mit Adornos Kulturkritik und der Frage nach der Berechtigung der dargestellten kritischen Ansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Prokops kritische Medientheorie im Vergleich zur Kritischen Theorie; Analyse des Medienkapitalismus und seiner Auswirkungen; Kritik an kommerzieller Zielgruppenforschung; das Manipulationspotenzial der Massenmedien; und Prokops Entwurf einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie als Gegenmodell. Es werden Prokops Kritik am Medienkapitalismus, an der kommerziellen Zielgruppenforschung und das Manipulationspotenzial der Massenmedien im Detail untersucht.
Welche Autoren und Theorien werden diskutiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Medientheorie von Dieter Prokop und setzt sie in Beziehung zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule, insbesondere zu Adorno und Horkheimer. Prokops materialistische Medientheorie, die den "Kampf der Individuen zwischen gesellschaftlichen Zwängen und dem Wunsch nach Emanzipation" in den Mittelpunkt stellt, wird im Detail analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Grundlagen der kritischen Medientheorie, Prokops kritischer Medientheorie (inkl. Medienkapitalismus und kommerzieller Zielgruppenforschung), dem Manipulationspotenzial der Massenmedien und dem Entwurf einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie, sowie einer Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.
Was sind die zentralen Kritikpunkte Prokops?
Prokop kritisiert den Medienkapitalismus, insbesondere die Oligopolstrukturen und die daraus resultierende Konzentration der Medienmacht. Er kritisiert die kommerzielle Zielgruppenforschung, die auf kaufkräftige Konsumenten fokussiert und andere Bevölkerungsgruppen vernachlässigt. Ein weiterer Kritikpunkt ist das Manipulationspotenzial der Massenmedien und deren Einfluss auf die Gesellschaft.
Welches Gegenmodell entwickelt Prokop?
Prokop entwickelt das Gegenmodell einer demokratisch-toleranten Kulturindustrie, die die Interessen der gesamten Bevölkerung berücksichtigt und nicht nur auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet ist. Er beleuchtet dabei das Verfassungsverständnis der Kulturalisten und Neoliberalen und die Rolle von Verstand und Gefühl in diesem Modell.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kritische Medientheorie, Dieter Prokop, Frankfurter Schule, Kritische Theorie, Medienkapitalismus, Ideologiekritik, Zielgruppenforschung, Manipulation, Kulturindustrie, Demokratisch-tolerante Kulturindustrie, Materialistische Medientheorie.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende und Wissenschaftler*innen im Bereich der Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft und Soziologie, die sich mit kritischer Medientheorie, der Frankfurter Schule und den gesellschaftlichen Auswirkungen der Medien auseinandersetzen. Sie ist auch für alle Interessierten an der kritischen Analyse von Medien und Kultur relevant.
- Quote paper
- Tanja Rot (Author), 2014, Die neue kritische Medienforschung nach Prokop, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274431