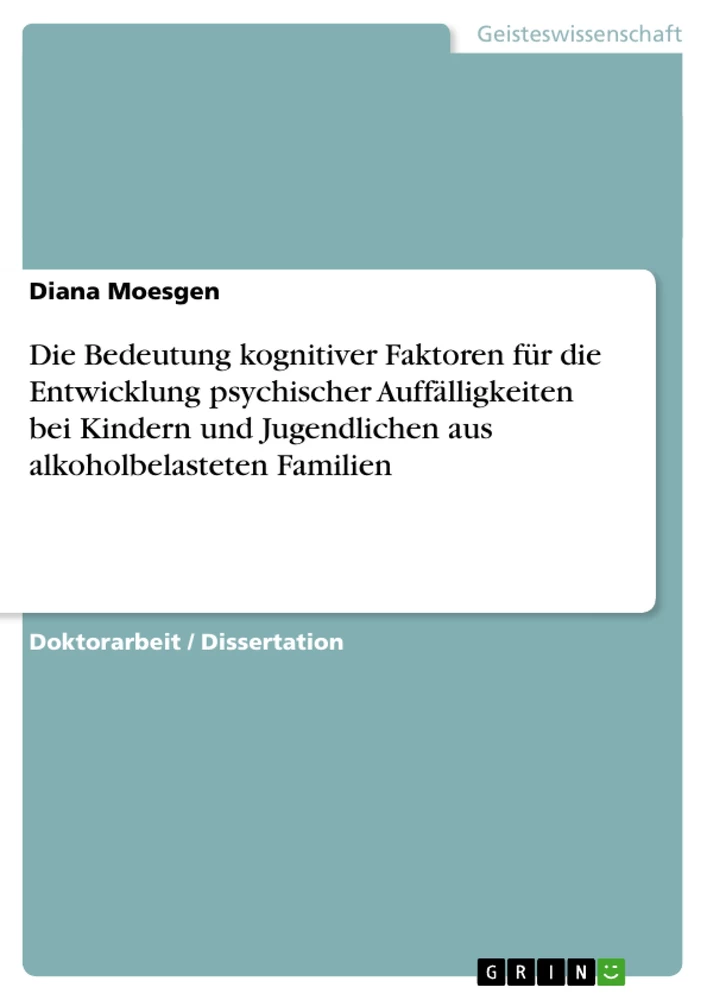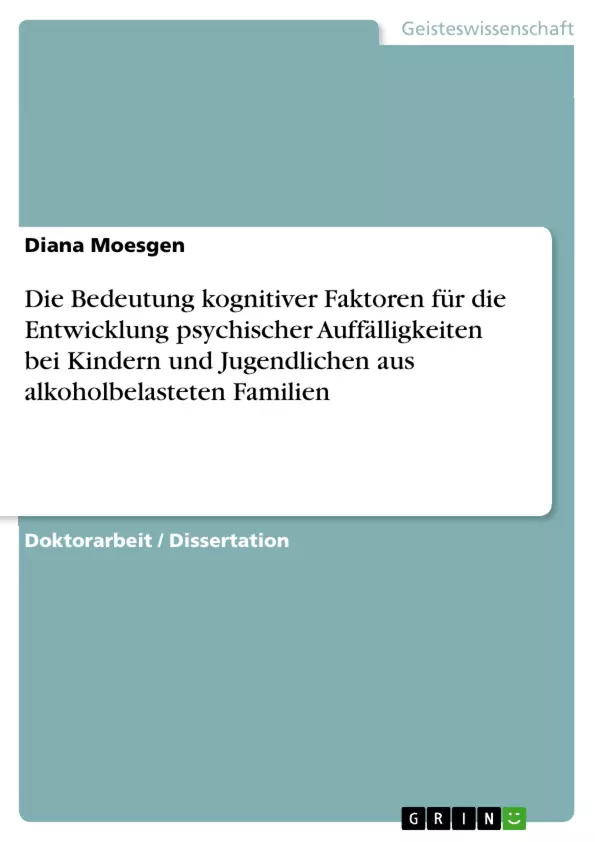Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien stellen eine besondere Risikogruppe für die Entwicklung eigener suchtbezogener Störungen sowie anderer psychischer Auffälligkeiten dar. Derartig pathologische Entwicklungsverläufe resultieren aus einem Zusammenspiel aus Risiko- und Schutzfaktoren, welche zum Einen in der Umgebung des Kindes, zum Anderen in der Person des Kindes zu finden sind. Wenig beachtet wurde bislang die Rolle kognitiver Faktoren, die für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien bedeutsam sein können; der Fokus der vorliegenden Studie wurde daher hierauf gelegt. Hierzu wurde eine Fragebogenuntersuchung mit 72 Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien und 109 unbelasteten Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Ferner wurden zwei Kasuistiken alkoholbelasteter Familien näher betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass belastete Kinder und Jugendliche in Hinblick auf verschiedene psychische Auffälligkeiten eine höhere Belastung aufweisen als Kinder und Jugendliche aus unbelasteten Familien. Hinsichtlich kognitiver Muster unterscheiden sich Kinder und Jugendliche kaum von unbelasteten Kindern und Jugendliche. Es stellte sich jedoch heraus, dass kognitive Faktoren dennoch eine besondere Bedeutung für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten besitzen. Eine ähnliche Ergebnislage zeigte sich in Hinblick auf zusätzlich untersuchter Variablen der Eltern-Kind-Beziehung. Diese Befunde stellen jedoch kein Spezifikum für Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien dar, sondern sind auch für Kinder und Jugendliche aus unbelasteten Familien zutreffend. Der Bearbeitung kognitiver Muster und familiärer Faktoren kann somit eine besondere Bedeutung sowohl in der selektiven Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien, als auch in der universellen Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus unbelasteten Familien zukommen.
Inhaltsverzeichnis
- ZUSAMMENFASSUNG
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER HINTERGRUND
- 1. Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit
- 1.1 Definition der Begrifflichkeiten Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit
- 1.2 Prävalenzen zur Alkoholproblematik in Deutschland
- 1.3 Folgeschäden von Alkoholabhängigkeit
- 2. Alkoholabhängigkeit und Familie
- 2.1 Kinder aus alkoholbelasteten Familien
- 2.2 Familiäres Transmissionsrisiko von Alkoholabhängigkeit
- 2.3 Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien
- 2.3.1 Externalisierende Auffälligkeiten
- 2.3.1.1 Hyperkinetische Störungen
- 2.3.1.2 Störungen des Sozialverhaltens
- 2.3.1.3 Weitere externalisierende Auffälligkeiten
- 2.3.2 Internalisierende Auffälligkeiten
- 2.3.2.1 Depressionen
- 2.3.2.2 Angststörungen
- 2.3.2.3 Somatische und somatoforme Störungen
- 2.4 Zusammenfassung und Fazit
- 2.3.1 Externalisierende Auffälligkeiten
- 3. Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten
- 3.1 Risikofaktoren
- 3.1.1 Umgebungsbezogene Risikofaktoren
- 3.1.2 Personenbezogene Risikofaktoren
- 3.1.3 Übersicht
- 3.2 Schutzfaktoren
- 3.2.1 Umgebungsbezogene Schutzfaktoren
- 3.2.2 Personenbezogene Schutzfaktoren
- 3.2.3 Übersicht
- 3.3 Zusammenfassung und Fazit
- 3.1 Risikofaktoren
- EMPIRISCHER TEIL
- 4. Fragestellungen und Hypothesen der Untersuchung
- 4.1 Primäre Fragestellungen und Hypothesen
- 4.1.1 Verhaltensauffälligkeiten
- 4.1.2 Kognitive Faktoren
- 4.2 Sekundäre Fragestellungen und Hypothesen
- 4.1 Primäre Fragestellungen und Hypothesen
- 5. Methode
- 5.1 Stichprobenbeschreibung
- 5.1.1 Jugendliche
- 5.1.1.1 Untersuchungsgruppe
- 5.1.1.2 Kontrollgruppe
- 5.1.1.3 Vergleichbarkeit der UG mit der KG
- 5.1.2 Fallbeispiele
- 5.1.1 Jugendliche
- 5.2 Inzentive
- 5.3 Untersuchungsinstrumente
- 5.3.1 Jugendliche
- 5.3.1.1 Soziodemographische Merkmale
- 5.3.1.2 Children of Alcoholics Screening Test (CAST)
- 5.3.1.3 Weitere Angaben zur elterlichen Suchtproblematik
- 5.3.1.4 Alkoholkonsum
- 5.3.1.5 Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ)
- 5.3.1.6 KIDCOPE
- 5.3.1.7 Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE)
- 5.3.1.8 Schema Questionnaire for Children
- 5.3.1.9 Fragebogen für negative und positive automatische Gedanken (FAG)
- 5.3.1.10 Family Assessment Measurement-lll (FAM-III)
- 5.3.1.11 Familien-Beziehungs-Skalen
- 5.3.1.12 Übersicht
- 5.3.2 Eltern
- 5.3.2.1 Soziodemographische Merkmale
- 5.3.2.2 Angaben zur elterlichen Suchtproblematik
- 5.3.2.3 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)
- 5.3.2.4 Skala „Medikamenteneinnahme" aus dem Fragebogen zur Erfassung des Gesundheitsverhaltens (FEG)
- 5.3.2.5 General Health Questionnaire (GHQ-12)
- 5.3.2.6 Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ) - Elternversion
- 5.3.2.7 Family Assessment Measurement-lll (FAM-III)
- 5.3.2.8 Familien-Beziehungs-Skalen (FBS)
- 5.3.2.9 Übersicht
- 5.3.1 Jugendliche
- 5.4 Untersuchungsablauf
- 5.4.1 Ablauf der Untersuchung für die Untersuchungsgruppe
- 5.4.2 Ablauf der Untersuchung für die Kontrollgruppe
- 5.5 Datenanalyse
- 5.1 Stichprobenbeschreibung
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Verhaltensauffälligkeiten
- 6.1.1 Psychische Symptombelastung
- 6.1.2 Alkoholkonsum
- 6.2 Kognitive Variablen
- 6.2.1 Vergleiche zwischen der UG und der KG
- 6.2.1.1 Bewältigungsverhalten
- 6.2.1.2 Selbstwirksamkeitserwartungen
- 6.2.1.3 Dysfunktionale Schemata
- 6.2.1.4 Automatische Gedanken
- 6.2.2 Geschlechts- und altersspezifische Auswertungen in Hinblick auf kognitive Variablen innerhalb der UG
- 6.2.3 Analyse der Bedeutung kognitiver Variablen für die psychische Symptombelastung
- 6.2.3.1 Bewältigungsverhalten
- 6.2.3.2 Selbstwirksamkeitserwartungen
- 6.2.3.3 Dysfunktionale Schemata
- 6.2.3.4 Automatische Gedanken
- 6.2.3.5 Ergebnisse univariater Varianzanalysen in Hinblick auf kognitive Variablen
- 6.2.3.6 Ergebnisse linearer Regressionsanalysen in Hinblick auf kognitive Variablen
- 6.2.1 Vergleiche zwischen der UG und der KG
- 6.3 Variablen der Eltern-Kind-Beziehung
- 6.3.1 Vergleiche zwischen der UG und der KG
- 6.3.2 Geschlechts- und altersspezifische Auswertungen in Hinblick auf Variablen der Eltern-Kind-Beziehung innerhalb der UG
- 6.3.3 Analyse der Bedeutung von Variablen der Eltern-Kind-Beziehung für die psychische Symptombelastung
- 6.3.4 Ergebnisse univariater Varianzanalysen in Hinblick auf Variablen der Eltern-Kind-Beziehung
- 6.3.5 Ergebnisse linearer Regressionsanalysen in Hinblick auf Variablen der Eltern-Kind-Beziehung
- 6.4 Ergebnisse linearer Regressionsanalysen in Hinblick auf kognitive Variablen und Variablen der Eltern-Kind-Beziehung
- 6.5 Resilienzen
- 6.6 Explorative Fallbeispiele
- 6.6.1 Fallbeispiel 1: Familie B. aus A.
- 6.6.2 Fallbeispiel 2: Familie W. aus N.
- 6.6.3 Zusammenfassung und Fazit
- 6.1 Verhaltensauffälligkeiten
- 7. Diskussion
- 7.1 Verhaltensauffälligkeiten
- 7.2 Kognitive Faktoren
- 7.3 Variablen der Eltern-Kind-Beziehung
- 7.4 Limitationen der vorliegenden Untersuchung
- 7.5 Fazit für die Praxis und weitere Forschungsvorhaben
- LITERATURVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit den Auswirkungen elterlichen Alkoholmissbrauchs auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Bedeutung kognitiver Faktoren für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten in dieser Population zu untersuchen. Die Arbeit beinhaltet eine Replikation bestehender Forschungsergebnisse hinsichtlich der erhöhten psychischen Symptombelastung bei Kindern aus alkoholbelasteten Familien und erforscht die Rolle von Bewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeitserwartungen, dysfunktionalen Schemata und automatischen Gedanken in diesem Zusammenhang. Zusätzlich werden familiäre Faktoren, insbesondere Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung, analysiert.
- Die psychische Symptombelastung von Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien im Vergleich zu einer Kontrollgruppe.
- Die Rolle von kognitiven Faktoren, wie Bewältigungsstrategien und Selbstwirksamkeitserwartungen, sowie dysfunktionalen Schemata und automatischen Gedanken für die psychische Gesundheit betroffener Kinder und Jugendlicher.
- Die Bedeutung von Familienvariablen, insbesondere der Eltern-Kind-Beziehung, für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten.
- Die Identifizierung von potenziellen Resilienzfaktoren, die eine gesunde Entwicklung trotz elterlichen Alkoholmissbrauchs fördern können.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit definiert die Begriffe Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit und beleuchtet die Prävalenz dieser Störungsbilder in Deutschland. Es werden zudem die gesundheitlichen und sozialen Folgen von Alkoholabhängigkeit für das Individuum und sein Umfeld beschrieben. Das zweite Kapitel fokussiert auf die Auswirkungen elterlichen Alkoholmissbrauchs auf Kinder und Jugendliche. Es wird das familiäre Transmissionsrisiko von Alkoholabhängigkeit beleuchtet und verschiedene Verhaltensauffälligkeiten, die bei Kindern aus alkoholbelasteten Familien häufiger auftreten, vorgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Risiko- und Schutzfaktoren, die die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten bei Kindern aus alkoholbelasteten Familien beeinflussen. Es werden verschiedene umgebungsbezogene und personenbezogene Risikofaktoren sowie Schutzfaktoren, die die Resilienz des Kindes stärken können, erläutert. Der empirische Teil der Arbeit präsentiert die Fragestellungen und Hypothesen der Untersuchung, beschreibt die Stichprobe und die verwendeten Erhebungsinstrumente sowie den Untersuchungsablauf und die Datenanalyse. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im siebten Kapitel diskutiert und in den Kontext der bisherigen Forschung eingeordnet. Es werden methodische und inhaltliche Einschränkungen der Studie beleuchtet und Implikationen für die praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien sowie für weitere Forschungsvorhaben abgeleitet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Alkoholmissbrauch und die Alkoholabhängigkeit, die Auswirkungen auf Kinder aus alkoholbelasteten Familien, die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten, die Bedeutung kognitiver Faktoren, wie Bewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeitserwartungen, dysfunktionale Schemata und automatische Gedanken, die Rolle von Familienvariablen, insbesondere der Eltern-Kind-Beziehung, sowie die Identifizierung von Resilienzfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Welche Risiken haben Kinder aus alkoholbelasteten Familien?
Diese Kinder haben ein erhöhtes Risiko für eigene Suchterkrankungen sowie für psychische Auffälligkeiten wie Depressionen, Ängste oder Sozialverhaltensstörungen.
Was sind externalisierende Auffälligkeiten?
Dazu gehören nach außen gerichtete Verhaltensweisen wie Hyperaktivität, Aggressivität oder Störungen des Sozialverhaltens.
Welche Rolle spielen kognitive Faktoren bei diesen Kindern?
Kognitive Faktoren wie dysfunktionale Schemata, negative automatische Gedanken und die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflussen maßgeblich, ob ein Kind psychische Symptome entwickelt.
Was versteht man unter Resilienzfaktoren?
Resilienzfaktoren sind Schutzmechanismen (z. B. eine stabile Bezugsperson oder gute Problemlösefähigkeiten), die Kindern helfen, trotz belastender Umstände gesund zu bleiben.
Was ist das familiäre Transmissionsrisiko?
Es beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Suchterkrankung von den Eltern auf die Kinder durch genetische und umweltbedingte Einflüsse übertragen wird.
- 1. Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit
- Citation du texte
- Diana Moesgen (Auteur), 2010, Die Bedeutung kognitiver Faktoren für die Entwicklung psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274512