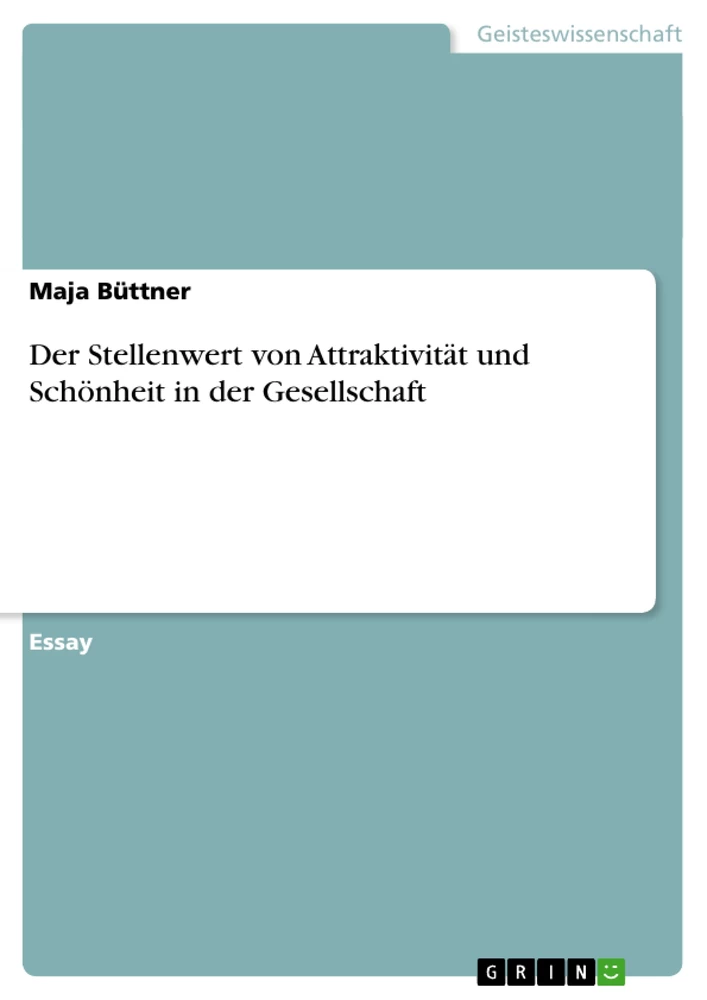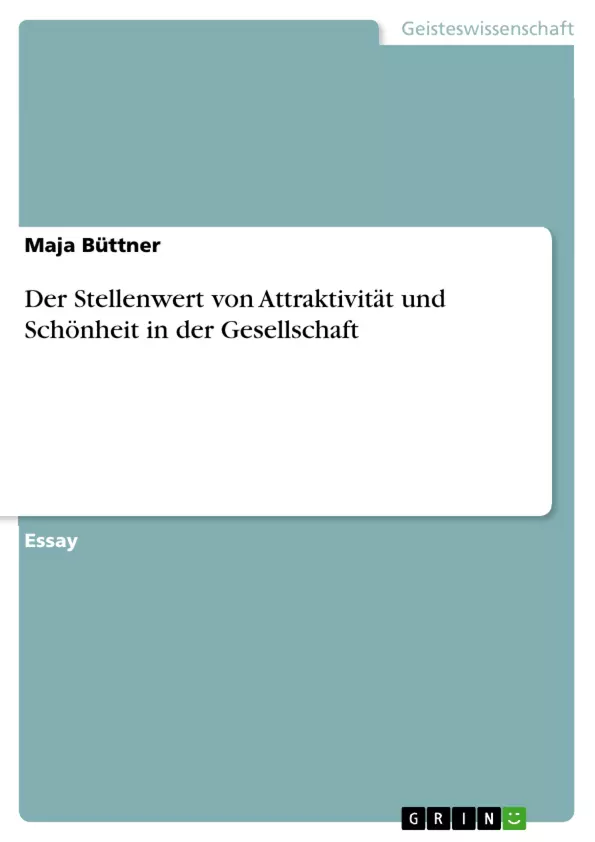Bei meiner Argumentation im Folgenden beziehe ich mich besonders auf das Buch „Körper machen Leute – Der Kult um die Schönheit“ von Waltraud Posch. Zunächst möchte ich darauf eingehen, inwieweit verschiedene Geschlechtscharaktere sozial konstruiert sind. Weiterhin erläutere ich Poschs Ausführungen über den Stellenwert von Attraktivität und Schönheit in der Gesellschaft und äußere mich kritisch zu ihrer Sichtweise. Außerdem stellt sie die Rolle der Frau sehr pauschal und schwach dar, was ich am Ende meines Textes widerlegen und hinterfragen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Unterschiede zwischen den Geschlechtern
- Der Umgang mit dem eigenen Körper
- Der Kampf mit dem eigenen Körper
- Medien
- Konkurrenz
- Frauen als Statussymbole
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlechtscharakteren und den Stellenwert von Schönheit und Attraktivität in der Gesellschaft. Die Autorin, Waltraud Posch, argumentiert, dass Schönheit als Mittel zur Selbstfindung und gesellschaftlichen Anerkennung dient, insbesondere für Frauen.
- Soziale Konstruktion von Geschlechtsrollen
- Der Einfluss von Schönheitsidealen auf das Selbstwertgefühl
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Schönheitsidealen
- Die Bedeutung von Attraktivität in der Gesellschaft
- Die Beziehung zwischen Schönheit und Macht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Argumentation ein und stellt das Buch „Körper machen Leute — Der Kult um die Schönheit" von Waltraud Posch als Grundlage für die Analyse dar.
Der erste Teil des Hauptteils behandelt die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Die Autorin argumentiert, dass Geschlechtsrollen durch Erziehung und gesellschaftliche Normen konstruiert werden. Sie betont die Rolle der Familie, des Kindergartens und der Schule in der Vermittlung von geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen.
Der zweite Abschnitt des Hauptteils widmet sich dem Umgang mit dem eigenen Körper, insbesondere im Hinblick auf die Pubertät. Die Autorin beschreibt, wie Mädchen im Vergleich zu Jungen stärker unter Druck stehen, den gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen. Sie analysiert die Auswirkungen von Selbstzweifeln und dem Wunsch nach Anerkennung auf das Selbstwertgefühl von Frauen.
Der dritte Teil des Hauptteils befasst sich mit dem Kampf mit dem eigenen Körper und der Rolle von Schönheit in der Gesellschaft. Die Autorin argumentiert, dass Schönheit mit gesellschaftlichen Erwartungen verbunden ist und Frauen dazu motiviert, sich für gesellschaftliche Anerkennung zu schmücken. Sie untersucht die Auswirkungen von Körperbildstörungen und Essstörungen auf das Selbstwertgefühl von Frauen.
Der vierte Abschnitt des Hauptteils analysiert den Einfluss der Medien auf die Konstruktion von Schönheitsidealen. Die Autorin zeigt auf, wie Werbung und Zeitschriften ein idealisiertes Bild von Schönheit präsentieren und Frauen dazu verleiten, sich mit Produkten zu schmücken, um Glück und Erfolg zu erlangen.
Der fünfte Teil des Hauptteils untersucht die Rolle der Konkurrenz im Kontext von Schönheitsidealen. Die Autorin argumentiert, dass Frauen im Wettbewerb um Schönheit stehen und sich mit anderen vergleichen, was zu Neid und Selbstzweifeln führt.
Der sechste und letzte Teil des Hauptteils behandelt Frauen als Statussymbole. Die Autorin argumentiert, dass Frauen in der Gesellschaft oft als Objekte der männlichen Begierde betrachtet werden und ihre Attraktivität als Mittel zur Erlangung von Status und Macht dient.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die soziale Konstruktion von Geschlechtsrollen, den Einfluss von Schönheitsidealen auf das Selbstwertgefühl, die Rolle der Medien in der Konstruktion von Schönheitsidealen, die Bedeutung von Attraktivität in der Gesellschaft und die Beziehung zwischen Schönheit und Macht.
Häufig gestellte Fragen
Sind Geschlechtsrollen biologisch oder sozial bedingt?
Laut Waltraud Posch und der soziologischen Perspektive werden Geschlechtsrollen weitgehend sozial konstruiert, insbesondere durch Erziehung in Familie, Kindergarten und Schule.
Welchen Einfluss haben Medien auf unser Schönheitsideal?
Medien präsentieren oft idealisierte und unrealistische Bilder von Schönheit. Dies erzeugt Druck, besonders bei jungen Frauen, diesen Idealen zu entsprechen, um gesellschaftliche Anerkennung zu finden.
Warum wird Schönheit oft als "Machtmittel" betrachtet?
In der Gesellschaft wird Attraktivität häufig mit Erfolg und Status gleichgesetzt. Schönheit kann somit als Kapital genutzt werden, um soziale Vorteile oder Anerkennung zu erlangen.
Wie wirkt sich der Fokus auf Attraktivität auf das Selbstwertgefühl aus?
Ständige Vergleiche und der Drang, Idealen zu entsprechen, können zu Selbstzweifeln, Körperbildstörungen und Essstörungen führen, wenn die eigenen Merkmale nicht mit den gesellschaftlichen Erwartungen übereinstimmen.
Was bedeutet die Aussage "Körper machen Leute"?
Dies ist eine Anspielung auf "Kleider machen Leute" und besagt, dass der Körper in der modernen Gesellschaft zum primären Träger von Status, Identität und sozialer Bewertung geworden ist.
- Citar trabajo
- Maja Büttner (Autor), 2012, Der Stellenwert von Attraktivität und Schönheit in der Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274591