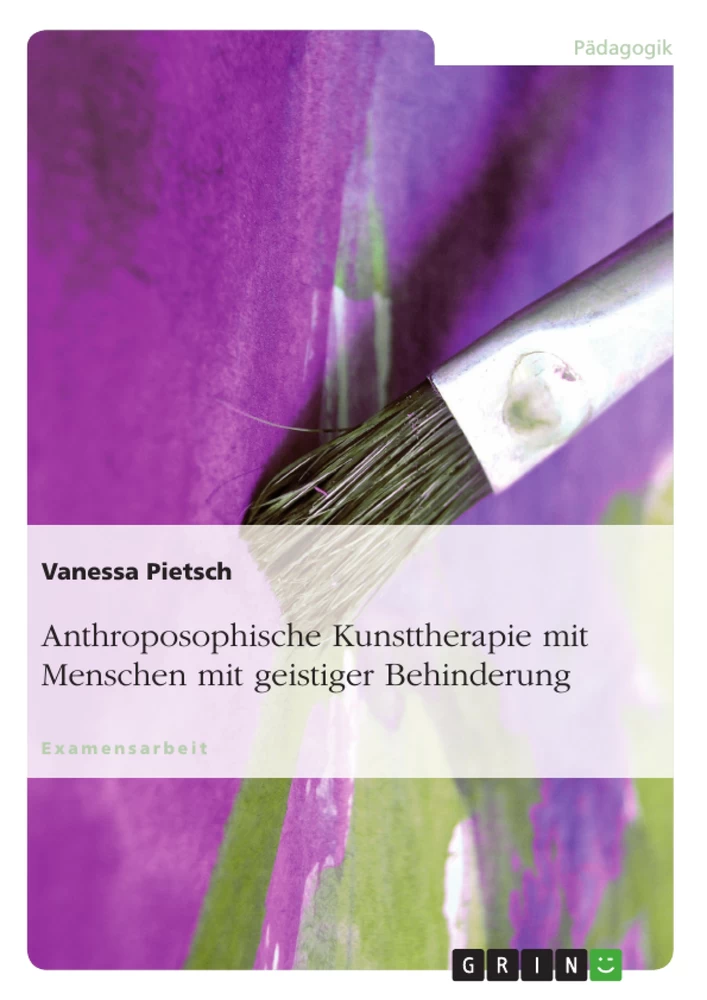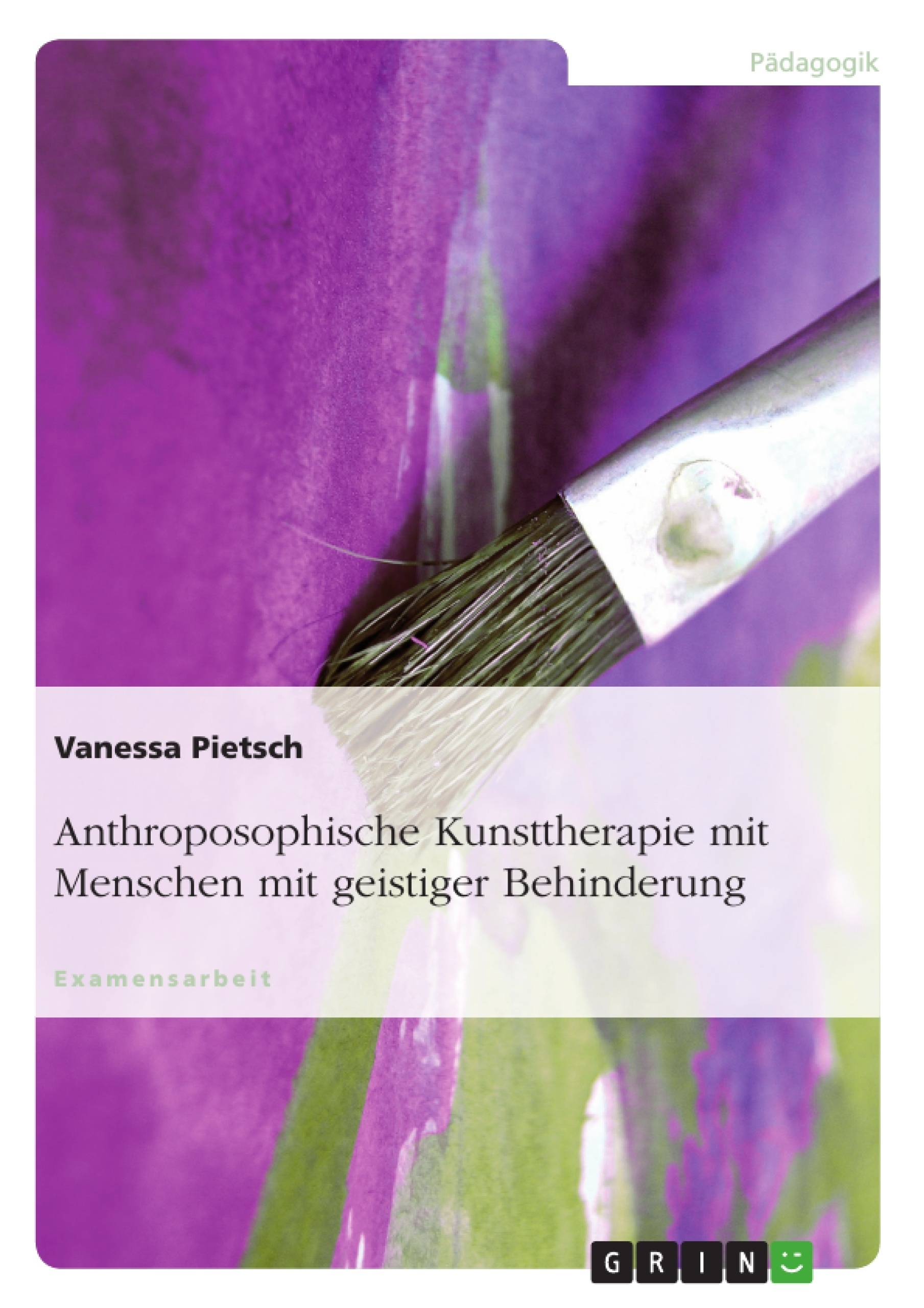Zu dem Thema "Anthroposophische Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung" gibt es meines Wissens - neben einigen Aufsätzen - nur das Buch von E.-L. Damm (1999). Ebenso, wie in den anderen Büchern zur allgemeinen anthroposophischen Kunsttherapie werden dem Leser zwar die Behandlungsanweisungen deutlich - es wird auch dargestellt, worauf sie abzielen - man erhält jedoch nicht ausreichende Informationen über den zu Grunde liegenden Hintergrund: Die Anthroposophie. Das anthroposophische Vokabular wird mit Selbstverständnis verwendet und größtenteils als bekannt vorausgesetzt. Dies erschwert erheblich, die beschriebenen Vorgehensweisen nachzuvollziehen.
Daraus ergibt sich die Zielsetzung dieses Buches, die „anthroposophische Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung“ auch „Nichtanthroposophen“ verständlicher und durchschaubarer zu machen.
Zum besseren Verständnis ist das vorliegende Buch in drei aufeinander aufbauende Stufen gegliedert.
Auf der ersten Stufe sollen die für die Kunsttherapie relevanten anthroposophischen Hintergründe und Begriffe, die auf den Geisteswissenschaften Rudolf Steiners beruhen, erklärt werden.
Auf der zweiten Stufe werden die Grundlagen der allgemeinen anthroposophischen Kunsttherapie für Kranke beschrieben, die wiederum die Basis für den Behandlungsansatz, der auf Menschen mit geistiger Behinderung abzielt, darstellt.
Auf der dritten Stufe wird das anthroposophische Verständnis von „Geistiger Behinderung“ geklärt. So kann der spezifische Behandlungsansatz der „anthroposophischen Kunsttherapie für Menschen mit geistiger Behinderung“ nachvollziehbar und verständlich dargestellt werden.
Zum Abschluss des Buches soll anhand von drei Fallbeispielen veranschaulicht werden, wie dieses Kunsttherapiekonzept mit Menschen mit geistiger Behinderung in der Praxis umgesetzt werden kann.
Hinweis:
Das anthroposophische Welt- und Menschenbild wird in diesem Buch weder hinterfragt noch beurteilt. Es geht um eine wertfreie Darstellung eines Therapieansatzes.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hintergründe der anthroposophischen Kunsttherapie
- II.1 Definition: Hintergründe
- II.2 Die Lehre der Anthroposophie
- II.2.1 Der kosmische Ursprung des Menschen
- II.2.2 Reinkarnation und Karma
- II.2.3 Die Dreigliederung des Menschen
- II.2.4 Die Viergliederung des Menschen
- II.2.5 Die Sinne nach Rudolf Steiner
- II.2.6 Die Stufen der Erkenntnis nach Rudolf Steiner
- III. Grundlagen der anthroposophischen Kunsttherapie
- III.1 Definition: Grundlagen
- III.2 Definition Kunsttherapie
- III.3 Anthroposophische Kunsttherapie
- III.3.1 Zum Grundverständnis der anthroposophischen Kunsttherapie
- III.3.2 Was bedeutet künstlerisches Arbeiten in der Anthroposophie?
- III.3.2.1 Die Bedeutung der Sinne beim künstlerischen Tun
- III.3.3 Die Hauptkünste
- III.3.3.1 Malen
- III.3.3.1.1 Die Bedeutung der Farbe beim Malen
- III.3.3.2 Zeichnen
- III.3.3.2.1 Formenzeichnen
- III.3.3.2.2 Dynamisches Zeichnen
- III.3.3.3 Farben und Formen
- III.3.3.1 Malen
- IV. Anthroposophische Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung
- IV.1 Begriffsklärung: Geistige Behinderung
- IV.2 Menschen mit geistiger Behinderung aus anthroposophischer Sicht
- IV.2.1 Drei Behinderungsbilder aus anthroposophischer Sicht
- IV.2.1.1 Der Menschen mit Autismus
- IV.2.1.2 Der Menschen mit Epilepsie
- IV.2.1.3 Der mongoloide Mensch
- IV.2.1 Drei Behinderungsbilder aus anthroposophischer Sicht
- IV.3 Anthroposophische Kunsttherapie mit Seelenpflege-bedürftigen Menschen
- IV.3.1 Zum Grundverständnis der anthroposophischen Kunsttherapie mit Seelenpflege-bedürftigen Menschen
- IV.3.2 Die Hauptkünste in Bezug auf die therapeutische Arbeit mit Seelenpflege-bedürftigen Menschen
- IV.3.2.1 Malen
- IV.3.2.1.1 Nass-in-Nass Malen
- IV.3.2.2 Zeichnen
- IV.3.2.2.1 Formenzeichnen
- IV.3.2.2.2 Dynamisches Zeichnen
- IV.3.2.1 Malen
- IV.4 Phänomenologische Beobachtung und ihre Interpretation
- IV.4.1 Interpretation der phänomenologischen Beobachtung in Bezug auf die Drei- und Viergliederung
- IV.4.2 Punkt- und Kreistendenz
- V. Anthroposophische Kunsttherapie mit Seelenpflege-bedürftigen Menschen, aufgezeigt an drei Fallbeispielen
- V.1 Rahmenbedingungen
- V.1.1 Institution Camphill
- V.1.2 Mein Praktikum in der Camphill-Lebensgemeinschaft Alt Schönow
- V.2 Fallbeispiele
- V.2.1 Zum Begriff: „Fallbeispiel“
- V.2.2 Vorbemerkungen zu den Fallbeispielen
- V.2.3 Fallbeispiel 1: Mario – Ein Mensch mit Autismus
- V.2.3.1 Angaben zur Person
- V.2.3.2 Phänomenologische Beobachtung und Interpretation
- V.2.3.2.1 Phänomenologische Beobachtung
- V.2.3.2.2 Interpretation nach der Dreigliederung
- V.2.3.2.3 Interpretation nach der Viergliederung
- V.2.3.2.4 Interpretation nach der Punkt- und Kreistendenz
- V.2.3.3 Zur allgemeinen Therapieplanung
- V.2.3.4 Zur Therapiestunde
- V.2.3.4.1 Planung
- V.2.3.4.2 Stundenverlauf
- V.2.3.4.3 Abschließende Bemerkung
- V.2.4 Fallbeispiel 2: Gesa -ein Mensch mit Epilepsie und Athetose
- V.2.4.1 Angaben zur Person
- V.2.4.2 Phänomenologische Beobachtung und Interpretation
- V.2.4.2.1 Phänomenologische Beobachtung
- V.2.4.2.2 Interpretation nach der Dreigliederung
- V.2.4.2.3 Interpretation nach der Viergliederung
- V.2.4.2.4 Interpretation nach der Punkt- und Kreistendenz
- V.2.4.2.5 Interpretation nach den Vier Elementen
- V.2.4.3 Zur allgemeinen Therapieplanung
- V.2.4.4 Zur Therapiestunde
- V.2.4.4.1 Planung
- V.2.4.4.2 Stundenverlauf
- V.2.4.4.3 Abschließende Bemerkung
- V.2.5 Fallbeispiel 3: Pia -ein Mensch mit Epilepsie und Athetose
- V.2.5.1 Angaben zur Person
- V.2.5.2 Phänomenologische Beobachtung und Interpretation
- V.2.5.2.1 Phänomenologische Beobachtung
- V.2.5.2.2 Interpretation nach der Dreigliederung
- V.2.5.2.3 Interpretation nach der Viergliederung
- V.2.5.2.4 Interpretation nach der Punkt- und Kreistendenz
- V.2.5.3 Zur allgemeinen Therapieplanung
- V.2.5.4 Zur Therapiestunde
- V.2.5.4.1 Planung
- V.2.5.4.2 Stundenverlauf
- V.2.5.4.3 Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit soll die „anthroposophische Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung“ für ein breiteres Publikum zugänglich machen, indem sie die zugrundeliegenden Prinzipien der Anthroposophie verständlich erklärt und an konkreten Fallbeispielen veranschaulicht. Dabei wird das Augenmerk auf die Anwendung der anthroposophischen Kunsttherapie im Kontext der Camphill-Bewegung gelegt.
- Die Grundlagen der anthroposophischen Kunsttherapie
- Die Anwendung der anthroposophischen Kunsttherapie bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Bedeutung der phänomenologischen Beobachtung und Interpretation im therapeutischen Prozess
- Fallbeispiele aus der Praxis, die die Anwendung der anthroposophischen Kunsttherapie veranschaulichen
- Die Einordnung der anthroposophischen Kunsttherapie im Kontext der Camphill-Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit der „anthroposophischen Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung“ auseinanderzusetzen. Dabei wird der Mangel an zugänglicher Literatur für Nichtanthroposophen hervorgehoben.
Kapitel II beleuchtet die Hintergründe der anthroposophischen Kunsttherapie, indem es die Grundprinzipien der Anthroposophie nach Rudolf Steiner erläutert. Hierzu gehören die kosmische Herkunft des Menschen, die Reinkarnation und das Karma, sowie die Drei- und Viergliederung des Menschen. Darüber hinaus werden die Sinne und die Stufen der Erkenntnis nach Rudolf Steiner behandelt.
Kapitel III befasst sich mit den Grundlagen der anthroposophischen Kunsttherapie. Es definiert die Kunsttherapie im Allgemeinen und beleuchtet die anthroposophische Sicht auf künstlerisches Arbeiten. Besondere Aufmerksamkeit wird der Bedeutung der Sinne beim künstlerischen Tun sowie den Hauptkünstlern - Malen und Zeichnen - geschenkt.
Kapitel IV erörtert die anthroposophische Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung. Zunächst wird der Begriff „geistige Behinderung“ geklärt und anschließend die anthroposophische Sicht auf Menschen mit geistiger Behinderung erläutert. Dabei werden drei Behinderungsbilder aus anthroposophischer Sicht - Autismus, Epilepsie und Mongoloidismus - dargestellt.
Kapitel V präsentiert drei Fallbeispiele aus der Praxis, die die Anwendung der anthroposophischen Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung veranschaulichen. Jedes Fallbeispiel umfasst die Angaben zur Person, die phänomenologische Beobachtung und Interpretation sowie die Therapieplanung und -durchführung.
Schlüsselwörter
Anthroposophische Kunsttherapie, Menschen mit geistiger Behinderung, Seelenpflege-bedürftige Menschen, Camphill, Phänomenologische Beobachtung, Interpretation, Dreigliederung, Viergliederung, Punkt- und Kreistendenz, Fallbeispiele, Rudolf Steiner.
Häufig gestellte Fragen
Was ist anthroposophische Kunsttherapie?
Es ist ein Therapieansatz, der auf der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners basiert und künstlerische Mittel wie Malen und Zeichnen nutzt, um die seelische und körperliche Entwicklung zu fördern.
Wie wird „geistige Behinderung“ in der Anthroposophie verstanden?
In der Anthroposophie werden Menschen mit Behinderung oft als „seelenpflege-bedürftig“ bezeichnet, wobei der unversehrte geistige Kern des Menschen im Zentrum steht.
Welche Rolle spielen Malen und Zeichnen in der Therapie?
Malen (z. B. Nass-in-Nass) wirkt stark auf das Gefühlsleben, während Zeichnen (z. B. Formenzeichnen) die Konzentration und Strukturierung des Ichs unterstützt.
Was bedeutet die „Viergliederung des Menschen“?
Die Anthroposophie unterscheidet zwischen dem physischen Leib, dem Ätherleib (Lebenskräfte), dem Astralleib (Seelenleben) und der Ich-Organisation.
Was ist die Camphill-Bewegung?
Camphill ist eine internationale Bewegung von Lebensgemeinschaften, in denen Menschen mit und ohne Behinderung auf Basis anthroposophischer Werte zusammenleben und arbeiten.
Was ist eine phänomenologische Beobachtung?
Es ist eine wertfreie Beobachtung des Patienten und seiner Werke, um daraus Rückschlüsse auf seine Konstitution und den nötigen Therapieplan zu ziehen.
- V.1 Rahmenbedingungen
- Quote paper
- Vanessa Pietsch (Author), 2003, Anthroposophische Kunsttherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27471